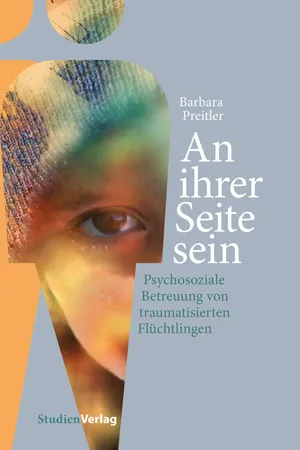![]()
1. Flucht – psychische Verletzungen, psychische Stärke
Heilsame Beziehungen
Menschen, die durch andere Menschen schwer verletzt worden sind, brauchen vor allem eines: heilsame Beziehungen. Und diese können überall dort stattfinden, wo Menschen einander begegnen.
Im Rahmen der Posttraumatischen Belastungsstörung kennen wir die Vermeidung von „Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten“ (ICD 10). Zur Erklärung dieses Phänomens ist es leichter, kurz zu anderen Auslösern von traumatischen Erlebnissen zu wechseln, wie Naturkatastrophen. Nach dem großen Tsunami von 2004 wussten alle, dass Menschen, die diese schreckliche Flut erlebt haben, Angst vor dem Meer oder großen Gewässern haben werden. Es brauchte gar keine ExpertInnen, die erklären mussten, was psychologisch vorgeht – es ist ureigenes menschliches Wissen, dass wir vermeiden, was uns verletzt hat. Und im Fall des Tsunamis war es eben das Meer. Und wir verstehen auch, dass die Überlebenden nicht nur Angst vor dem indischen Ozean in Thailand, Indonesien oder Sri Lanka haben, sondern sich diese Vermeidung auch auf den Atlantik, das Mittelmeer und vielleicht sogar auf den Bodensee oder Wörthersee erweitern kann.
Was ist aber, wenn es nicht die Verschiebung von Erdplatten und das Meer ist, das die schwere psychische Verletzung verursacht, sondern andere Menschen? Es ist schon erstaunlich, dass wir hier viel mehr Schwierigkeiten haben, Vermeidung zu verstehen. Tatsächlich ist die Angst vor anderen Menschen, die in irgendeiner Form an die TäterInnen erinnern, ein häufiges Phänomen nach Traumatisierungen. Dies können z.B. Menschen in Uniform sein oder alle Menschen, die eine bestimmte Sprache sprechen oder auch Menschen einer ethnische Gruppe oder eines Geschlechts. Im schlimmsten Fall wird ganz generalisiert und die Angst umfasst alle Menschen.
Gehen wir nochmals zurück zur Naturkatastrophe, dem Tsunami. Wer die Katastrophe als mitteleuropäische/r Tourist/in überlebt hat, kann die Vermeidung aufrechterhalten. Ein erfülltes Leben ist durchaus möglich, ohne jemals wieder ans Meer fahren zu müssen. Der Alltag findet im Binnenland statt und Urlaube können in den Bergen, am Land oder in Städten verbracht werden. Aber für Fischerfamilien, die ihr Haus in unmittelbarer Nähe zum Strand hatten, sieht es anders aus: Die Vermeidung des Meeres würde sie ihrer Erwerbsmöglichkeiten, ihrer Wohnung und ihrer Heimat berauben. Es braucht also Strategien, um wieder am Meer leben zu können.
Ähnlich ist es, wenn Menschen die Ursache der schweren Traumatisierungen waren: Es braucht Strategien, um wieder unter Menschen leben zu können, um nicht in die soziale Isolation gehen zu müssen.
Das Bild einer Balkenwaage kann hier hilfreich sein: Eine schwere Traumatisierung fällt wie ein ganz schweres Gewicht in die eine Waagschale, alltägliche Erfahrungen auf der anderen Seite hingegen sind Leichtgewichte. Es braucht also sehr viele ganz normale, alltägliche Erfahrungen, um wieder in Balance zu kommen. Gute Begegnungen wiegen schon etwas schwerer. Und so können heilsame Beziehungen zu anderen Menschen, wo immer sie stattfinden, wichtige Bausteine für ein gutes Leben nach traumatischen Ereignissen werden.
Psychotherapie stellt per Definition eine Begegnung zweier Menschen dar, die diese heilsame Beziehung in den Mittelpunkt stellt. Aber heilsame Beziehungen bzw. Begegnungen können überall dort stattfinden, wo Menschen aufeinandertreffen.
Manchmal sind es nur kurze Begegnungen, die als Kraftquelle in schwierigen Zeiten helfen können. So hat es mich berührt, dass mehrere meiner KlientInnen berichtet haben, dass sie in Zeiten, als es den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres an der grünen Grenze zwischen Österreich und Ungarn gab, von den österreichischen Grundwehrdienern so gut in Empfang genommen worden sind. Auch viele Jahre später wurde dieser freundliche Empfang durch die jungen Soldaten von vielen als besonderer Moment beschrieben und erlebt. Für wenige Stunden haben sie sich willkommen und als Menschen mit Bedürfnissen ernst genommen gefühlt. Diese schöne Erfahrung konnte als Kraftquelle genutzt werden, als es danach wieder schwierig und belastend geworden ist.
Neu angekommene Flüchtlinge berichten, wie schlimm es war, nur mehr Teil einer großen Masse gewesen zu sein und das Gefühl gehabt zu haben, als individueller Mensch nichts mehr zu zählen. Wie gut war es dann, wenn eine Helferin einmal freundlich war, nach den Namen gefragt hat und wie es derzeit geht, oder wenn ein Helfer sich ernsthaft um die schmerzenden Füße gekümmert hat und nicht vermittelt hat, dass dies jetzt nur den geregelten Ablauf stört!
Diese kurzen Begegnungen sind wie Oasen, die das psychische Überleben gesichert haben und auch noch Jahre später in guter Erinnerung sein können.
Posttraumatische Belastung
Die Diagnose der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTBS) stellt die psychiatrische/psychologische Hauptdiagnose für traumatisierte Flüchtlinge dar. Erstmals wurde sie im Diagnosemanual der American Psychiatric Association (APA) im Jahr 1980 (DSM III-R) beschrieben und zuletzt im Jahr 2013 in der Revision des Manuals, dem DSM V modifiziert. (APA, 2013)
Symptome in den vier Hauptsymptomgruppen:
1. quälende Erinnerungen an das traumatische Geschehen (tagsüber und nachts),
2. Vermeidung dieser schmerzhaften Erinnerung und von allem, was diese auslösen könnte,
3. Übererregung,
4. negative Gefühle wie tiefe Traurigkeit, Verzweiflung, Gefühle der inneren Leere, keine Zukunftsperspektive
kennen wir von fast allen unserer KlientInnen.
Mit der Diagnose haben wir eine gemeinsame Sprache gefunden, die nicht nur innerhalb des medizinischen/psychologischen Betreuungsteams Verwendung findet, sondern auch einen Konsens mit Behörden und betreuenden NGOs darstellt und, vielleicht sogar am wichtigsten, mit den KlientInnen selbst.
Viele können die psychische Symptomatik nicht zuordnen und haben Angst, dass sie ein weiterer Schicksalsschlag getroffen hat und sie jetzt psychisch krank geworden sind. Die Erklärung der Diagnose ist daher sehr entlastend: Es gibt einen Namen für das, was jetzt erlebt wird, es ist nichts, was zusätzlich passiert, sondern die Reaktion auf in der Vergangenheit Geschehenes. Es ist eine Verletzung, keine Erkrankung! Die Gewalt, der die betroffene Person ausgesetzt war, war so groß, dass es zu Verwundungen gekommen ist, auch wenn die dazu gehörenden Symptome und Schmerzen erst mit Verzögerung spürbar geworden sind.
Psychoedukation, im Sinne einer Erklärung was eine Posttraumatische Belastung ist und wie sie sich auswirkt, stellt daher eine wichtige Entlastung für die Betroffenen dar.
Kritische Anmerkungen zur PTBS
Aber es gibt auch viele kritische Anmerkungen zu dieser Diagnose zu machen. Es beginnt bereits beim Namen. Der vierte Buchstabe, das „S“ in der PTBS, steht für Störung. Wir sagen mit der Diagnose also der betroffenen Person, dass sie eine Störung hat. Meiner Meinung nach ist dies eine Entwertung der Opfer und auch eine Opfer/TäterInnen-Verschiebung. Ja, es gab eine Störung. Die liegt aber bei Menschenrechtsverletzungen immer bei den TäterInnen und nicht bei den Menschen, die aufgrund der ausgeübten Gewalt verletzt worden sind! Traumatische Reaktionen sind normale Reaktionen auf abnormale, gestörte Gewalt.
Auch das „P“ für „post“ muss in der Arbeit mit AsylwerberInnen hinterfragt werden: Post – danach – suggeriert, dass die traumatische Situation vorbei und abgeschlossen ist. Aber gerade AsylwerberInnen wissen nicht, ob sie nicht wieder in die Krisenregion zurückmüssen, sie wieder erneut gleichen oder ähnlichen Situationen ausgesetzt werden. Ihre Lebenssituation ist von massivem akutem Stress gekennzeichnet. Es gibt nicht genug Energie, um sich mit den traumatischen Erfahrungen, die zur Flucht geführt haben, auseinanderzusetzen. Aber auch dann, wenn nach wie vor Angehörige in der Krisenregion leben, kommt es immer wieder zur Aktualisierung der Traumata. Es bleibt oft ein frommer Wunsch, dass für unsere KlientInnen die traumatischen Situationen bereits vorbei sind und sie sich nun an die psychische Bewältigung der Vergangenheit machen könnten. Jede Form der therapeutischen und der psychosozialen Aufarbeitung der traumatischen Vergangenheit wird durch akute Stresssituationen immer wieder erschwert.
Latenzzeit – Zeit der inneren Ruhe
Unmittelbar nach traumatischen Ereignissen kommt es zur akuten Belastungsreaktion. Diese wäre grundsätzlich diagnostizierbar, wird aber fast nie gebraucht. Es ist viel zu klar und menschlich verständlich, dass Menschen auf belastende Reaktionen unmittelbar mit Zittern, Erstarren, Weinen etc. reagieren.
Nach der akuten Belastung kommt es bei vielen Menschen zu einer Zeit, in der sie psychisch relativ stabil mit der Situation umgehen können, gerade dann, wenn viel zu tun ist, die ganze Aufmerksamkeit dem Alltag gewidmet werden muss. Diese Zeit ohne Symptome der posttraumatischen Belastung wird als Latenzzeit beschrieben. Dies gilt natürlich auch für Menschen auf der Flucht. Jeder Tag erfordert Anpassung an eine neue Situation, für Gedanken an die Vergangenheit gibt es keinen Raum und keine Energie. Aber nach einiger Zeit – und dies kann auch einen sehr langen Zeitraum umfassen – werden die alten traumatischen Erfahrungen wieder zentral: in den Erinnerungen und den Versuchen, diese zu vermeiden. Nervosität, Traurigkeit, Konzentrations- und Merkstörungen treten auf und beeinträchtigen den Alltag. Die Latenzzeit ist vorbei, es kommt zu Posttraumatischen Belastungen und Leiden.
Die Latenzzeit kann individuell sehr verschieden sein. Spätestens seit die Holocaustüberlebenden alt geworden sind, wissen wir, dass diese sogar mehrere Jahrzehnte umfassen kann. Viele, die die Shoa als Jugendliche oder junge Erwachsene überlebt haben und danach „mit beiden Beinen“ im Leben gestanden sind, entwickelten mit dem Einsetzen des Alters eine PTBS. Oft war es ein Lebensereignis wie das Erreichen des Pensionsalters, der Auszug des letzten Kindes, das sie auf die unbewältigten traumatischen Erlebnisse zurückgeworfen hat.
„Wir haben so viel gearbeitet und am Abend war ich immer so müde, dass ich schon geschlafen habe, bevor mein Kopf den Polster berührt hat“, beschreibt eine Klientin die aktiven Jahrzehnte, nachdem sie das Arbeitslager überlebt hatte. Aber im Alter kamen viele körperliche Erkrankungen, die sie dazu zwangen, weniger aktiv zu sein. Mit der körperlichen Ruhe tauchten die Bilder der extrem schwierigen Kindheit und Jugend auf. Sie fühlte sich den alten Erinnerungen an massive Menschenrechtsverletzungen, der Ermordung des Vaters, der Verzweiflung der Mutter, dem Gefühl des Hungers, der Angst … ausgeliefert. Die Symptomatik der schmerzhaften Erinnerungen, der Vermeidung, der Übererregtheit waren alle auch so viele Jahre später vorhanden.
Der therapeutische Prozess war allerdings ein ganz anderer als der mit Menschen, deren traumatische Erlebnisse Wochen oder Monate zurückliegen. Immer wieder ging es um die gesamte Lebensgeschichte und um die Anerkennung, es trotz dieser schweren traumatischen Erfahrungen geschafft zu haben, viel Gutes im Leben danach geleistet zu haben. Genaues Zuhören und Interesse an der gesamten Biografie sind hier zentrale Momente.
Schmerzhafte Erinnerungen – zuhören hilft
Die Erinnerung an schwere traumatische Erfahrungen kann sehr aufdringlich sein und trotz intensiver Versuche, sie zu unterdrücken, massiv in den Alltag Einfluss nehmen. Das kann in Form von schmerzhaften Erinnerungen passieren. Betroffene beschreiben diese als „Wie ein Schleier der sich über das ganze Leben legt“ oder das Bild von damals ist „wie in die Netzhaut eingebrannt“.
Die Ambivalenz zwischen der Vermeidung von traumatischen Inhalten und zugleich dem Wunsch zu erzählen kostet viel Kraft. Wichtig ist es, Raum und Zeit zu geben. Wenn der Wunsch zu erzählen groß wird, ist es gut, wenn jemand da ist, der zuhört. Sehr oft wird dafür eine vertraute Person „gewählt“. Bei Flüchtlingen kann das eine Bezugsperson, bei der er/sie sich sicher genug fühlt, sein.
Die ersten Ansätze und Versuche sind mitunter noch von diesen widersprüchlichen Tendenzen geprägt. Kurz bevor ein Treffen zu Ende geht, wird eine schlimme Erfahrung angesprochen. Es ist ein kleiner Testlauf: Wie reagiert die Person, der ich mich anvertrauen will? Rückzug wäre sofort möglich. Es ist gut, hier eine Einladung auszusprechen. Auch wenn es im Moment vielleicht nicht geht, so kann das Gespräch bald einmal stattfinden.
Zuzuhören heißt sich einzulassen. Das heißt, dass es durchaus erschüttern kann, was hier zur Sprache kommt. Manche schwer belasteten Menschen haben sehr große Bedenken wegen dieser Zumutbarkeit: Ist das, was sie erlebt haben, nicht allein in der Wiedererzählung eine zu große Belastung für den Zuhörenden?
Es erscheint mir sehr wichtig, hier gut aushalten zu können: Der/die Zuhörende soll signalisieren, dass er/sie stark genug ist und ertragen kann, zu hören, was Not tut. Da es um großes Unrecht, Leid und Tod geht, sind viele Emotionen im Spiel. Es kann also durchaus passieren, dass der/dem Zuhörenden auch die Tränen kommen. Es sollte dann verbalisiert werden, dass das Tränen des Mitgefühls sind und nicht Tränen der Schwäche. Ich weine mit dir, weil es mir leidtut, was du alles ertragen musstest. Aber ich kann es aushalten, dir zuzuhören und dich so zu begleiten!
Um beide GesprächspartnerInnen zu schützen, soll eine möglichst gute Gesprächssituation hergestellt werden: ein ruhiger ungestörter Ort, an dem sich beide wohlfühlen, ausgeschaltete Handys und ein zeitlicher Rahmen, damit die Inhalte nicht zu überwältigend werden können. Wird die vereinbarte Zeit (nie länger als eine Stunde bis höchstens 1 ½ Stunden) zu kurz, kann ja ein nochmaliges Gespräch vereinbart werden.
Zu Ende des Gesprächs sollten immer ein paar Minuten Zeit genommen werden, um wieder ganz im Hier und Jetzt anzukommen: Das Fenster wird geöffnet, gemeinsam werden ein paar Atemzüge genommen, vielleicht noch gemeinsam Tee oder Kaffee getrunken. Das Gespräch sollte jetzt nochmals ganz auf den Alltag fokussieren: Was wirst du/werden Sie heute noch machen? Wohin gehen Sie jetzt? Was wird gekocht und gegessen? Es mutet meist sehr banal an, über so Alltägliches zu reden, wenn gerade schlimme Kriegs- und Fluchtdrame...