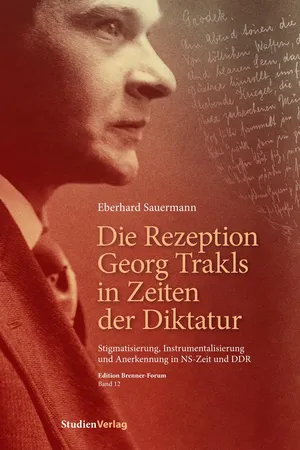![]()
A. Rezeption Trakls in der NS-Zeit
Forschungsstand
Angesichts der uneinheitlichen, ja widersprüchlichen Rezeption bestimmter Autoren in der NS-Zeit hat Egon Schwarz schon vor Jahrzehnten betont, jede Rezeption sei eine Begegnung komplizierter Kräfte, „die von ökonomischen, sozialen, politischen, ästhetischen und weltanschaulichen Faktoren abhängt“, sie entstehe nicht nur „aus den Reaktionen der Empfänger auf einen Schriftsteller“, sondern enthalte auch „manches von dem, was sein Werk und seine Person beizusteuern haben“.1 Obwohl diese Erkenntnis mittlerweile zum Allgemeingut geworden und durch Sozialgeschichtsschreibung der Literatur, Rezeptionsästhetik oder Rezeptionstheorien wie die „kulturellen Modelle“ vertieft worden ist,2 hat Schwarz’ Forderung, „in jedem Fall die besonderen Rezeptionsbedingungen zu untersuchen und den Knäuel von Motiven und Vorbehalten, Interessen und Zufällen zu entwirren“,3 nichts an Aktualität eingebüßt.
Die Rezeption Trakls in der NS-Zeit ist bisher kaum erforscht worden. Nur die (ungedruckte) rezeptionsgeschichtliche Dissertation über Trakl von Diana Orendi-Hinze hat sich damit näher beschäftigt.4 Allerdings weisen sowohl die Methoden dieser Studie als auch die historischen Kenntnisse ihrer Verfasserin schwere Mängel auf, und das Korpus der untersuchten Texte aus der NS-Zeit ist viel zu rudimentär. Walter Methlagl übernimmt in einem Aufsatz zur Wirkung Trakls einige Ergebnisse der Arbeit Orendi-Hinzes und gibt darüber hinaus nur ein paar Rezeptionszeugnisse aus der NS-Zeit wieder.5 Die von ihm betreute (ungedruckte) Dissertation Brunhilde Schwabl-Wiesers untersucht die Rezeption Trakls in Anthologien, unter anderem in einigen aus der NS-Zeit, allerdings mit mangelnder Differenzierung.6 – All diese Studien scheinen von der Prämisse geleitet zu sein, der Nationalsozialismus ist etwas durch und durch Verabscheuungswürdiges, mit dem die Lichtgestalt Trakl nicht in Einklang gebracht werden kann bzw. darf.
Abgesehen davon findet sich nur sehr wenig: ein Hinweis auf die positive Beurteilung von Frühexpressionisten wie Trakl durch einzelne NS-Germanisten7 sowie kurze Bemerkungen zur Rezeption Trakls in der NS-Zeit generell und in Salzburg speziell.8 Es spricht Bände, dass ein auf einem Grazer Symposion beruhender, aus zwei Dutzend Aufsätzen bestehender Sammelband über österreichische Literatur im Nationalsozialismus zum Thema ‚Trakl in der NS-Zeit‘ einen einzigen Satz erübrigt: „Georg Trakl blieb selektiv im Kanon.“ Noch dazu erfolgt das nicht durch einen Germanisten, sondern durch den Historiker Ernst Hanisch, der in der Anmerkung zu dieser Aussage nur auf seinen eigenen Aufsatz über die Rezeption Trakls in Salzburg verweist.9 In seiner umfangreichen Studie über Salzburg in der NS-Zeit erwähnt jedoch Hanisch Trakl mit keinem Wort.10
Erst vor wenigen Jahren hat ein Forscher den Forschungsstand mit wichtigen Erkenntnissen bereichert. In seinem Aufsatz über den literarischen Dialog von Autoren der 1930er- und 1940er-Jahre mit Trakl (von dem noch die Rede sein wird) vertritt Mark Elliott die Auffassung, in dem vom NS-Regime kontrollierten Bereich von Literaturgeschichten, Zeitschriften und Zeitungen sei die Rezeption Trakls gemischt gewesen; die mit der NS-Ideologie unvereinbaren Aspekte von Trakls Leben und Werk seien nicht schlankweg verdammt, sondern entsprechend umgedeutet worden.11
Wie überrascht die gegenwärtige Trakl-Forschung von neuen Forschungsergebnissen zur Trakl-Rezeption in der NS-Zeit ist, zeigte sich unlängst bei einer Tagung in Ljubljana, als ich die Frage erörtert habe, ob Grodek auch in der NS-Zeit als Antikriegsgedicht rezipiert worden ist.12
Dass sich die Forschung bisher nicht gründlicher mit der Rezeption Trakls im Nationalsozialismus beschäftigt hat, ist erstaunlich. Wären doch von einer Untersuchung dieses Themas nicht nur Erweiterungen des Bilds von der Rezeption eines der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker, sondern auch Aufschlüsse über den Umgang eines totalitären Staates (bzw. der Gesellschaft in einem solchen Staat) mit einem unpolitischen Autor und dessen Werk zu erwarten. Da Trakl auch in der NS-Zeit im Allgemeinen zu den Expressionisten gerechnet wurde und sein – von herkömmlichen Sprachstrukturen sich lösendes – Werk als modern galt, müsste eine solche Untersuchung auch die Rezeption der literarischen Moderne bzw. des Expressionismus berücksichtigen. Voraussetzung dafür sind freilich eine möglichst lückenlose Ermittlung und genaue Sichtung der zeitgenössischen Rezeptionszeugnisse. Walter Ritzers Trakl-Bibliographie13 ist dabei nur eine geringe Hilfe; sie ist vor allem im Nachweis von Abdrucken von Gedichten Trakls in Anthologien und Zeitungen sowie von Stellungnahmen zu Trakl in Literaturgeschichten höchst unvollständig; außerdem sind Äußerungen zu Trakl in Briefen und Tagebüchern von Autoren ausgeklammert.
![]()
Einleitung
Schon bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten vom 30. Jänner 1933 initiierte die Deutsche Studentenschaft die Aktion Wider den undeutschen Geist, die in Zusammenarbeit mit dem NS-Studentenbund und mit finanzieller Unterstützung von Joseph Goebbels’ Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda durchgeführt,14 aber auch von breiten Kreisen des antimodernen Bürgertums getragen wurde.15 Bei der Bücherverbrennung, in der diese Aktion gipfelte, wurde jenes als „jüdisch“, „kunstbolschewistisch“ oder „Schmutz und Schund“ bezeichnete Schrifttum, das laut der „Schwarzen Liste“ Wolfgang Herrmanns der „geistigen Wehrhaftmachung“ und „totalen Mobilmachung des deutschen Menschen“ im Wege stand,16 gebrandmarkt. Unter Schöner Literatur kamen neben den „artfeindlichen“ Schriften auch jene Werke auf den Index, die – wie es hieß – im Geist „des bürgerlich-dekadenten Subjektivismus volkstumsfremder und landschaftsferner großstädtischer Literaten“ verfasst worden sind und „in ihrer Wirkung dahin führen, daß volksbegründende und volksgestaltende Einrichtungen und Werte als Bagatellen behandelt, ironisiert und verfälscht werden“.17 – Als dies geschah, stand wohl außer Streit, dass die Lyrik Trakls nicht darunter fiel; andererseits konnte man sie nicht gut für die ‚geistige Wehrhaftmachung‘ reklamieren oder vom ‚dekadenten Subjektivismus‘ freisprechen.
Hans Naumann, renommierter Germanistik-Professor an der Universität Bonn, erklärte bei seiner Ansprache zur Bücherverbrennung auf dem Bonner Marktplatz am 10. Mai 1933, die Studenten verbrennten das, was sie bedrohe, verwirre und verführe; das Fremde werde impulsiv abgeschüttelt. Mit dem zum ‚Schutz der Öffentlichkeit‘ verbrannten Schrifttum sollte sich allenfalls die Wissenschaft befassen, um es mit ihren Mitteln zu entwaffnen. Deutsche Kunst komme hingegen aus irrationalen Gründen: Erwünscht sei ein Schrifttum, dem „Familie und Heimat, Volk und Blut“ heilig sind, das „uns zum sozialen Gefühl und zum Gemeinschaftsleben erzieht, sei es in der Sippe, sei es im Beruf, sei es in der Gefolgschaft oder in Stamm und Nation“, das uns „zum Führertum und zur Wehrhaftigkeit“ erzieht, ein „im besten und edelsten Sinne politisches“ Schrifttum, mit Vorbildern wie Friedrich Hölderlin, dem „lebendigen Gewissen unserer Nation“.18
Das Urteil des Germanisten Max Kommerell, keiner der Dichter und Wortführer der Zeit habe dem Deutschen „ein so ungeheures Anrecht auf Macht, ein solches Gefühl ausschließenden Wertes und Ranges verleihen können“ wie Hölderlin,19 diente in der NS-Zeit quasi als Gütesiegel. In seiner nordisch-völkischen Mythologie bezeichnet Alfred Rosenberg, ‚Chefideologe‘ des NS-Regimes, Hölderlin als „größten Sänger unter den Deutschen und zartesten Künder ihrer Seele“ und preist ihn für das „aesthetisch-willenhafte Sehnsuchtselement seines Schaffens“.20 Hölderlin und andere Größen der bürgerlichen Literaturtradition wurden zu den wahren Ahnen der NS-Literatur erklärt, was vor allem darauf zurückzuführen sein dürfte, dass es den NS-Kulturpolitikern und -Germanisten nicht gelungen ist, für die NS-Literatur eine genuine Vorgeschichte zu entwerfen.21 Mit Kriegsbeginn wurde Hölderlin „zur nationalen Erlöserfigur schlechthin“, der Sänger der Griechen wurde zum „Verkünder einer vaterländischen Sendung der Deutschen“ umgedeutet.22 (Kommerell hat diese Inszenierung übrigens als Missbrauch kritisiert, freilich nur im privaten Kreis.)23 Dass Hölderlin zu „der Sinnfigur für den heroischen Untergang“ wurde, ist allerdings nicht nur auf die Entwicklung des Kriegs zurückzuführen; die innerhalb wie außerhalb der Germanisten-Zunft gesteigerte Resonanz dieser Sinnfigur ist „das Resultat eines Inszenierungskomplexes, in dem sich politische, disziplinäre und bildungsbürgerliche sowie ökonomische Motivationslagen vermischen, einander wechselseitig bestärken und so Popularisierungseffekte erzeugen“.24
Als die Kriegsverluste immer größer wurden und die Niederlage des Dritten Reichs absehbar war, im „schicksalsreichen Hölderlin-Gedenkjahr“ 1943 anlässlich seines 100. Todestags, rief Heinz Kindermann, Ordinarius für Theaterwissenschaft an der Universität Wien, mit Hölderlin zum Kampf auf: rings um uns tose das Chaos, eine „neue Rangordnung der Werte“ müsse gegen die „Gewalten des Untergangs“ erkämpft werden; in „diesem Ringen auf Tod und Leben“, in einer Zeit, „da jeder sein letztes geben muß, um das Kostbarste zu retten“, möge uns Hölderlin beistehen.25 Bei der Hölderlin-Reichsfeier in Tübingen erklärte der Leiter des Hauptkulturamtes der NSDAP, Hölderlin werde gefeiert, „weil er der gute Kamerad unserer Männer ist, die im Kampfe für Deutschland stehen“.26 Den Gedichten Hölderlins wurde offenbar eine mentale Wirkung unter den Soldaten zugetraut, wie etliche Hölderlin-Ausgaben von 1943 belegen: ein Bändchen in der Reihe Feldpost bei Böhlau, eine Auswahl für Soldaten mit dem Titel Heldentum bei Walter, eine Frontbuchhandelsausgabe bei Langewiesche-Brandt und eine Feldauswahl bei Cotta.27
Seit je wurde Trakl in Zeitungsartikeln mit Hölderlin verglichen, doch was hatte er mit der deutschen Nation zu tun? Das wird auch in einem Artikel eines NSDAP-Organs angesprochen: Hölderlin und Trakl hätten aus der gleichen Gefühlssphäre geschöpft, aber bei Hölderlin sei noch der Jubel der nationalen Idee ertönt.28 Und doch gibt es Parallelen im Image der beiden Dichter, wie sich in den großen Hölderlin-Ausgaben des Jahres 1943 zeigt. Die neugegründete Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe erschien mit einem Geleitwort des Württembergischen Ministerpräsidenten und Kultministers, in dem es heißt, Hölderlins edler Geist „schaute mit seherischem Blick das deutsche Schicksal“, wie es sich nun „im schwersten Ringen unseres Volkes“ um die Zukunft des Vaterlands offenbare.29 Friedrich Seebaß, (Mit-)Herausgeber der Neuauflage Sämtlicher Werke Hölderlins, bekundete im Vorwort seine Verbundenheit mit Norbert v. Hellingrath, dem im Ersten Weltkrieg gefallenen ersten Herausgeber, und mit allen Blüten der neuen Jugend, die im neuen Krieg ebenfalls „der Erde zu Danke fielen“30 – was durch die Wahl eines Zitats aus Hölderlins Gedicht Mein Eigentum zwar ein Ignorieren des opferungswürdigen ‚Volks‘ bzw. ‚Vaterlands‘, aber doch ein Andeuten von Opferbereitschaft darstellt. Beides, das Seherische wie die Opferbereitschaft, wurde in der NS-Publizistik auch Trakl zugeschrieben.
Seit je wurde in Zeitungsartikeln als ein zentrales Thema von Trakls Dichtung der Verfall erkannt. Doch zählte sie deswegen gleich zur „artfremden“ Literatur, in der der „Geist des Verfalls und der Zersetzung“ lebe31 – wie Hans Friedrich Blunck, Präsident der Reichsschrifttumskammer, deren Unterdrückung im Dritten Reich vor dem Ausland zu rechtfertigen versuchte? Und musste Verfallsdichtung mit ‚Dekadenz‘ gleichgesetzt werden, konnte sie nicht auch als Klage über den Niedergang verstanden oder als Zeugnis für Todesgewissheit gewürdigt werden? Wer in literarischen Texten Hinweise auf die ‚rassische‘ oder geographische Herkunft des Autors suchte, konnte ...