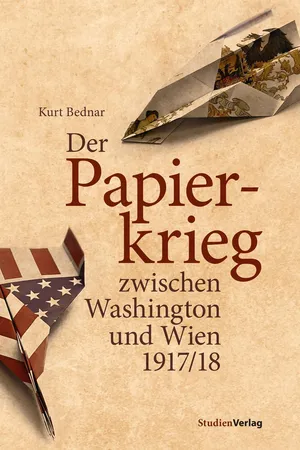![]()
1. Albert H. Putney, Ankläger
Knapp fünf Monate nach der Kriegserklärung der USA (7. Dezember 1917) an Österreich-Ungarn, am 9. Mai 1918, lag US-Außenminister Robert Lansing ein umfangreiches Dossier seines Mitarbeiters Albert H. Putney, des Leiters der kleinen Nahost-Abteilung, damals auch für Osteuropa zuständig, vor: „Slavs in Austria-Hungary“. Das State Department sah zur Zeit Putneys ganz anders aus als heute, verfügte nur über einen „winzigen Apparat“. Zwar verloren sich nicht mehr nur 22 Personen wie im Jahr 1850 im Amt, doch auch 50 Jahre später verdienten nicht mehr als 91 Mitarbeiter dort ihr Brot. Die Chefs in der Zentrale befehligten Mitte des 19. Jahrhunderts gerade 218 Personen draußen in den Gesandtschaften und Konsulaten (erst 1892 raffte man sich zu den ersten Botschaftern auf), 1900 auch erst 1137 Leute8. Immerhin betrug der Faktor für den Außendienst damit fünf, gegenüber der Zentrale mit bloß einer Vervierfachung der personellen Kräfte.
Bis Mai 1918 galt Punkt zehn Wilsons9, der den Völkern der Monarchie Autonomie zugestanden hätte. Im April in Rom hatten sich freilich Vertreter der von Wien „unterdrückten“ Völker zu einer Konferenz versammelt, an der auch der amerikanische Reporter Nelson Gay als Beobachter teilnahm. Offiziellen Auftrag der USA hatte er nicht, was die Slawen heftig bedauerten, aber allein die Anwesenheit half die Stimmung zu heben, so ein Bericht der amerikanischen Militärmission in Rom10. US-Botschafter Page schrieb am 9. April an Lansing11, Gay, der einzige Amerikaner, hätte ihm versichert, er hätte kein Mandat und keine Anweisungen aus Washington. Im Übrigen bemerkenswert: „Many of the delegations self-apppointed“; mit den vielen Arten von Slawen kämpfte auch Page, denn in seiner Aufzählung der Teilnehmer reihten sich „Czechs, Slavs, … Poles, Jugo-Slavs …“ aneinander.
Auf 236 Blatt Papier verbreitete sich nun der Diplomat Putney auf recht undiplomatische Art über die kolportierten Missetaten der Regierung in Wien gegenüber den slawischen Untertanen der Habsburger. Dieses Memorandum formte die Basis, mit der Lansing seinen Präsidenten unter Zugzwang setzen konnte und dessen Meinung über die Monarchie und deren Erhalt schließlich umdrehte. Hier fasste Putney nochmals alle Argumente, die ihm seitens der Slawen (in Amerika und anderswo) zugetragen worden waren, zusammen. Dieses – man kann es nicht anders bezeichnen – Machwerk bildete das Fundament für die Frage Lansings an Wilson (samt Empfehlung) vom 29. Mai: „In brief, should we or should we not favor the disintegration of the Austro-Hungarian Empire into its component parts and union of these parts, or certain of them, based upon self-determination?“12 Dabei hatte Putney gar nicht mehr so sehr die nationale Befindlichkeit der Slawen im Visier denn den Willen nach Wegen zu suchen, um den Krieg – gegen Deutschland insbesondere – zu gewinnen, Befreiung der Slawen als „war measure“, ein simples Werkzeug also13.
Putneys Text, der in der Historiographie wenig gewürdigt wurde, stach einerseits hervor, nicht nur, weil er vom Außenamt kam, sondern auch weil er den Eindruck einer Zusammenfassung erweckte, andererseits fügte sich schon der formale Aufbau in die Reihe der Ausarbeitungen in der geheimen „Inquiry“ ein. Mitte 1917 hatte Wilson seinen Vertrauten Colonel House gebeten eine Gruppe einzurichten, die Information sammeln sollte, um für die späteren Verhandlungen gewappnet zu sein. Offen muss die Frage bleiben, inwieweit Putney über die Dossiers der „Inquiry“ informiert war. Insgesamt verfügte die Mannschaft Lansings nicht über die Ressourcen, was mit ein Grund für die Einrichtung der „Inquiry“ war. Die Vermutung klingt plausibel, Putney hätte allein im Auftrag Lansings gehandelt, weniger aus Missgunst gegenüber der „Inquiry“ von House, sondern weil der Außenminister den zögerlichen Wilson endlich auf seine antiösterreichische Seite drängen wollte.
Über das Verhältnis zwischen Wilson, Lansing und House wurde viel gemutmaßt. Wie funktionierte die quasi amtliche Zusammenarbeit zwischen Lansings State Department und House’s „Inquiry“? Civitello14 kam zum Schluss, Lansing hätte sich dem Wunsch Wilsons gefügt und wäre in der Folge den Anforderungen, die von der „Inquiry“ an sein Amt gestellt wurden, nachgekommen. Über die interne Besprechung im Juli 1918 zwischen den Mitarbeitern Carr, Phillips und Woolsey einerseits und ihrem Chef Lansing andererseits liegen einander widersprechende Notizen vor: Lansing lehnte eine noch engere Zusammenarbeit mit der „Inquiry“ ab, obwohl eine solche von Phillips sogar ausdrücklich gewünscht wurde („to benefit from its wonderful maps15“). Doch Carr schrieb in sein Tagebuch16, er und seine Kollegen im Außenamt hätten das Gefühl gehabt, dieses „should have the House organization“. Formal war dies ohnehin der Fall, weil die Experten der „Inquiry“ über das Außenamt selektiert, (geheimdienstlich) überprüft, angeheuert und auch abgerechnet wurden. Civitello stützte sich hier auf „den“ „Inquiry“-Autor Gelfand17 mit der Feststellung, zuletzt wäre ein Drittel der Berichte der „Inquiry“ von Leuten des Außenamts erstellt worden. Andererseits zitierte Civitello den „Inquiry“-Autor Clive Day, wonach das Außenamt nach anfänglichem Misstrauen Rat und Daten zur Verfügung gestellt hätte und „was accepted as part of the organization“18. Lansing versuchte aber schon früher, die „Inquiry“ auf eher exotische Gegenden und Themen wie Indien oder Lateinamerika umzulenken, entweder, weil er sich davon weitere Information erhoffte (die er mit eigenen Ressourcen nicht beschaffen hätte können) oder weil er doch ablenken und eine Einmischung in ihm wichtig erschienene Fragen auszuschließen versuchte. Was bei all dem nur überraschen musste, war das Fehlen des Namens Putney. Er kam in der umfassenden Arbeit von Civitello überhaupt nicht vor.
Texte über und von Putney
Über Albert H. Putney finden sich herzlich wenige Informationen. Die Zeitung „The Broad Ax“ in Chicago würdigte ihn in ihrer Ausgabe vom 30. Juni 191719: Putney, einige Jahre Dekan des Illinois College of Law, wäre seit drei Jahren Leiter der Nahost-Abteilung im Außenministerium und machte darin eine gute Figur. Die kleine Notiz erinnerte auch an seine Abhandlung über die Philippinen, die er aus Anlass seines Aufenthaltes dort im Jahr 1901 verfertigt hatte. „The Evening Star“ vom 7. Jänner 191820 berichtete auf der „Society“-Seite über einen Empfang, den das State Department für Dr. Vesnitch (!) und die gesamte Serbische Mission in Mount Vernon gab. Daran nahm auch das Ehepaar Putney teil, erwähnt an letzter Stelle (nicht alphabetisch gereiht).
Offizielle Hinweise zur Arbeit Putneys versteckten sich in Korrespondenzen Dritter oder in der Beschaffung von Dokumenten für die eigentlichen Leistungsträger der „Inquiry“. So übermittelte der Beamte im Außenamt an Kerner in der „Inquiry“ (über dessen Ersuchen) am 10. September 1918 („Inquiry“ Document 332) eine Kopie mit dem langen Titel „A Note submitted to the Check’s National Soviet and the Slavenian League for the Liberation of Carpatho-Russia and the Board of the Carpatho-Russian National Soviet of America”21. Blieb zu hoffen, dass die „Checks“ und die „Slavenian“ zumindest im Original richtig geschrieben worden waren.
Ein geringfügiger Hinweis auf Putney fand sich in einem Schreiben des Senators James Hamilton Lewis vom 6. Juni 1918 an Außenminister Lansing22. Der demokratische Senator aus Illinois, zweimal erfolgloser Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, ersuchte Lansing um die Hilfe von dessen Mitarbeiter Putney. Er wollte lediglich Kopien der Elaborate Putneys, somit keine extra Arbeiten. Lewis dachte sich das als späte Belohnung dafür, dass er seinerseits Putney beim Zusammentragen von Informationen geholfen hatte. Die (Jugo-)Slawen stellten in Illinois und Umgebung eine starke Wählergruppe, deshalb engagierte er sich bei diesem Thema. Nun arbeitete Lewis an einem Buch (das aber offenbar nie zustande kam, zumindest fehlt ein Eintrag in der Kongressbibliothek), an dem er nichts verdienen, das er aber als politische Werbung unter den slawischen Wählern verwenden wollte. Naturgemäß würde er politisch nicht von Lansings Meinungen abweichen, so die Versicherung Lewis’.
Die Fachliteratur nahm nur selten Notiz von Putney. Eine der wenigen Ausnahmen bildete Biskupski, der selbst auf eine andere – Mamatey – verwies. Für den polnischen Historiker23 war es natürlich schmerzlich, dass „Lansing’s special adviser on Slavic and Eastern European questions24“ nicht nur Ostgalizien, sondern auch den westlichen Teil der österreichischen Provinz den Ruthenen (sprich Ukrainern) zusprechen wollte. Daraufhin bezeichnete Biskupski „Putney’s interpretations of Polish history … bizarre“25. Immerhin billigte Putney den Polen einen Zugang zum Meer zu, wenngleich die Begründung nicht überzeugen konnte: „… a race numbering as many millions as the Poles are clearly entitled to some outlet to the sea“26. Ein Aufschrei Biskupskis galt einem Memo Lansings an Wilson vom 21. September 1918, in dem der Außenminister unter 29 Punkten zwei davon Polen widmete27: Nach Punkt vier sollten die drei Teile, die seit rund 140 Jahren bei Österreich, Preußen und Russland waren, wieder zusammenfinden; Punkt sechs reduzierte dieses Gebiet um jene Gegenden, die hauptsächlich von Ruthenen bevölkert wurden. Der Historiker führte diese Textierung Lansings auf den Einfluss seines Mitarbeiters Putney zurück. Der slowakische Historiker Mamatey28, der Putney auf internationale Finanzfragen reduzierte, ordnete dessen serbische Kontakte anders ein – nicht Vesnic (Vesnitch), sondern Mihajlovic (früherer Geschäftsträger in Rom, jetzt Vertreter seines Landes in Washington) und rückte die ruthenische Angelegenheit etwas zurecht: Putney wollte den Ukrainern zwar die von ihnen bewohnten Gebiete in Galizien überlassen, lehnte aber eine unabhängige Ukraine als österreichische Erfindung ab und sah das Land weiter mit Russland verbunden, für den Polen Biskupski möglicherweise eine noch ärgere Bedrohung.
Devasias Rumänien-Studie29 spürte Putney im Mai/Juni 1917 und im Juli 1918 auf. Mit Datum 26. Mai 191730 unterbreitete Putney seinem Chef das Memorandum „Nationalistic Aspirations in the Near East“, worin er sich mit rumänischen Gebietswünschen befasste. Am 5. Juni ließ Putney dem Memo eine Ergänzung folgen, aus der das Dilemma deutlich hervorging, in dem man sich befand, denn einerseits gehörten Bessarabien und Transsylvanien ethnisch zu einem größeren Rumänien, andererseits sprächen politische und wirtschaftliche Gründe dagegen. Das Supplement besprach in sechs weiteren Abschnitten31 Fragen von Jugo-Slawien bis Persien (Putney war für den „Nahen Osten“ zuständig). Das Papier identifizierte im südslawischen Streit mit Habsburg den wahren Kern des Weltkrieges, weshalb man diesem Zwist die größte Aufmerksamkeit schenken müsste, um künftig Frieden zu haben. Interessanterweise beließ Putney hier die Slowenen bei Österreich, zu dem deren Bindungen zu langanhaltend und zu stark wären, als dass sie dem neuen Jugo-Slawien zugeschlagen werden sollten, von dem sie sich auch sprachlich unterschieden. Während Triest und Istrien Italien gehörten, sollte (das an sich ungarische) Fiume zu Österreich kommen, um dem Land seinen Meerzugang zu erhalten (!). Mamatey erwähnte Putneys großes Memo vom 9. Mai 1918 eher kursorisch32, ließ hinter der offiziellen Erklärung Lansings vom 29. Mai 1918 eher den Beamten Phillips als Minister Lansing stehen und auch zur Vorbereitung der nächsten (28. Juni) nicht nur den regional zuständigen Putney zu sich rufen, sondern auch Phillips, der in diese heikle (tschechische) Angelegenheit viel intensiver eingeschaltet zu werden schien. Hierzu lieferte nun Putney ein weiteres Memo ab, das in den drei Behauptungen gipfelte, als Wahlmonarchie wäre Böhmen ein unabhängiger Staat, die gegenwärtige Regierung dort verfassungswidrig (!) und mangels einer rechtmäßigen der Nationalrat in Paris für eine solche geeignet33. Ende August überrumpelte ihn Masaryk, indem er nochmals seine Argumente für eine unabhängige Tschechoslowakei zusammenfasste und sich dabei auf das böhmische Staatsrecht berief, und zwar auch bezüglich der Slowakei, was Putney als unrichtig hätte auffallen müssen, monierte Mamatey nicht zu Unrecht, auch wenn er ihn in einer Fußnote etwas entlastete, Masaryk hätte den Anspruch auf die Slowakei „presumably“ mit dem mährischen Großreich im 9. Jahrhundert begründet34. Auch die in der letzten Erwähnung seines Namens in Mamateys Schrift gefundene Rolle von Putney (hier wieder gemeinsam mit Phillips) als „father-confessors“ für die „representatives of the Austrian nationalities in Washington“35 sollte einerseits nicht überbewertet werden, warf jedoch andererseits einen starken Schatten auf die für seine Funktion eigentlich nötig gewesene Überparteilichkeit. Drei Tage nach dem erwähnten Supplement beauftragte Lansing Putney mit weiteren Studien zu gerechten Grenzen „along nationalistic lines“, was wie Punkt neun Wilsons (zu Italien) klang. Das gerade erstellte und ergänzte Papier legte Lansing – so Devasia – Wilson nicht vor, der gerade daran arbeitete, Österreich von Deutschland weg und zu einem Sonderfrieden zu bewegen, gegen Gewähr, sein Territorium möglichst ungeschmälert behalten zu dürfen. Ein solcher Zeitpunkt wäre daher für ein Programm, das der Monarchie Gebiete wegnahm, ungeeignet.
Für Adams36 umfasste das Memo Putneys vom Mai 1917 auch die Möglichkeit, nationale Unruhen in Österreich für eigene Zwecke auszunützen und die Empfehlung, aus der Erbmasse der Monarchie unabhängige Staaten zu schaffen („Yugoslav, Polish and Bohemian states“). Glidden37 erwähnte ein weiteres Memo aus der Werkstatt Putneys, erstellt im Dezember 1917, offensichtlich aus Anlass der Kriegserklärung Washingtons an Wien. Ausgehend von der Frage des Status der Einwanderer aus der Doppelmonarchie fand Putney zu aufschlussreichen Kategorisierungen: Ungarn und „true Austrians (i. e., Germans)“ stufte er als „enemy aliens in every sense of the term“ ein; Juden teilten ihre Sympathien; uneingeschränkt hassten die Tschechen und Rumänen Österreich, bei den Jugoslawen wäre das ähnlich bis auf ein paar Kroaten, die freilich von Berlin und Wien bezahlt würden; zehn Prozent der Polen klassifizierte das Memorandum als deutschfreundlich, und die Ukrainer wären „difficult to analyze“. Von Bell38 war zu Putney Biographisches zu erfahren (aus Boston, Dekan der University of Illinois, Rechtsanwalt in Boston und Chicago). Die Auslandserfahrung Putneys beschränkte sich auf ein Jahr im Dienst der US-Verwaltung der Philippinen. Die Aufmerksamkeit von Borgeson39 galt den guten Kontakten des Nationalrates der Tschechen in den USA zu Politikern und Beamten der Administration, zu denen eben auch Putney zählte.
Literarisch engagierte sich Putney bei (völker-)rechtlichen und politischen Fragen. Aus 1915 stammten Kommentare zu Gerichtsentscheidungen im Seerecht, aus 1916 eine Stellungnahme zur damals in den USA brennenden Frage der Neutralität, noch 1926 weigerte er sich, an eine Schuld Serbiens zu glauben, und 1927 beschäftigte sich Putney mit der Auflösung ungleicher Verträge40. Gegenstand der Arbeit aus 191541 war das Prisenrecht, also was mit aufgebrachten Schiffen rechtlich zu geschehen hatte. Heikler war dann die Darstellung zur Neutralität42, wo Putney zunächst angeblich verschiedene Formen unterschied, er selbst jedoch an deren Absolutheit festhielt, somit Varianten wie „qualifizierte“, „gutwillige“ oder „bewaffnete“ Neutralität ablehnte. Putney schloss sich der in Amerika herrschenden Meinung an, der Neutrale hätte sich weiter so zu verhalten, wie er es bei Ausbruch eines Konfliktes gehandhabt hätte. Zusammenfassend verlangte der Autor drei Grundsätze im Verhalten des Neutralen gegenüber den kriegführenden Mächten: Wo immer das Völkerrecht bereits eine Regel aufgestellt hätte, wäre sie zu befolgen, unabhängig davon, wie sich dies auf die Kampfhähne auswirkte. Zweitens maß man den Neutralen daran, wie er sich selbst bisher in vergleichbar gelagerten (Präzedenz-)Fällen verhalten hätte. Es ging Putney somit um Berechenbarkeit. Drittens aber wäre der neutrale Staat nur dort zu handeln frei, wo weder aner...