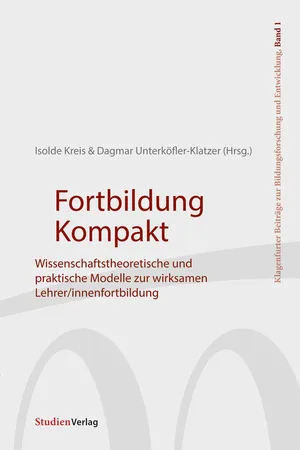![]() Theoretische Zugänge – Beispiele wirksamer und nachhaltiger Lehrer/innenfortbildung
Theoretische Zugänge – Beispiele wirksamer und nachhaltiger Lehrer/innenfortbildung![]()
Willibald Erlacher & Isolde Kreis
Der Lehrberuf – eine Profession!
Es gibt einen Boom von Büchern zur pädagogischen Professionalität, schreibt Lempert 1998. Die Anzahl der Publikationen hat nach dem Erscheinen des Sammelbandes zum Thema „Pädagogische Professionalität in Organisationen. Neue Verhältnisbestimmungen am Beispiel der Schule“ von Helsper, Busse, Hummrich & Kramer (2008) an Fülle abgenommen, dennoch gibt es nach wie vor ein anhaltendes Interesse, das als Indikator dafür gelten kann, dass die Professionsdiskussion zum Lehrberuf und damit die Frage, was eigentlich die Profession des Lehrberufs charakterisiert, noch nicht abgeschlossen sind.
Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der Thematik und Fragestellung (Helsper et al., 2008). Die Erziehungswissenschaften haben sich bis in die 1990er Jahre an Konzepten althergebrachter, anerkannter Professionen der Ärzt/innen, Jurist/innen und Kleriker orientiert. Die drei am meisten zitierten Theorienkonzepte in diesem Kontext sind der merkmalsorientierte Ansatz, der strukturfunktionalistische Ansatz und der strukturtheoretische Ansatz. Sie stellen eine historisch-chronologische Abfolge in der Auseinandersetzung mit Professionen in der wissenschaftlichen Literatur anhand bestehender Konzepte dar. In diesem Theoriediskurs wurde der Lehrberuf sehr lange als „Semiprofession“ charakterisiert (Ilien, 2008).
Dewe und Wagner (2006) beantworten die Frage, ob der Lehrberuf eine Profession sei oder nicht, mittlerweile mit einem eindeutigen Ja. Dieser Ansicht ist auch Tenorth (2006), der die Bezeichnung der Profession für den Lehrberuf für angemessen hält. Bauer, Kopka und Brindt (1996) meinen dazu, dass der Lehrberuf genau wie der Beruf der Jurist/innen oder Ärzt/innen alle Merkmale einer Profession aufweist. Laut Gehrmann (2003, S. 457) ist „der Professionalisierungsprozess heute letztlich abgeschlossen“, indem er argumentiert, dass der Lehrberuf seinen eigenen Stand hat, wissenschaftlich ausgebildet ist und eine Gemeinwohlorientierung vorherrscht.
Neben der erziehungswissenschaftlichen Debatte wird die Diskussion geprägt von einer soziologischen und psychologischen Auseinandersetzung (Alisch, 1990; Dewe, Ferchhoff & Radtke, 1992; Combe & Helsper, 1999; Oevermann, 1999), die nach Gehrmann (2003) und Ilien (2008) von wenigen Längsschnittstudien und kaum historisch aufeinander bezogenen Betrachtungsweisen gekennzeichnet ist.
Bis heute hat sich trotz zahlreicher Versuche der genannten Autor/innen in keiner der wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit der Lehrer/innenprofession auseinandersetzen, ein allgemeingültiges Professionalisierungskonzept etabliert, auch wenn Gehrmann betont, dass die Diskussion zur Lehrer/innenprofessionsfrage inzwischen abgeschlossen ist. Damit wird eine Vielschichtigkeit des Themas sichtbar, die sich in den unterschiedlichsten Verwendungen der Begrifflichkeiten (Nittel & Seltrecht, 2008; Kreis, 2009) und der Mehrdimensionalität des Themas (Brüsemeister & Eubel, 2003; Altrichter et al., 2007) ausdrückt, die im Folgenden aufgezeigt werden.
Begrifflichkeiten im Professionsdiskurs
Die Vielschichtigkeit des Themas spiegelt sich auch in der Verwendung der in diesem Zusammenhang benutzten Begriffe wider, insofern als es in der einschlägigen Literatur keine einheitliche Sprachregelung gibt. Professionalität, Professionalitätsentwicklung und Professionalisierung werden in den wissenschaftlichen Publikationen unterschiedlich verwendet und interpretiert. Diese sprachlichen Ungenauigkeiten der Begriffe tragen zu Missverständnissen und Unklarheiten bei (Kreis, 2009).
Nittel (2000) bezeichnet mit Professionalisierung den Prozess, in dem Berufe die Eigenschaften, Privilegien und Ausbildungsvoraussetzungen erlangen, die für traditionelle Professionen maßgebend sind. Die Aufwertung eines bereits existierenden Berufes in Anlehnung an die Attribute der bereits etablierten Professionen der Ärzt/innen, Jurist/innen und Kleriker wird dabei vollzogen.
Professionalitätsentwicklung hingegen wird nach Terhart (1991) für den Prozess verwendet durch den ein Praktiker/eine Praktikerin die für eine effektive professionelle Praxis notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt oder verbessert. Dabei ist die professionelle Entwicklung ein individueller Prozess, in enger Verschränkung mit dem kollektiven Prozess der Professionalisierung (Nittel & Seltrecht, 2008). In der Literatur wird das Wort Professionalitätsentwicklung seltener verwendet, die Professionalisierung an sich drückt dabei meist ebenfalls die Professionalitätsentwicklung einzelner Personen aus (Bauer, 2005).
Professionalität hingegen wird nach Nittel (2000) als gekonnte Beruflichkeit und als Indikator für qualitativ hochwertige Arbeit von Personen, so genannten Professionellen, verwendet, eng verbunden mit dem Individuum und seiner Handlungskompetenz im beruflichen Alltag. Demnach kann Professionalität als ein spezifischer Modus im Vollzug des Berufshandelns definiert werden, der „Rückschlüsse sowohl auf die Qualität der personenbezogenen Dienstleistung als auch auf die Kompetenz des beruflichen Rollenträgers erlaubt.“ (ebd., S. 71)
Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit dem Thema in der einschlägigen Literatur liegt einerseits auf der mehrdimensionalen Ebene, andererseits bei der individuellen Betrachtung. Die definierten Kompetenzen, die Lehrer/innen für ihre Professionalität haben müssen, werden dabei als Voraussetzung für ein professionelles Handeln betrachtet, damit die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Lehrer/innentätigkeit erhöht wird. Basiskompetenzen und Handlungsrepertoires werden von Seiten der Erziehungswissenschaften definiert, klassifiziert und benannt sowie die bildungspolitische und gesellschaftliche Funktion von Schule und Bildung thematisiert, weiterentwickelt und erforscht (Bauer, 2005).
Ausgehend von einer klaren sprachlichen Regelung (Nittel, 2000; Nittel & Seltrecht, 2008; Kreis, 2009) ist es in der Auseinandersetzung mit Professionen von Bedeutung, unterschiedliche Ebenen der Profession zu berücksichtigen. Der Ansatz dazu ist der „Mehrebenen-Ansatz“, der die Mehrdimensionalität in der Professionsdiskussion berücksichtigt.
Mehrdimensionalität in der Professionsdiskussion
Im Zuge des Mehrebenen-Ansatzes werden Mehrebenen-Modelle, wie zum Beispiel bei Brüsemeister und Eubel (2003) und im Ansatz des „Educational Governance“ nach Altrichter et al. (2007), aufgestellt: Brüsemeister und Eubel (2003) sprechen bei einer Modernisierung von Schule drei Ebenen an, benennen und charakterisieren sie. Die Mikroebene bezieht sich dabei auf das Rollenhandeln von Lehrkräften sowie von anderen Akteur/innen der Einzelschule. Die Mesoebene, die zweite Ebene des Modells, bezieht sich auf die Ebene der Einzelschule als Ganzes, die operative Agenden bei Personal-, Organisations- und Unterrichtsentscheidungen erhalten soll und damit für die eigene Unterrichts- und Schulentwicklung Verantwortung zu übernehmen habe. Die Makroebene, die dritte Ebene, bezieht sich bei den angeführten Autoren auf das schulische Gesamtsystem, in einer engen Beziehung von Schulsystem, Staat und Gesellschaft. Der Staat engagiert sich dabei mit strategischen Zielsetzungen und Unterstützungen.
„Educational Governance“ ist ein Steuerungsmodell, das nach Altrichter, Brüsemeister und Wissinger (2007, S. 10) „eine umfassende Beschreibung und Analyse von Steuerungs- und Umstrukturierungsfragen im Bildungswesen […] in einem Mehrebenensystem analysiert.“
Anhand der drei Strukturebenen Mikro-, Meso- und Makroebene und ihren Übergängen, die „grenzüberschreitend verflochten [sind]“ (Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 32), wird das Bildungssystem in seinen unterschiedlichen Koordinationsformen erforscht und bietet in der Forschung nach Altrichter „eine umfassendere, interdisziplinäre Behandlung von aktuellen Fragen der Steuerung und Umstrukturierung des Bildungswesens […].“ (Altrichter et al., 2007, S. 11) Ziel der Forschung sei es, die empirische Bildungsforschung in einer starken Interdependenz darauf auszurichten, dass Leistungen von zahlreichen Akteur/innen auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Die Mikroebene wird dabei als eine Leistungsproduktion von Individuen und Gruppen festgelegt, die Mesoebene thematisiert organisatorische und interorganisatorische Strukturen und die Makroebene bildet das gesellschaftliche Subsystem ab (Altrichter & Heinrich, 2007).
Die Trennung in Ebenen lässt eine Verringerung der Komplexität in der Auseinandersetzung mit dem Thema zu und verdeutlicht gleichzeitig die starke Wechselwirkung zwischen klar definierten Ebenen.
Die Bedeutung der Lehrer/innenfortbildung für die Profession
Während vor einigen Jahrzehnten der Fokus der Forschung noch auf der Ausbildung der Lehrkräfte lag, gewinnt seit den letzten drei Jahrzehnten die Lehrer/innenfortbildung vermehrt an Bedeutung (Zehetmeier, 2008; Müller et al., 2010). Neuere Ergebnisse belegen aber, dass über die Wirkung von Fortbildung in der Lehrer/innenbildung noch zu wenige empirische Erkenntnisse vorliegen (Müller et. al., 2010; Lipowksy, 2004, 2010).
Die Lehrer/innenfortbildung ist eine Form berufsbezogener Erwachsenenbildung, bei der es um den Erhalt und die Weiterentwicklung professioneller Qualifikationen, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen für die Tätigkeit als Lehrer/innen (vgl. die Mikroebene) an der Schule geht. Dabei sind zumindest zwei Handlungsebenen angesprochen, und zwar einerseits Lehrende als Personen und Subjekte von Fortbildungsprozessen und andererseits Lehrende und deren Schulund Unterrichtspraxis in der Organisation Schule (vgl. die Mesoebene). Eine qualifizierte Fortbildung von Fortbildungsanbietern (auf der Makroebene angesiedelt) soll drittens helfen, Lehrer/innen in die Lage zu versetzen, sich zukünftigen gesellschaftlichen Anforderungen zu stellen und Innovationsbereitschaft zu entwickeln (Wilding, 2001).
Im Anschluss an das Studium wird die als lebenslanger Prozess gesehene Professionalitätsentwicklung fortgeführt und der Übergang in eine routinierte Berufstätigkeit begleitet. Die Aufgabe professioneller Lehrer/innen auf individueller Ebene wäre hier, geeignete Fortbildungsangebote zu nutzen und damit den Anschluss an wissenschaftliche, ökonomische und technologische Entwicklungen in der Berufswelt zu halten. Die zeitgemäße Erfüllung dieser Anforderung an die eigene Lehrtätigkeit würde dabei das Berufsethos und das Ansehen der Lehrerschaft in der Öffentlichkeit prägen. Nach Meyer (1997, S. 206) ist
„Lehrerfortbildung das Eigenlernen von Lehrer/innen als ergänzendes Lehr-, Lernsystem, das der Gesunderhaltung im Beruf, der Neuorientierung auf sich verändernde Schüler/innen, der Einstellung auf veränderte gesellschaftliche und fachliche Anforderungen an Schule sowie der Qualifizierung für die Mitarbeit an der Schulentwicklung dient.“
Das historisch junge Konzept lebenslangen Lernens, das mit der dritten Phase der Lehrer/innenbildung in Zusammenhang gebracht wird, ist mittlerweile zu einem grundlegenden Prinzip der europäischen Bildungspolitik geworden und getragen von der Hoffnung, damit zur Bewältigung des sozialen und ökonomischen Wandels einen wesentlichen Beitrag leisten zu können. Im europäischen Memorandum von 2002 wird verkündet, dass lebenslanges Lernen im Vorschulalter beginne, bis ins Pensionsalter reiche und damit das gesamte Spektrum des formalen, nicht formalen und informellen Lernens umfassen solle bzw. müsse. Auch im Bologna-Prozess von 1999 und im Regierungsprogramm von Österreich 2004 wird die Position vertreten, dass lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen einen wichtigen Teil der europäischen Vereinbarung darstelle (Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung, 2004).
Der Lehrer/innenfortbildung wird in der Kette des lebenslangen Lernens ein wichtiger Part in der Professionalisierung des Lehrberufs und in der Professionalitätsentwicklung der Lehrpersonen zugeschrieben (Radtke, 1999). Fullan (1999, S. 187) sieht dabei das individuelle Lernen im Sinne der Fortbildung als Suche nach „neuen Erkenntnissen, Überprüfung und Anwendung vorhandenen Wissens sowie die Reflexion der eigenen Arbeitsweise“, die nur aus einem persönlichen Bedürfnis heraus erfolgt. Ender und Strittmatter (2010) weisen hingegen darauf hin, dass Fortbildung aus einer ethischen Verpflichtung gegenüber den Schüler/innen, der Schule, den Eltern, dem Berufsstand und der Gesellschaft heraus passieren muss. In beiden Fällen wird Fortbildung demnach als Unterstützung kompetent Handelnder gesehen, wobei vorhandene Kompetenzen von Lehrer/innen weiterentwickelt und professionalisiert und auf unterschiedlichen Systemebenen handlungswirksam werden sollen.
In diesem Zusammenhang gibt es aber auch unterschiedliche Kritikpunkte an der praktizierten Lehrer/innenfortbildung. Oelkers (2000) spricht von Mängeln in der Fortbildung, die Lehrer/innen in der professionellen Entwicklung nicht genug unterstützt, und fordert daher, dass sich die Universitäten stärker in die Lehrer/innenfortbildung einbinden sollten. Krainer und Posch (1996) berücksichtigen in ihren Konzepten zur Lehrer/innenfortbildung die Bedürfnisse der Lehrer/innen und stellen das berufliche Lernen von Lehrer/innen in den Mittelpunkt. Die Förderung einer selbstkritischen Reflexion bei Lehrer/innen wird als Beitrag zur Professionalisierung im Lehrberuf gesehen. Dabei wird eine Art von Fortbildung vertreten, die sehr nahe an der Praxis der Lehrer/innen angesiedelt ist. Buhren und Rolff (2002) sind zudem der Ansicht, dass sich Fortbildung vermehrt in innerschulische Zusammenhänge einbinden lassen muss und die Einzelschule zu adressieren habe, wo sie mit dem Kollegium abgestimmt wird, damit neben der Fortbildung einzelner Lehrer/innen auch die Bedürfnisse und Erfordernisse der Schule und somit der Schulentwicklung mitberücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt, der auf der Makroebene ...