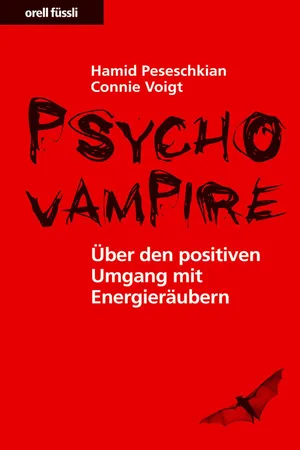![]()
TEIL 1
![]()
KAPITEL 1
Das Phänomen der Psychovampire
«Gesund ist nicht derjenige, der keine Probleme hat, sondern der, der in der Lage ist, positiv mit ihnen umzu gehen.»
(aus der Positiven Psychotherapie)
Haben Sie auch schon folgende Situationen erlebt? Oder erleben Sie solche gar tagtäglich?
Situation 1:
Die Ärztin Florence (34) kommt nach ihrem Urlaub erholt an ihren Arbeitsplatz in der Klinik zurück. Sie hat im Urlaub ihre Batterien aufgeladen und hat Lust und Energie, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Eine Krankenschwester begrüßt sie auf dem Flur im Vorbeigehen mit den Worten: «Warum lächeln Sie so? Macht es Ihnen etwa Spaß, wieder zu arbeiten?» Florence verliert durch diese negative Bemerkung in Sekundenschnelle die Freude an der Arbeit. Sie fühlt sich ausgelaugt, hat keine Lust mehr und fühlt sich schon fast wieder urlaubsreif.
Situation 2:
Kai (38) hat eine Idee für ein Buch, das er schreiben möchte, und erzählt sie seiner Freundin. Diese reagiert umgehend mit Skepsis, ohne die Hintergründe zu kennen: «Darüber gibt es doch bereits Bücher, dann muss deines aber ganz besonders gut sein, und das wird schwierig.» Kai empfindet diese Bemerkung nicht nur als respektlos, sondern auch als niederschmetternd. Er verspürt über die fehlende Unterstützung seiner Freundin eine Mischung aus Wut und Enttäuschung. Er fühlt sich durch ihre Reaktion ausgelaugt. Die Freundin wundert sich über sein Verhalten («Du bist immer so empfindlich. Ich habe dir nur meine Meinung gesagt. Du willst doch immer, dass ich offen und ehrlich bin.»)
Situation 3:
Felicitas (24) studiert Psychologie in einer Großstadt und fährt übers Wochenende zu ihren Eltern aufs Land. Sie freut sich, ihnen über ihre Erlebnisse an der Universität berichten zu können, darüber, was sie erlebt und über sich selbst in den Seminaren erfahren hat. Kaum zu Hause angekommen, legt sie gleich los, um sogleich von der Mutter jäh unterbrochen zu werden: «Mein Kind, du siehst so blass und dünn aus. Isst du denn auch richtig in der Stadt? Wie ist denn das Wetter bei euch?» Keiner geht auf die Gedanken und Wünsche von Felicitas ein. Sie hat das Gefühl, dass ihre Eltern kein echtes Interesse an ihr haben, ist am Boden zerstört und ärgert sich über sich selbst, dass sie sich ihnen gegenüber wieder geöffnet hat, obwohl sie es eigentlich hätte besser wissen müssen.
Wie würden Sie in der Rolle von Florence, Kai oder Felicitas reagieren? Lassen Sie uns herausfinden, was hier passiert ist. In allen drei Fällen haben sich die «Opfer» von Psychovampiren demoralisieren lassen, ohne den eigentlichen Grund zu kennen. Es sind typische Alltagssituationen, die eigentlich Kleinigkeiten darstellen. Aber je nachdem, was der Psychovampir als Person oder seine Kritik in mir auslöst, reagiere ich stärker oder schwächer.
Wie diese drei beschriebenen Personen hat jeder von uns grundsätzlich einige sensible Punkte, die sich im Laufe seines bisherigen Lebens entwickelt haben. Sie sind uns meistens nicht bewusst, oder wir glauben, dieses Problem bereits gelöst zu haben. Psychovampire erkennen scheinbar in Sekundenschnelle diesen sensiblen Punkt und drücken auf den «Knopf». Dieser löst jedes Mal die gleiche Reaktion aus – auch Jahre später. Psychovampire davon abzuhalten, auf den Knopf zu drücken, ist zwecklos bzw. unmöglich, wenn die eigene Schwäche aus der Vergangenheit gar nicht erkannt ist. Unsere erste Reaktion ist zwar die, uns vor dem Psychovampir zu verteidigen, mit ihm zu reden und ihn sozusagen auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Die therapeutische Erfahrung zeigt jedoch, dass dies meistens ein recht zweckloses Unterfangen ist. Wie soll ich all diejenigen Personen, die mir Tag für Tag begegnen, davon abhalten, ihre Kommentare abzugeben? Also geht es darum, die eigenen Angriffspunkte zu erkennen, sie zu bearbeiten oder zu lernen, sie zu kontrollieren. Nur so können wir der Opferrolle entfliehen und selbstbestimmte Menschen werden.
Weshalb haben die Psychovampire Krankenschwester, Freundin und Eltern zugeschlagen? Haben sie es überhaupt bewusst getan? Wie stabil sind sie in ihrer eigenen Lebenssituation? Sind sie notorische Nörgler und Pessimisten, deren Zweifel ihr eigenes Leben bestimmen lassen? Wie selbstbestimmt sind Psychovampire, und in welchem Ausmaß lassen sich die drei Opfer von den Vampiren in ihrem unmittelbaren Umfeld fremdbestimmen? Wie kann es sein, dass Psychovampire eine solche Macht über andere haben, und warum geben ihre Opfer ihnen unbewusst und unbeabsichtigt diese Macht? Wie erkennen potenzielle Opfer die Spiele und Techniken der Psychovampire, und wie können sie sich schützen und nachhaltig «immunisieren»?
Jeder strebt danach, als selbstbestimmter Mensch die eigene Energie nach eigener Dosierung zu nutzen und zu investieren. Der Psychovampir regiert über die Selbstbestimmtheit anderer – er macht andere zu fremdbestimmten Wesen. Wer sich über Jahre von Personen oder auch ganzen Situationen fremdbestimmen lässt, bezahlt später mit einer grundsätzlichen Lebensunzufriedenheit und mit wachsender Passivität. In bestimmten Fällen können diese Situationen zu Depressionen und zu einem Rückzug aus dem Leben führen sowie zu psychosomatischen Beschwerden und Unlust.
Eine nachhaltige Befreiung aus den Klammergriffen der Psychovampire kann nur durch Selbstreflexion und Veränderung der eigenen Einstellung entstehen. Haben wir die psychologischen Mechanismen bei uns selbst und bei unserem Gegenüber einmal erkannt, dann können wir uns konkrete Wege überlegen, wie wir den Psychovampir loswerden. Wenn wir Entscheidungen treffen, ohne uns die Mechanismen bewusst gemacht zu haben, hält der Effekt nur kurz an und wir sind anfällig für den nächsten Psychovampir, der bestimmt auftauchen wird. Im Fokus der Betrachtungen stehen demnach nicht nur – wie so oft – die Profile der «Täter», also der Psychovampire, sondern vornehmlich die der Opfer. Wenn wir den Mechanismus erkennen, können wir an uns selbst arbeiten – ob als Psychovampir oder als Opfer.
![]()
KAPITEL 2
Psychovampirtypen
«Wer das Ziel kennt, kann entscheiden,
wer entscheidet, findet Ruhe,
wer Ruhe findet, ist sicher,
wer sicher ist, kann überlegen,
wer überlegt, kann verbessern.»
(Orientalische Weisheit)
Psychovampire kommen in unterschiedlichen Gewändern daher. Zur Verdeutlichung dieser Typen geben wir ihnen jeweils charakterisierende Namen und zeigen das Kurzprofil ihrer Opfer auf. Psychovampire und «Psychovampiressen» – es gibt sowohl die männliche als auch die weibliche Form – erscheinen in unterschiedlicher Intensität. Auf manche Menschen treffen die Beschreibungen vollständig zu; andere zeigen vielleicht eher abgeschwächte Symptome eines Typs. Es gibt aber auch Menschen, auf die mehrere Typbeschreibungen zutreffen. Wer von der einen Person als Vampir wahrgenommen wird, der kann in seiner Beziehung zu einer anderen auch das Verhalten eines Opfers annehmen. Kurz gesagt, jeder Mensch kann Psychovampir und Opfer zugleich sein. Sowohl Vampir als auch Opfer kompensieren meistens Lücken in ihrem Selbstwertgefühl. Dazu ausführlicher in der tiefer gehenden Analyse im therapeutischen Exkurs in Kapitel 6.
Der Fallstrick-Vampir
Dieser Typus überschätzt sich grundsätzlich selbst. Er lässt so gut wie nie Widerspruch zu, ist uneinsichtig, despotisch und fühlt sich unersetzlich. Meist ist der Fallstrick-Vampir ein Narzisst. Sollte der Fallstrick-Vampir ein Chef sein, saugt er mit großer Wahrscheinlichkeit seine Mitarbeitenden aus, die es ihm nie recht machen können. Damit sind sie Opfer seiner Falle.
Der Ja-aber-Vampir
Seine Kraft erlangt dieser Psychovampir dadurch, dass er seine Reaktion auf Ideen oder allgemeine Äußerungen anderer mit dem Leitsatz beginnt: «Ja, aber…» Diese Grundhaltung wird als negativistisch und anstrengend erlebt, da der Psychovampir viele Gründe anführt, warum er etwas nicht ändern oder tun kann.
Der depressive Psychovampir
Er trägt die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern, läuft ständig mit einem leidenden Gesicht herum. Alles ist ihm zu schwer, im Grunde auch sein ganzes Dasein. Er hat zwar viel Zeit, erledigt aber kaum etwas und bekommt wenig geregelt. Dabei ist er ich-zentriert und lebt in der Grundhaltung: «Mir geht es schlecht und ihr müsst mich aufbauen, begeistern, ermutigen, Freude bringen etc.» Er quält sich durch den Tag und zieht somit das Umfeld emotional und stimmungsmäßig herunter.
Der Denkmalpflege-Vampir
Diesem Typen wäre es am liebsten, wenn die Welt stehen bliebe. Er folgt seinem Leitsatz: «Das haben wir immer schon so gemacht.» Er hasst Veränderungen und hält es mit dem Slogan: «Wenn es eine andere gute Idee gegeben hätte, dann hätte ich sie schon längst gehabt.» Die Zeiten ändern sich für den Denkmalpflege-Vampir nicht. Seine Opfer sind kreative Menschen und Nachfolger an Firmenspitzen, die mit ihren Innovationen bei ihm auf Granit beißen.
Der Kühlschrank-Vampir
Wer kennt nicht die Szenen, in denen eine «Du hörst mir nie zu, wenn ich ein Problem habe»-schluchzende Ehefrau am Esstisch sitzt, während ihr Ehemann nach flüchtigem Zuhören plötzlich verkündet, den Hund noch ausführen zu wollen. Dieser emotional kühle Vampir ist vermutlich in seiner Außenwelt anerkannt und hoch geschätzt, aber auf der Beziehungsebene mehr sach- als personenorientiert. Er lässt seine – meist sehr sensiblen – Opfer im Regen stehen.
Der ignorante Vampir
Das Phänomenale an diesem Gesellen ist, dass er zwar fragt, wie es einem geht, an einer Antwort aber überhaupt nicht interessiert ist und seine Opfer völlig ins Leere laufen lässt. Der ignorante Vampir äußert etwas, man möchte Stellung nehmen, aber er hört gar nicht zu, wendet sich stattdessen anderen Personen zu. Potenzielle Opfer dieses Typs werden von einem Gefühl der Leere befallen und glauben, langweilig zu sein. Sie suchen die Fehler bei sich.
Der Himalaja-Vampir
Dieser Vampir will hoch hinaus, nämlich immer wieder den höchsten Gipfel erklimmen. Er tut dies mit einer erstickenden Erwartungshaltung an seine Umwelt. Ob von den eigenen Kindern oder von Mitarbeitenden – er fordert stets eine unmöglich zu erbringende Leistung. Und falls diese unerwartet erreicht werden sollte,dann wertet er sie sogleich ab («Das kann doch jeder. Das war doch nicht schwer»). Wer keinen Erfolg hat, den lässt der Himalaja-Vampir links liegen. Er zermartert andere und auch sich selbst, denn er will immer höher hinaus und kommt doch nie ans Ziel, weil er dieses immer wieder neu steckt. Er kommt innerlich nie zur Ruhe und gibt sein Gefühl der Unzufriedenheit an andere weiter.
Der höfliche Vampir
Zu viel Höflichkeit kann auch Energie absaugen. Obwohl dieser Vampir niemandem zur Last fallen will, fällt er gerade deshalb besonders zur Last. Da er ständig helfen möchte, überfordert er sich und schafft dadurch neue Probleme für andere. Wenn er sich als nicht-ITversierter Mensch trotz der angebotenen Hilfe eines Kollegen einen Computer kauft, der völlig veraltet ist, dann betreibt letztlich der Kollege einen größeren Aufwand, wenn er das Modell in ein neues umtauschen muss. Wenn man den höflichen Vampir in ein Restaurant einlädt und fragt, was er trinken möchte, dann lautet die Antwort: «Was trinkst du denn? Mir ist egal, was.» So muss man immer wieder nachfragen, bis der andere sich endlich entscheidet. Die zurückhaltende Art des Psychovampirs wird als extrem anstrengend erlebt.
Der Nasen-Vampir
Dieser steckt seine Nase so ziemlich überall da hinein, wo sie nicht hingehört. Mit seinem Drang, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, sorgt er, wenn auch meist ungewollt, für Chaos und zahlreiche Missverständnisse unter den vielen, unnütz involvierten Opfern, die er in eigentlich belanglose Geschichten hineinzieht. Eigentlich will der Nasen-Vampir mit seiner Einmischung Ordnung schaffen, erreichen tut er das Gegenteil. Meist kommt er als nicht identifizierter Drahtzieher ungeschoren davon.
Der Wolf-im-Schafspelz-Vampir
Diese Person wirkt zunächst freundlich und unauffällig, hat es aber sozusagen faustdick hinter den Ohren. Man fällt immer wieder auf sie herein. Häufig ist die Person bösartig und nur oberflächlich freundlich und angepasst. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Menschen diesen Psychovampir nicht erkennen.
Der Ich-bin-es-nicht-gewesen-Vampir
Genossen dieser Art sind beispielsweise die Chefs, die es über Jahre versäumt haben, die richtige Strategie zu fahren und die dann beim Konkurs der Firma alle Schuld auf die Belegschaft schieben. Sie «hätten nicht genügend Arbeit geliefert, sonst würde der Laden noch gesund sein». Dieser Vampir erkennt sein eigenes Defizit nicht, nämlich dass er unfähig ist, Verantwortung zu tragen und die Kontrolle zu behalten.
Der Experten-Vampir
Er hat keine Ahnung, hält sich aber für einen Experten. Er weiß auf jede schwierige Situation eine Antwort, ist ein Besserwisser und verletzt und verärgert mit seinen oberflächlichen Ratschlägen die anderen. Der Experten-Psychovampir frisst die Zeit seiner Opfer, denn er holt mit seinem angeblichen Wissen weit aus. Wer es wagt, ihm zu sagen, dass er keine Ahnung hat von dem, was er sagt, riskiert ein dauerhaft kompliziertes Verhältnis mit diesem Vampir.
Sind Ihnen einige dieser Situationen bekannt – als Opfer oder als Vampir? Dann sollten Sie weiterlesen (falls nicht, dann trotzdem weiterlesen). Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich als potenzielles Opfer von diesen Psychovampirtypen nachhaltig abgrenzen können. Sie verändern Ihr Verhalten, und der Vampir sieht Sie nicht mehr als mögliches Opfer bzw. er verliert seine Macht über Sie, obwohl er sein Verhalten vielleicht gar nicht verändert hat. Haben Sie sich hingegen gerade selbst als einen Psychovampir enttarnt, dann ist es ebenfalls ratsam, weiterzulesen, um zu verstehen, wie andere Sie sehen und warum gewisse Situationen so sind, wie Sie sie vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben.
Die genauen Mechanismen, wie ein Psychovampir die Schwachpunkte seiner potenziellen Opfer erkennt, bleiben trotz allen psychologischen Erklärungsversuchen ein Mysterium. Sie sind vergleichbar mit dem Phänomen der Liebe auf den ersten Blick. Deshalb ist der Mechanismus bei Vampiren gefährlich. Und deshalb liegt es an den Opfern, die Situationen zu verändern, indem sie an sich arbeiten.
Paradoxerweise finden sich die Psychovampire fast immer in der unmittelbaren Umgebung. Sie sind der Gefühlswelt ihrer Opfer sehr nah, ob als direkter Vorgesetzter oder als Familienangehöriger. Dadurch erklärt sich der rasche Zugang zum Herzen und zu den Schwachpunkten des jeweiligen Opfers. Und da uns der Vampir so nahesteht, reagieren wir übermäßig sensibel auf Handlungen oder Äußerungen, die vielleicht in anderen Fällen mit weniger nahestehenden Menschen an uns vorbeigerauscht wären. Gleichzeitig macht es den Umgang mit den Psychovampiren so schwierig, denn viele von ihnen kann man halt nicht feuern und sich von ihnen vollständig zurückziehen. Den Partner, die Kinder, den Chef, die Schwiegermutter oder den Nachbarn zu entlassen, ist kaum möglich. Also bleibt nur der Aufbau eines Selbstschutzes.
Die Allegorie mit Psychovampiren verhilft zu einer positiven Sichtweise von unausgeglichenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Man könnte sagen, dass Psychovampire jedem von uns zu einer schnellen kostenlosen Selbsterfahrung, einer Kurzanalyse, die in Therapien mehrere Jahre dauern könnte, verhelfen – leider ohne dass wir sie darum gebeten haben. Mit den folgenden Fallbeispielen, die aus dem Leben und den Erfahrungen der Autoren gegriffen sind, verstehen Sie während des Lesens viele Situationen, die Sie seit Jahren erleben, aber vielleicht nie zu analysieren oder richtig einzuordnen vermochten.
![]()
KAPITEL 3
Geschichten häufiger Psychovampirtypen
Theorie und Praxis der Menschenkenntnis
Ein gelehriger junger Mann, den es nach Wissen und Weisheit dürstete, hatte unter vielen Entbehrungen fern seiner Heimat, in Ägypten, die Physiognomie, die Wissenschaft der Ausdruckskunde, studiert. Sechs Jahre hatten seine Studien gedauert. Schließlich legte er seine Prüfung mit bestem Erfolg ab. Voll Freude und Stolz ritt er in seine Heimat zurück. Jeden, den er unterwegs traf, sah er mit den Augen seiner Wissenschaft an, und um seine Kenntnisse zu erweitern, las er im Gesichtsausdruck aller, die ihm begegneten.
Eines Tages traf er einen Mann, in dessen Gesicht er folgende sechs Eigenschaften ausgeprägt fand: Neid, Eifersucht, Gier, Habsucht, Geiz und Rücksichtslosigkeit. «Bei Gott, was für ein ungeheurer Gesichtsausdruck, so etwas habe ich noch nie gesehen und gehört. Ich könnte hier meine Theorie prüfen.» Während er dies dachte, kam der Fremde mit einer freundlichen, gütigen und demütigen Haltung auf ihn zu: «O Scheich! Es ist schon spät am Tage, und das nächste Dorf ist weit weg. Meine Hütte ist klein und dunkel, aber ich werde dich auf meinen Armen tragen. Welche Ehre wäre es für mich, wenn ich dich diese Nacht meinen Gast nennen dürfte, und wie glücklich würde mich deine Anwesenheit machen!» Verwundert dachte unser Reisender: «Wie erstaunlich! Welch ein Unterschied besteht zwischen den Reden dieses Fremden und seinem abscheulichen Gesichtsausdruck.»
Diese Erkenntnis erschreckte ihn zutiefst, er begann an dem, was er über sechs Jahre gelernt...