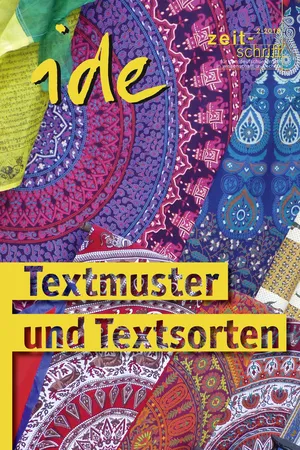![]()
Ulf Abraham
Literaturbezogenes Schreiben
Die Rolle von Textsorten und Textmustern im Rahmen literarischer Aufgaben
Der Beitrag klärt die Rolle von Textmustern im Rahmen literarischer Aufgaben am Beispiel einer poetischen Miniatur von Cees Nooteboom und mit Hilfe von Überlegungen zur Kommunikation über Ästhetische Erfahrung aus der Perspektive der Evolutionären Anthropologie. Literatur entsteht, wie auch die Malerei, aus dem Zeigen- und Erzählenwollen, und ihre Rezeption ist ein beständiger Prozess der Mit-Teilung auf der Basis geteilter Intentionalität (M. Tomasello). Die Unterscheidung, Produktion und Reflexion literaturbezogener Textmuster wie Zusammenfassung, Textanalyse und Interpretation im Unterricht lässt sich hier einordnen, wobei sich allerdings eine Vorrangstellung analytischen und argumentativen literaturbezogenen Schreibens zeigt, die den Blick auf Alternativen nicht verstellen sollte.
_________
I
Es ist spät im Jahr, er ist allein am geschützten Strand in der kleinen Bucht. Er war dorthin gegangen, um zu schwimmen, das Wasser war noch nicht zu kalt. Nach dem Schwimmen hat er gelesen. Dabei muß er eingeschlafen sein, als er erwacht, merkt er, daß er nicht mehr allein ist. Am anderen Ende des Strands, bei dem primitiven Bootshaus, wo das Schiff, das er noch nie gesehen hat, über eine eigens dazu angelegte Steinböschung ins Wasser gelassen werden kann, sitzt ein alter Mann auf den Felsen. In der Hand hat er einen Stock, an den Füßen kaputte Sandalen mit zerfranst herabhängenden Flügeln. Sein Oberkörper ist nackt, man kann noch erkennen, daß er früher kräftig gewesen ist. Jetzt ist die Haut schrumplig und trocken wie die von Eidechsen, es muß unangenehm sein, ihn zu berühren. Sein Haar unter dem helmähnlichen Hut ist verfilzt, es ist schmutzig und grau. Dies ist das erste Mal, daß der Badende einen Unsterblichen sieht, er verhält sich still und hofft, daß der Gott ihn nicht bemerkt hat. Der Beschützer aller Reisenden ist müde, er bückt sich unter Mühen zum Meerwasser, das an die Felsen spült, und fährt sich damit durch das Gesicht. Eine Weile blickt er aufs Meer, dann steht er auf und geht langsam zu dem Weg, der an der Küste entlang in die nächste Bucht führt. Erst später, als der Schwimmer sich zu erheben wagt, sieht er bei den Felsen die Spuren der Sandalen im feuchten Sand, daneben den seltsamen, stets wiederkehrenden Strich der Federn. (Nooteboom 1996, S. 8 f.)1
1. Ein poetischer Prosatext lädt zu literarischen Aufgaben ein
Diese poetische Miniatur des niederländischen Autors Cees Nooteboom (geb. 1933), der im deutschen Sprachraum einem breiteren Publikum mit der Novelle Die folgende Geschichte (1991) bekannt wurde, stammt aus einem schmalen Band mit autobiografischen Texten von hoher Dichte und teilweise ausgeprägter Rätselhaftigkeit. Im vorliegenden Fall beobachtet ein Badender unbestimmten Alters einen alten Mann am anderen Ende des Strandes, über dessen genau gezeichnetes Bild sich schnell eine mythologische Vorstellung schiebt: ein Unsterblicher – der Gott – der Beschützer aller Reisenden. Was geschieht hier? Hermes, in der griechischen Mythologie einer der zwölf Olympischen Götter, ist einerseits der Schutzgott der Reisenden, Kaufleute und Hirten, sowie der Gott der Redekunst, des Schlafes und der Träume, andererseits ist er auch der Gott der Diebe. Er gilt als » schlitzohrig, aber ohne böse zu werden, gewandt, listig, einfallsreich und doch dreist« (Poeschel 2014, S. 305). In seiner römischen Gestalt (Merkur) ist er darüber hinaus der Erfinder der Schrift, der Religion und der Astronomie (vgl. ebd.). Während diese Zuschreibungen in der mythologischen Überlieferung wieder verlorengingen, blieb seine Botenfunktion erhalten: Als Götterbote verkündet er die Beschlüsse des Zeus und führt gelegentlich Seelen von Verstorbenen in den Hades. Die Botschaften, die er überbringt, sind nicht immer leicht verständlich und müssen gedeutet werden. (Deshalb ist die Hermeneutik nach ihm benannt). Physisch ermöglicht werden dem Gott seine Geschäfte durch zwei kleine gefederte Flügel an jedem seiner Stiefel. Das Ende von Nootebooms Miniatur nutzt dieses Details für einen gleichsam empirischen Beweis: Nachdem der alte Mann weggegangen ist, sieht der Protagonist neben den Fußabdrücken im Sand »den seltsamen, stets wiederkehrenden Strich der Federn«.
Warum sollte man über diesen Gott der Vermittlung, des Übergangs und der Hermeneutik schreiben, was und in welcher Form? So sehr der Text eine Deutung nahezulegen scheint (ein namenloser, vermutlich noch junger Mann, der Dichter werden will, erprobt auf der Basis seines mythologischen Wissens seine Imagination und sieht in dem Alten eine gealterte, heruntergekommene Version des gemeinhin als schöner nackter Jüngling dargestellten griechischen Gottes), so dunkel bleibt, was wir damit über den jungen Mann erfahren: Tritt er selbst in die Fußstapfen des ergrauten Gottes, oder trifft ihn nur, unversehens beim Baden, die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist, angesichts von Verfall und nahendem Tod »am anderen Ende des Strandes«?
Solche Überlegungen zu einem Text, der deutliche mythologische Bezüge mit einer gewissen Polyvalenz verbindet, legen die Aufgabe schriftlichen Interpretierens nahe. Die mit dieser Aufgabe verknüpften Leistungserwartungen sind bis heute unscharf. Zabka (2012, S. 114) arbeitet aber als Konsens innerhalb der Deutschdidaktik heraus, dass das Textmuster des Interpretierens der Explikation des Textverstehens, der Erklärung des Textsinnes und der Demonstration von Interpretationskompetenz dient, und zwar in einem argumentativen Verfahren (vgl. ergänzend Rödel 2016, S. 19). Inwieweit darüber hinaus die Reflexion eines literarischen Textes »vor dem Hintergrund des eigenen Lebenshorizontes« erwartet wird (vgl. ebd., S.10), wäre jeweils in der Aufgabenstellung zu klären.2
Eine »Interpretationsaufgabe« in diesem Sinn (vgl. Baurmann/Kammler 2012) zielt auf ein schulisches Textmuster mit langer Tradition und großem Beharrungsvermögen vor allem in der Sekundarstufe II (vgl. zuletzt Rödel 2016). Dass dieses Textmuster nicht für alle Schulstufen gleich bedeutsam und in Bezug auf das Schreiben über Literatur nicht alternativlos ist, wurde im Lauf des vergangenen Vierteljahrhunderts theoretisch reflektiert und praktisch demonstriert (vgl. Abraham 1994, Zabka 2010). Alternative Textmuster wurden entwickelt, die in Bezug auf ihre Leistung und Bewertbarkeit im Folgenden zu prüfen sind. Zunächst ist aber zu klären, worin überhaupt der Sinn schulischen Schreibens über Literatur jenseits einer »Demonstration von Interpretationskompetenz« liegen mag.
2. Warum tauschen wir uns über Literatur aus? Kommunikation über Ästhetische Erfahrung mit Texten aus der Perspektive der Evolutionären Anthropologie
Michael Tomasello, Co-Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, wurde mit Experimenten bekannt, in denen er das Verhalten von Menschenkindern mit dem anderer Primaten (z. B. Schimpansen) verglich. Aus Ergebnissen, die hier nicht dargestellt werden können,3 schloss er, dass die menschliche Kulturfähigkeit nicht in der Sprachfähigkeit allein, sondern in der Fähigkeit des Teilens liege, das »Menschenaffen« im Gegensatz schon zu ganz kleinen Kindern nicht begreifen. Das Teilen ist, folgt man diesem Ansatz, der Kern des Mit-Teilens und damit der Ursprung von sozialem Austausch, nonverbaler und schließlich sprachlicher Kommunikation (vgl. Tomasello 2009). Geteilt wird in der (Früh-) Geschichte der Menschheit vermutlich zunächst das Jagdopfer, die Nahrung, das Feuer, die sichere Zuflucht, das praktische Werkzeug, dann aber auch das Interesse für das Neue und die Offenheit einer Wahrnehmung und Vorstellungsbildung, die Literatur und andere Künste erst möglich macht. (So zeigt uns der Erzähler in Nootebooms Text nicht nur einen alten Mann am Strand, sondern er zeigt uns auch, welche Vorstellungsbildung das bei ihm auslöst und welche Bedeutung er dem Beobachteten zumisst.)
Im Unterschied zu anderen Primaten ist der Mensch biologisch auf Kultur angelegt (vgl. Tomasello 2009, S. 82–84), das heißt von klein auf (noch vor jeder einschlägigen Erziehung) auf Helfen, Informieren und Teilen aus: Kompetentes Handeln ist immer adressiertes und oft auch gemeinsames Handeln. Warum wir kooperieren, das heißt, wodurch wir Menschen uns als soziale und kulturfähige Wesen erweisen, hat Tomasello (2010) mit seinem Konzept der shared intentionality erklärt: Eine Gruppe, die kooperieren will, muss die Fähigkeit entwickeln, die Aufmerksamkeit gemeinsam auf etwas zu richten und sich über das Wahrgenommene interpretierend und schlussfolgernd auszutauschen. Kooperation braucht konsensfähige Ziele und die Fähigkeit, die eigene Rolle in der handelnden Gruppe zu bestimmen und zu erfüllen. So lösen menschliche Gemeinschaften nicht nur Alltagsprobleme, sondern so schaffen sie auch Symbolsysteme, in denen Wirklichkeit literarisch oder künstlerisch verarbeitet wird: Literatur entsteht, wie auch die Malerei, aus dem Zeigen- und Erzählenwollen, und ihre Rezeption ist ein beständiger Prozess der Mit-Teilung (vgl. dazu eingehender Abraham 2013).
Der Sinn des Sprechens und Schreibens über Literatur im (Deutsch-)Unterricht ist nicht hinreichend erklärt, indem man den Nachweis von Analyse- und Interpretationskompetenz in den Blick nimmt; er ist viel grundsätzlicher ein kulturanthropologischer Sinn: Es gehört zum Menschsein, sich auszutauschen über jene Angebote zur Selbstdeutung einer Kultur, die die Kunst, und damit auch die Literatur, uns macht. Geschichten, Gedichte, inszenierte Bühnenwerke – sie alle machen uns einander begreifbar in unseren Normen und Werten, Widersprüchen und Sehnsüchten. Eine Literaturdidaktik, die nicht das Herstellen von gemeinsamer ästhetischer Erfahrung ins Zentrum ihrer Begründung rückt, geht am anthropologischen Fundament der Kulturfähigkeit des Menschen vorbei (vgl. Abraham 2013, S. 89).
3. Was leisten Textmuster für literaturbezogenes Schreiben? Sprachliche Handlungen und ihre Entsprechungen in Operatorenlisten
Literarische Texte werden im (oder für den) Unterricht inhaltlich wiedergegeben, sprachlich und formal beschrieben, in sinnstiftenden Zusammenhang mit anderen Texten gebracht, auf der Basis sprachlichen und kulturellen Wissens erklärt. Soweit sind einschlägige Aufgabenstellungen von der oben erläuterten kulturellen Praxis Literatur gedeckt, die literarische Texte zum Zweck der Selbstverständigung einer Gesellschaft (ge-)braucht: Austausch über den Sinn des einzelnen Textes und der Literatur insgesamt ist das Ziel, nicht eine (nur) im Deutschunterricht geforderte schriftliche Leistung der regelgeleiteten literaturbezogenen Äußerung über Literatur. Für die Letztere allerdings muss es, schon im Interesse der Bewertungspraxis, Textmuster geben, in denen literaturbezogenes Schreiben im Unterricht angeleitet, ausgeführt und beurteilt werden kann. Neben dem traditionellen »Interpretationsaufsatz« haben sich zum einen (im Sinn von »Textformen als Lernformen« nach Pohl/Steinhoff 2010) Hilfstextmuster entwickelt wie etwa die Paraphrase, die Zusammenfassung, der Kommentar. Zum andern sind in deutlicher Konkurrenz zu dieser literalen Analyse- und Interpretationspraxis auch Textmuster vorgeschlagen und erprobt worden, die den Anspruch analytischer Sachlichkeit und ausgewogener Deutung ersetzen durch denjenigen einer subjektorientierten, wertenden Schreibhaltung und sich damit eher an die Praxis der Literaturkritik anlehnen (Rezension, Buchempfehlung), ohne dass damit freilich die Teilaufgabe der Textbeschreibung und (im Ansatz) der Textdeutung völlig entfällt. Eine dritte Option ...