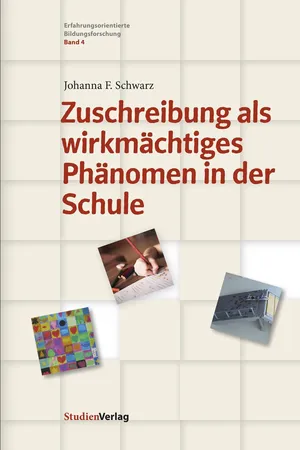![]()
Die Wirkmacht von Zuschreibungen in der pädagogischen Interaktion: leibliche Gesten und Gebärden und sie begleitende Gefühlsdispositionen
In jeder Geste [...] steckt die ganze Gesellschaft.
Wetterer 2013, S. 262
Gefühle und Lüste sind die Weiber in der menschlichen Seele.
Fink-Eitel und Lohmann 1993, S. 8
1. Vorbemerkungen
In diesem Abschnitt wird die Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen in Bezug auf alltäglich praktizierte Gesten und Gebärden in der Schule aufgezeigt und mittels Lektüren ausgewählter Vignetten (Schratz et al. 2012, S. 57–89) als schulische Erfahrungen konkretisiert. Vignetten enthalten in ihrer narrativen Verdichtung und beteiligten Perspektive spürbare Gefühlsebenen. Die folgenden Gesten und Gebärden mit Verweisen auf mit ihnen einhergehende Gefühlslagen finden in dieser Arbeit besondere Berücksichtigung: Grüßen (1), (Auf-)Zeigen (2), (Über-)Prüfen und (Ab-)Fragen (3), Fragen und (Be-)Antworten (3), (Zu-)Hören und (Ge-)Horchen (4), Reden und Schweigen (5), (Ab-)Schließen und (Be-)Enden (6). Die gewählten schulischen Praktiken91 spannen zudem den Bogen einer Unterrichtsstunde auf mit zentralen und prägenden (Zeit-)Sequenzen.
2. (Feindselige) Gefühle: Eine theoretische Annäherung
In diesem Abschnitt der Arbeit werden überwiegend feindselige Gefühle in der Schule behandelt und nicht nur Freudvolles, Glückliches, Zufriedenes, Gelassenheit, Geborgenheit, Erfolg oder Wohlwollen. Wir sprechen ungern von ekelhaften, gehässigen, ungerechten, neidvollen, wütenden, verachtungswürdigen, hasserfüllten Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Gefühle sind sprachlich schwer auszudrücken und entfalten ihre Wirkung oft schon, bevor noch ein böses Wort gefallen ist. Was uns hier widerfährt, drückt sich in leiblichen Gesten und Gebärden aus, in Tonalem, Stimmlichem oder Atmosphärischem. Meyer-Drawe zufolge ist es ein wichtiges Anliegen der Phänomenologie,92 Gefühle als Erfahrungen prägnant zu beschreiben, denn differenzieren wir unser Sprechen über das Erleben aus, „wird es auch das Erleben selbst” (Bieri 2011, S. 18).
Das Fühlen ist neben dem Meinen und dem Wollen eine Fähigkeit, die Menschen in besonderem Maße auszeichnet (vgl. Fink-Eitel und Lohmann 1993; Demmerling und Landweer 2007). In der Antike wird Gefühlvolles als „Betroffensein, Erleiden, Leidenschaft” bzw. als „>>pathos<<, >passio<< bzw. >>affectus<<“ (ebd., S. 7) bezeichnet. Pathos impliziert die Verwandtschaft mit „Gefühl, Leiden, Schmerz und Krankheit“ (ebd., S. 8) und damit etwas Unerfreuliches; die Entstehung von Gefühlen wird im „,niederen‘ leibgebundenen“ Seelenanteil angesiedelt und als schadhaft für den „,höheren‘, vernünftigen“ (ebd.)93 Teil angesehen. Diese auf antike Traditionen zurückgehende Kategorisierung und Abwertung des Leiblichen erklärt die bis heute andauernde Geringschätzung des Gefühlslebens im Vergleich zu Vernunft und Kognition. Seit Beginn der Neuzeit, so Fink-Eitel & Lohmann, wird zwischen den im Charakter der Person verankerten und dauerhaften Leidenschaften (Passionen) sowie aktuellen, plötzlichen Gemütsbewegungen (Emotionen) unterschieden. Affekte oder Gefühle wie Furcht, Freude oder Wut sind gerichtet und auf einzelne Gegenstände oder Sachverhalte bezogen, während Stimmungen oder Befindlichkeiten wie Angst oder Heiterkeit ungerichtete gefühlsmäßige Gesamtdispositionen sind, die sich auf keinen bestimmten Gegenstand richten.94
Waldenfels zufolge sind Gefühle „privative Zustände eines Subjekts“, die als „irrational [und] keiner Regel gehorchend“ (2004a, S. 27) gelten, solange sie nicht von Vernunft und Sachlichkeit gezähmt werden. Vorgänge wie Freude an etwas oder Ärger über etwas sind nach Husserl „Intentionales, das heißt auf Bedeutungen ausgerichtetes, Fühlen“ (ebd.). Das ist entscheidend für die Erschließung von Sinn und Husserl befreit damit die Gefühle aus ihrem „subjektiven Verließ“ (ebd., S. 28). Waldenfels spricht von „Pathos oder Affektion“ wörtlich als Antun (ebd., S. 28): Dies bezeichnet erstens ein Widerfahrnis, zweitens „etwas Widriges, das mit Leiden verbunden ist“ und drittens Leidenschaft, „die uns aus dem Gewohnten herausreißt“ (ebd., S. 29). Pathos als „Überraschung par excellence [...]“ (ebd.) widerfährt uns entweder zu früh, als dass wir uns darauf vorbereiten könnten oder zu spät, als dass unser Antworten darauf angemessen wäre.
Zu einer binären Sichtweise auf Gefühle gab es im philosophischen Diskurs immer Gegentrends. Bereits Aristoteles weist darauf hin, dass wir einzelne Affekte nicht nur negativ oder positiv bewerten dürfen, sondern dass ihnen die Erfahrung zugrunde liegt, es gehe um Lebensgestaltung im Ganzen (Fink-Eitel und Lohmann 1993, S. 13). Im Verlauf der Philosophiegeschichte wird immer wieder die Notwendigkeit einer Integration der Gefühle in die Vernunft betont bzw. die Rehabilitation der Gefühle.95 Gefühle werden auch mit Moralität verknüpft oder gewinnen an Bedeutung in der Ästhetik. Fink-Eitel & Lohmann betonen, dass Sprache Gefühle nicht nur benennt, sondern sie ist häufig „deren unmittelbare, verhaltensmäßige Äußerung“ (ebd., S. 10): In der Zornesäußerung ist der Zorn selbst da.
Meist sind es vor allem negativ gefärbte Stimmungen, die Strukturen menschlichen Lebens erschließen helfen (ebd. S. 13f). Dass wir uns selbst bewerten, wird in verschiedenen philosophischen Positionen als grundlegendes Wesensmerkmal menschlichen Personseins angesehen (vgl. Wolf 1993); dabei bilden entsprechende Gefühle häufig die Basis von Werten. Gerade schulisches Tun ist stark mit Werthaltungen verknüpft (vgl. Helm 2009); daher wird in den Vignettenlektüren auch dieser Verflechtung verstärkt nachgegangen. Döring betont wie Waldenfels den „evaluativ-repräsentationalen“ Inhalt von Gefühlen (2009, S. 16). Gefühle wie Furcht, Ärger, Empörung, Neid, Trauer, Bewunderung, Scham oder Stolz zeichnen sich dadurch aus, dass sie „auf etwas in der Welt gerichtet sind und es als in bestimmter Weise seiend repräsentieren“ (ebd., S. 14). Fürchten wir uns vor der Spinne, die wir im Raum entdecken, erscheint sie uns als furchteinflößend. Beneiden wir Kollegen, die vermeintlich mühelos von Erfolg zu Erfolg flitzen, erscheinen sie uns als beneidenswert. Wenn wir uns unseres eigenen Verhaltens schämen, kommt es uns so vor, als hätten wir wirklich etwas verbrochen. Damit sind die Spinne gefährlich, der Kollege beneidenswert, und wir selbst in unserem Verhalten verbrecherisch (ebd.).
Gefühle haben einen „repräsentationalen Inhalt“ d. h. sie stellen die Welt als in bestimmter Weise seiend dar; sie sind zudem „wesentlich intentional“ d. h. immer auf etwas in der Welt gerichtet (ebd., S. 15). Der „repräsentationale Inhalt“ – gefährliche Spinnen, beneidenswerte Mitmenschen, eigenes beschämendes Verhalten – enthält vielfältige Bewertungen und ist nicht neutral. Wir bewerten Eigenes und Fremdes stets in Bezug auf eigene Ansprüche, Ziele und Motive. Werte und Eigenschaften, die wir den Dingen zuschreiben, hängen auf vielfältige Weise mit unseren Gefühlen zusammen (ebd., S. 17). Schon die Alltagssprache enthält eine Vielzahl an Wertprädikaten, die an menschliches Fühlen gebunden sind, etwa beneidenswert, beschämend, abscheulich, ärgerlich, bewundernswert, erfreulich, empörend (2009, S. 17).
Meyer-Drawe (2007a) stellt im pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Diskurs ein erhöhtes Interesse an der Beschäftigung mit Gefühlen fest. Sie hebt hervor, dass diese nicht wie ein naturwissenschaftliches Studienobjekt behandelt und untersucht werden können. Unsere Gefühle machen uns ohnmächtig und spotten unserer Vernunft, sie widerfahren uns, nehmen uns in Beschlag und machen uns sprachlos. Sie erinnern uns an unsere Endlichkeit und betonen unsere leibliche Existenz (ebd., S. 113). Das emotionale Erleben anderer ist nicht wirklich erfassbar und lediglich aus äußeren Artikulationen – Gesten, Tönen, Mimik oder sprachlichen Äußerungen – erschließbar. Allerdings kann nur der, der Schmerzen hat, sicher darum wissen, denn er empfindet den Schmerz und weiß nicht nur darum. In ähnlicher Weise kommen wir forschend nie an das emotionale Erleben von Lernenden in der Schule heran. Vignetten ermöglichen als prägnante, verdichtete, erfahrungsträchtige Narrationen aus dem Schulalltag allerdings eine Annäherung.
Dieser Text folgt jenen Positionen, die Gefühle als intentionale, evaluative Vorgänge betrachten und einem Verständnis von Pathos, das ein Widerfahrnis im Sinne eines Antuns versteht (Waldenfels 2004a). Erfahrung, ihre Qualität, ihr Facettenreichtum sowie ihre Bedeutung für das (schulische) Lernen stehen im Zentrum der Argumentation. Erfahrung, die auf ein Widerfahrnis zurückgeht, ist geprägt von einem Grundzug der Responsivität, einer Verpflichtung auf Ansprüche zu antworten, die sich uns stellen. Auch die Nicht-Antwort, Schweigen oder Verstummen, sind Antworten. „Ein Pathos habe ich nicht, einem Pathos bin ich ausgesetzt. [...] [E]s [sitzt] im Herzen der Erfahrung wie die Unruh in der Uhr“ (ebd., S. 29). Der Leib ist der Ort der pathischen Gefühle, ein Leib, „der sich spürt, indem er etwas spürt, und in seiner Weltzugehörigkeit verletzlich ist“ (ebd., S. 29). Das Pathos selbst ist „nur indirekt fassbar, als Abweichung vom Gewohnten, als Überschuss an Nichtlernbarem in allem Lernbaren, als Fremdes im Eigenen“ (Waldenfels 2004a, S. 31;).
3. Leibliche Gesten und Gebärden: Eine theoretische Annäherung
Gesten sind leibliche Gebärden, also Bewegungen der Arme, der Hände oder des Kopfes, die die menschliche Rede begleiten, modifizieren und den lautsprachlichen Ausdruck sogar ersetzen können. Je nach Forschungsfeld, Zeit, Gesellschaft oder Kultur werden die Bedeutungen von Gesten und Gebärden unterschiedlich interpretiert. Heute handelt es sich dabei um ein breites Forschungsgebiet, das von der Linguistik über die Kognitionswissenschaft, von der Semiotik zur Verhaltensforschung bis hin zur Gebärdensprache reicht (vgl. Höhne 2005).
Gesten können einladend, lebhaft, bedrohlich, abwehrend, zustimmend, unentschlossen, neutral, beleidigend, stumm, beredt, (un-)höflich, demütigend, entspannend, provozierend, vulgär, überschwänglich oder symbolisch sein.96 Es gibt Überlegenheits- und Unterlegenheitsgesten, Gruß- und Intimitätsgesten oder Verschwiegenheits- und Unterwerfungsgesten. In nahezu allen Religionen finden sich Segens- und Glaubensgesten. Gesten, mit denen die Windsurfer sich die Windstärken oder Taucher die Wasserqualität signalisieren, sind ähnlich global verständlich wie Schieß- oder Trinkgesten. Gesten des Schnippens, mit denen die Aufmerksamkeit von Zuhörern erreicht werden soll, verweisen auf klangliche, tonale Dimensionen von Gesten.
Gesten haben meist symbolischen und metaphorischen Gehalt. Gerade der schulische Kontext stellt ein sehr spezifisches Reservoir an Gesten und Gebärden dar, die für Erwachsene unter Umständen missverständlich oder sogar unverständlich sind. Gesten sind sozial, historisch und kulturell konnotiert und häufig Quelle von Missverständnissen, vor allem in interkulturellen Begegnungen. Gesten tragen als „körperlich-symbolische Her- und Darstellungen von Intentionen und Emotionen“ (Wulf 2011, S. 7) entscheidend zur Sozialisation des Einzelnen in der Gesellschaft bei. Sie übermitteln Emotionen wie soziale Bindungen und schaffen auch soziale Zugehörigkeit (ebd.), schränken aber die Vielfalt an menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten durch ihre Konkretion auch ein. Die Bedeutungen von Gesten verändern sich im Hinblick auf Raum und Zeit und sind unterschiedlich in Bezug auf Geschlecht und Klasse. Über institutionelle Gesten schreiben sich institutionelle Werte in die Körper ihrer Mitglieder ein: „[…] Gesten der Demut (Kirche), der Achtung (Gericht), der Rücksichtnahme (Krankenhaus), der Aufmerksamkeit und des Engagements (Schule)“ (ebd., S. 8). In der Schule ist folglich auch das Erlernen der Bedeutung solcher Gesten ein Ziel, denn ihr Unterlassen oder missverständliches Anwenden führt zwangsläufig zu Sanktionen.
Das Wort Gebärde wird häufig synonym zu Geste verwendet und hat ein ähnlich weites Bedeutungsspektrum. Es gibt etwa Affekt-, Schmerz- oder Drohgebärden. Der Begriff Geste entwickelt sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts aus dem gesten machen, dem Gebärdenspiel der Schauspieler und Gaukler. In lat. gestus ist der bestimmte Gestus enthalten, in dem manche Handlung ausgeführt wird. Solch ein Gestus wie beispielsweise die (bildungsbürgerliche) Attitüde implizieren etwas Falsches, Aufgesetztes, Unehrenhaftes. In Folge entwickelt sich gerere, gestum weiter zu zur Schau tragen und hin zu sich in ungewöhnlicher oder auffallender Weise benehmen. Diese etymologischen Hinweise machen deutlich, dass sich in Gesten und Gebärden mehr als nur Sprachliches mitteilt, wir tragen uns zur Schau: Wir sind die (Droh-)Gebärde, die (Zornes-)Geste, wir spielen sie nicht.97
In phänomenologischer Hinsicht ist Sprache selbst eine „bestimmte Ausdrucksgebärde“ (Meyer-Drawe 2001, S. 201) und signifikant an den leiblichen Ausdruck, an sprachliche Gesten und Gebärden gebunden, die einen Sinn bereits in sich tragen; „Zorn [ist] in der Gebärde selbst da“ (vgl. Waldenfels 1980, S. 149 zit. in Meyer-Drawe 2001, S. 203). In der Deutung unserer Gesten und Gebärden spielt Kulturelles eine weit größere Rolle als Physiologisches. Grußformen, etwa, haben je nach Kulturkreis ganz unterschiedliche Bedeutungen. Gesten und Gebärden weisen immer schon über sich hinaus und schließen Bedeutungen ein, die uns oft gar nicht bewusst sind. Im Gespräch mit Anderen können wir zwar hören, was wir sagen, aber „wir sehen normalerweise unsere Gebärden nicht [...], vor allem unsere Gesichtsmimik ist uns verborgen“ (Meyer-Drawe 2001, S. 203). Der Ausdruck unseres Gesichtes verrät unsere inneren Stimmungen, genauso wie gewollte oder ungeplante Bewegungen unserer Hände oder unseres Körpers. Der Klang unserer Stimme oder die Gestalt unserer Blicke verrät unsere Gestimmtheit (vgl. auch Wulf 2011; Wulf et al. 2011).
Leibliche Gesten und Gebärden können im Sinne dieser Ausführungen mit Gefühlen und Gestimmtheiten in Verbindung gebracht werden und in den Vignettenlektüren in Bezug auf die Wirkmacht schulischer Zuschreibungen thematisiert werden. Schule als soziale Institution ist wie alle anderen menschlichen Lebenskontexte geprägt von den verschiedensten Gesten und Gebärden. Wenn Lehrpersonen etwas an die Tafel schreiben, wenden sie ihren Schülerinnen und Schülern den Rücken zu. Dies hat eine besondere Wirkmacht nicht nur auf das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, sondern auch auf die Vermittlung der fachlichen Inhalte. Was sie wie und in welcher Tonart sagen klingt nie so, wie ihre Lernenden das hören. Ihre Gestimmtheit verrät sich ebenso in ihren Blicken, Gebärden, Bewegungen und Körperhaltungen.98
4. Gesten oder Praktiken? Eine phänomenologischpraxeologische Verhältnisbestimmung
Die Frage, inwieweit es Parallelen oder Unterschiede zwischen Gesten und Gebärden aus phänomenologischer Sicht gibt mit Zugängen, die darin vorrangig sozial determinierte Praktiken sehen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht in extensio verfolgt werden. Es sei doch ein kleiner Exkurs mit den wichtigsten Verweisen auf weiterführende Literatur versucht. Die 2016 stattgefundene Tagung Phänomenologie und Praxistheorie - Eine Verhältnisbestimmung der FernUni Hagen99 hat g...