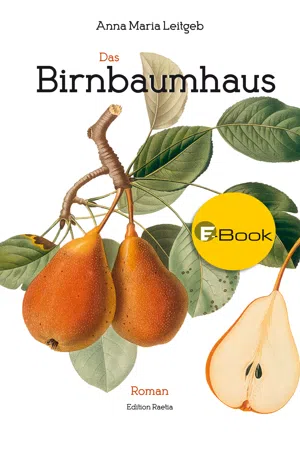![]() I. Verästelungen
I. Verästelungen![]()
Die Karte
Rabstein, Herbst 2010
Die Sache, von der ich erzählen will, wie soll ich sagen, sie hat alles auf den Kopf gestellt: mein Leben, das Verhältnis zu meiner Mamme, mein Selbstverständnis. Sie hat mich lange Zeit total überfordert. Was genau war, wie es sich zusammenfügte und was es bedeutete, wurde mir nie ganz klar, denn keiner der Beteiligten wollte reden. Nur eines war sicher: Die Mamme hatte ihn geliebt! Sie musste ihn geliebt haben! Der ganze Rest war ein Puzzlestück nach dem anderen aus einer alten Schuhschachtel. Und was mich anging – ein Gerechter käme möglicherweise zum Schluss, ich hätte mich in ihre Fußstapfen begeben, ein prinzipienloses Chamäleon wie sie. Ich könnte es ihm nicht verargen.
So fing es an. Anfang Jänner 1967 bekam ich eine Karte von Emma. (Ich nannte meine Mutter, seit ich denken konnte, bei ihrem Vornamen, ich kann das nicht genau erklären, aber irgendwie war sie für mich nach dem Bruch mit Enzo nicht die Mamme, die ich mir wünschte.)
„Liebe Kleine, komm unbedingt heim zu deinem 21. Geburtstag! Bitte sei so gut, tu mir diese Liebe!“
Ich fragte mich, was sie mir so dringend zu sagen hätte, was nicht auch am Telefon hätte besprochen werden können. War sie krank? Was war passiert? Sie neigte eigentlich nicht zu dramatischen Übertreibungen. Inmitten meiner Abnabelungsphase von alten Bindungen und Mustern versetzte mich der Gedanke einer irgendwie auseinanderfallenden Mutter in unangenehme Gefühlswallungen. Zudem, das sage ich frei heraus, ärgerte mich das Wort „heim“, das sie gebrauchte, denn „daheim“ war für mich immer noch Bozen und nicht dieses Dorf Rabstein, wo sie seit meiner Matura lebte.
Ich war nach der Matura mit dem Cello nach Salzburg gezogen, um am Mozarteum zu studieren. Nach Rabstein fuhr ich zu dem Zeitpunkt nicht oft, denn ich wollte endlich dort bleiben, wo das Leben lebendig war und mein Einsatz einen Sinn ergab. Heute muss ich schmunzeln, wenn ich daran denke, wie viel Enthusiasmus ich an die verschiedensten Protestaktionen vergeudet habe. Anfangs war sogar das Cello mit von der Partie. Absurd, nicht? Aber damals hielt ich es für angebrachte Streitkultur. Ich nahm mein Instrument zum Beispiel mit auf die Demo gegen den Schah-Besuch in Deutschland. Leider. Ein Guadagnini aus Turin! Wie blöd kann man sein! Wir hatten uns in der Nähe des Landestheaters platziert. Circa zwanzig Kameraden im Kreis um mich herum, Banner hoch, Parolen. Ich auf einer Flaschenkiste spielte mit fliegendem Schopf wie im Rausch, was mir einfiel: „Bella Ciao“, Mozart, Bach, die Beatles. Der Verkehr dröhnte. Die Passanten glotzten, fluchten, weil sie nicht weiterkamen, aber das war ja der Zweck: Ohne Provokation nahm der Mensch nichts wahr. Dann die näher kommenden Sirenen. Sie pferchten uns in Polizeiwagen, schmissen das Cello lieblos hinterher, den Kasten auch, lachten uns aus, von wegen Revolution, haha, wir sollten doch lieber einmal arbeiten gehen, und brachten uns aufs Revier. Einer von uns war Wehrdienstverweigerer und musste ins Gefängnis. Der Gipfel der Herzlosigkeit war jedoch, dass das Cello konfisziert wurde! Ich bekam es erst nach drei Wochen wieder und der Lahmarsch von einem Professor hatte kein Verständnis dafür, dass ich in der Halvorsen-Passacaglia nicht sattelfest war. Zum Glück fand ich einen anderen Prof, der mich zum nächsten Semester aufnahm. Der war in Ordnung, der distanzierte sich von den faschistoiden Großkopferten! Sogar bei den Streiks gegen Bildungsnotstand und die erhöhten Studiengebühren machte der mit!
Unsere Protestaktionen richteten sich häufig auch gegen die Vereinigten Staaten, diesen gepriesenen Hort der Demokratie. Dabei konnte doch jeder, der Augen im Kopf hatte, sehen, wie sich die Amis mit Brachialgewalt und ungezügeltem Kapitalismus über die Welt hermachten. Aber die wenigsten hatten eine Ahnung davon, was in Vietnam wirklich passierte oder wie brisant die atomare Kriegsgefahr war, denn die Presse informierte kaum, die lullte bloß ein, schaltete gleich und ließ das Establishment fröhlich weitermachen mit dem Vertuschen und Drangsalieren und Melken der einfachen Bürger.
Da musste sich doch einmal jemand für die Wahrheitsfindung ins Zeug legen, da musste doch jemand das Unrecht vor Ort heraussezieren und die grassierende Stumpfheit gegenüber der Politik durchbrechen! Genau das taten wir. Wir klärten auf, damit die Bevölkerung nicht wie zu Hitlers Zeiten wegschauen konnte.
Damals wimmelte es nur so von Ex-Nazi-Bonzen im öffentlichen Leben, die den Leuten Honig ins Hirn schmierten, auf dass sie die Opfer des NS-Regimes vergaßen. Höchste Zeit, dass die Menschen wachgerüttelt wurden! Die Naziverbrechen durften nicht unter einem blumigen Teppich verschwinden! Waren nicht schon die Verjährungsdebatten absurd? Die Nebel des Schweigens mussten ein für alle Mal zerrissen werden, die Sauereien unserer Eltern endlich aufhören! War es denn möglich, dass die Leute aus zwei Weltkriegen rein gar nichts gelernt hatten?
Ich hatte zudem einen persönlichen Beweggrund für mein Engagement. Verwandte von mir waren umgebracht worden. Im Massaker der Deutschen in Sant’Anna di Stazzema am 12. August 1944. Die Nonna hatte mir die Geschichte von klein auf eingetrichtert, wenn ich die Sommer bei Enzo in La Spezia verbrachte. Sie war selber dem Tod nur knapp entkommen. Hinauf durch Wald und Gestrüpp war sie gehetzt, einer ihrer Schuhe steckt vermutlich heute noch im Bachbett, das sie durchqueren musste. Sie hatte sich an Eichen-Schösslingen hochgezogen, immer höher hinauf in die Berge, wo sich der Nonno versteckt hielt, während hinter ihr die Welt zusammenbrach.
Die Arme keuchte wie eine Lungenkranke, wenn sie erzählte. Die Bestialität schnitt ihr jedes Mal die Luft ab und doch musste sie reden. Sie sah immer die störrische Zia Elisa vor sich, ihre älteste Tochter, deren Namen ich bekommen habe. Die hatte sich geweigert mitzukommen, die hatte darauf bestanden, zu Hause zu bleiben. Warum das Baby unnötig aufwecken, hatte sie gesagt. Der kleine Livio war gerade einmal drei Monate alt. Von den Warnungen hielt sie nichts. Sie war überzeugt davon, dass die Tedeschi Frauen und Kinder in Ruhe ließen. Aber wie sich herausstellte, war sie einem Gehirnfurz erlegen, denn sie wurden zusammengetrieben, ausnahmslos alle, auf dem Kirchplatz oder in irgendwelchen Stallungen oder Hinterhöfen erschossen und anschließend verbrannt. Alle. Frauen, Kinder, Alte. Die Häuser zerstört. Noch wochenlang der Brandgeruch.
Jeden Sommer erzählte mir die Nonna dieselbe Geschichte. Sie redete wie unter Zwang, schnaufte, streichelte mir die Hand und sah mich an mit ihren grün gesprenkelten Eulenaugen. Je älter sie wurde, desto leiser, rauchiger wurde ihre Stimme. Schließlich hauchte sie ihren Bericht nur mehr: von verkohlten Menschenhaufen; von Gestank; von vielen (um die fünfhundert) Toten. Das war sozusagen ihre Hinterlassenschaft für mich.
Heute ist mir der Armadio della Vergogna ein Begriff. Der sogenannte Schrank der Schande stand jahrzehntelang versiegelt und mit der Tür zur Wand im Palazzo Cesi-Gaddi in Rom, im Sitz der Militärstaatsanwaltschaft. In diesem Schrank wurden die Akten über deutsche Kriegsverbrechen in Italien aus politischem Opportunismus ganz bewusst dem Vergessen preisgegeben. Erst 1994, zwei Jahre vor Emmas Tod, wurden sie „wiedergefunden“. Zu spät, denn da waren die meisten Verantwortlichen im Ausland oder tot oder vergreist oder es gab Probleme mit der Zuständigkeit.
In Salzburg jedenfalls hatte keiner meiner Freunde von den Massakern, von denen meine Nonna berichtete, je etwas gehört. Und ich hatte keine Ahnung von der bewussten Unterschlagung der Wahrheit.
Mein Studentenleben war also gekennzeichnet von einem oft nahezu schwärmerischen politischen Eifer. Ein Stipendium der Südtiroler Landesregierung sorgte für Unterkunft und Verpflegung. Zusätzlich brachten mir kleine Finanzspritzen Emmas und kurze Auftritte – hie und da eine Hochzeit, eine Eröffnungsfeier, ein Adventskonzert – etwas ein. Finanziell hielt ich mich also über Wasser. Alles in allem war ich frei und ausgefüllt und das passte mir so. Dann kam diese Karte.
![]()
Emma
Rabstein, 1922–1936
Was die Kleine nicht wusste, war, dass Emma in den Wochen vor dem besagten Geburtstag, wenn sie einmal einschlief, von Angstträumen heimgesucht wurde. Auch tagsüber schaute sie besorgt aus dem Fenster, sei es auf den zerwühlten Schulhof, während die Schüler mit gebeugten Köpfen über einer Arbeit saßen, oder von ihrer Küche auf den glänzenden Strang der Bahngleise, stets irgendeine Bedrohung des Leibes oder der Seele erwartend.
Wenn es ihr nur gelänge, sich ein kleines bisschen in den Kopf ihrer Tochter zu denken! Sie selber war doch auch einmal jung gewesen, jedoch im Gegensatz zu der Kleinen nichts anderes als ein gehorsames Kind, auch als ihr die Umgebung immer mehr auf die Nerven ging. In ihrer Generation zählte Loyalität noch mehr als alles andere und die erwartete sie irgendwie auch von der Kleinen.
Also mündeten die Grübeleien Emmas meistens in den Entschluss, die spröde Widersetzlichkeit ihres Sprosses so gut es ging zu ignorieren oder als vorübergehenden Entwicklungsabschnitt wegzuerklären. Aber tief verborgen im Gestrüpp der Denkschaltungen im Gehirn wucherte die Furcht, dass im Grunde ein Versagen ihrerseits vorlag, ein Versagen, das sich ihr allerdings nur bruchstückhaft offenbaren wollte und daher umso mehr die Enttäuschung, den Frust und das Unverständnis schürte. Trotzdem trat sie der Kleinen bei jedem ihrer spärlichen Besuche mit einer Art von grimmiger Liebe entgegen, die keine Widerrede duldete und mit der sie die Ahnung von dem diffusen Scheitern kaschierte.
Emmas Aufwachsen fiel in das Chaos von Okkupation und Krieg, allerdings innerhalb einer Gesellschaftsordnung, die auf einem Bewusstsein von Zugehörigkeit aufbaute.
Sie wurde als Emma Egger im Jahre 1922 in Rabstein geboren, einem Dorf im Herzen Südtirols. Die Ortschaft lag von steilen Talflanken umrahmt am Schnittpunkt von zwei Tälern. Aufgrund dieser verkehrsstrategischen Lage war Rabstein seit k. u. k. Zeiten ein Eisenbahnknoten, an dem alle Züge hielten.
Die Rabsteiner arbeiteten entweder bei der Eisenbahn oder in der Pappfabrik. Emmas Vater überließ den Italienern die Eisenbahn und zog wie die meisten Einheimischen die Pappfabrik vor. Er hatte sich nach einem Holzunfall auf die Warteliste für die Fabrik setzen lassen, denn der schlecht heilende Unterschenkelbruch machte die Waldarbeit zur Qual. Nach einem guten Jahr wurde seine Geduld belohnt und er wurde zu seiner und zur Erleichterung seiner Frau den Trocken- und Lagerräumen zugeteilt.
Emmas Mutter bewirtschaftete direkt am Rangiergelände der Bahn eine Keusche mit Küchengarten und Birnbaum, Bienenhütte sowie Hennen- und Ziegenstall.
Geschwister hatte Emma keine, aber einen Großvater, der nach dem Tod der Großmutter die Stube belegte. Wenn Emma später an Rabstein dachte, dann stellte sich sofort, auch nach Jahren, der säuerliche Geruch seiner Diwandecke ein, eines steifen, bräunlichen, vornehmlich aus Rosshaar angefertigten Stücks. Auch im Dunst von Dampf, Ruß und Diesel, der immer über dem Ort hing, war sie daheim. Sogar der Bärlauch konnte im Frühling mit seinem grün-saftigen Aroma, das vom Waldrand herunterwehte, diesen Geruchsschleier nicht durchdringen. Das Bahnhofsgebäude selber stank immer etwas nach Pissoir. Ansonsten war Rabstein die Tankstelle, wo es nach Benzin, Öl und Leder roch, das Posthotel, wo Pferdedung vorherrschte, und die Kirche mit der weihrauchigen Winterluft.
Wie überall war das Gotteshaus der Ort, an dem alle wichtigen Rituale des Menschenlebens stattfanden, Taufen, Erstkommunionen, Schülermessen, Hochzeiten, Begräbnisse, ohne aber eine allzu starke Prägung in Emma zu hinterlassen. Sonst konnte sich Emma, was ihr Aufwachsen anging, abgesehen vom Olfaktorischen, nur mehr an einen Mischmasch aus traurigen Objekten erinnern: an die Lederschuhe, die immer unbequem waren, an das Plumpsklo hinter dem Haus, an die welke Blüte in Vaters Hutschnur, an den gesprungenen Waschtischspiegel, an die Romane aus dem Volksboten, von der Mutter ausgeschnitten und zusammengeheftet in einer Schachtel aufbewahrt – keine irgendwie erhebende Literatur, bloß eine geistlose Baroness nach der anderen oder eine brave Bauernmagd und ihre böse reiche Widersacherin, die beide denselben Jungbauern wollten.
Auf die Bauernmädchen des Orts war Emma nie neidisch. Feld- und Stallarbeit waren langweilig bis eklig, das stellte sie fest beim obligaten Verwandtenbesuch um Allerheiligen in einem Hochgebirgstal in der Nähe der österreichischen Grenze. Was Baronessen anging, so kannte sie keine, ihr Leben zwischen Internat, Tennis und Reisen erschien ihr aber entschieden interessanter. Zu der Zeit wäre sie allerdings schon mit dem Leben der Tochter des italienischen Bahnhofsvorstehers zufrieden gewesen. Nicht, dass Emma mit Sandra Pizzari befreundet gewesen wäre. Obwohl sie in dieselbe Klasse gingen, hatte sie außerhalb der Schule keinen Kontakt mit den Italienerinnen. Die Mutter hatte sie nicht nur vor der Sprache der Besatzer gewarnt, sie hatte Emma auch auf einleuchtende Weise deren moralische Minderwertigkeit eingetrichtert. Das Mädchen war aber nichtsdestotrotz Inhalt von Emmas Sehnsüchten, und diese Schwäche verunsicherte sie so sehr, dass sie die vermeintliche Todsünde sogar einmal dem Pfarrer beichtete.
Sandra hatte glänzendes Kastanienhaar, das ihr in weichen Locken auf die Schultern fiel und in dem sie immer zu den Kleidern passende Schleifen trug. Sie aß zur Pause weißes Brot mit Mortadella und übte nachher mit der dicken Grazia Seilspringen, saltare la corda – und das in schwarzen Lackschuhen! Sie hatte Eltern, die mit ihr Motorrad fuhren, sie und ihre ondulierte Mutter im Beiwagen. Außerdem unternahmen sie immer wieder einmal eine Bahnfahrt, irgendwohin, wo es Gold regnete, jedenfalls kam das Mädchen entweder neu eingekleidet zurück oder mit einem neuen Ball oder gar einem Fahrrad.
Sandra Pizzari führte in Emmas Augen ein akzeptables Leben. Es lag doch auf der Hand, dass Emma in diesem unglückseligen Kaff mit diesen Eltern den Kürzeren zog. Sie tat sich selber leid.
Zudem war ihr Vater mit einem ungemütlichen Grant gesegnet. Er verspürte den Wetterumschwung im Bein, die Honigbienen waren von Milben befallen, der Ziegenkäse wollte ihm nicht ge...