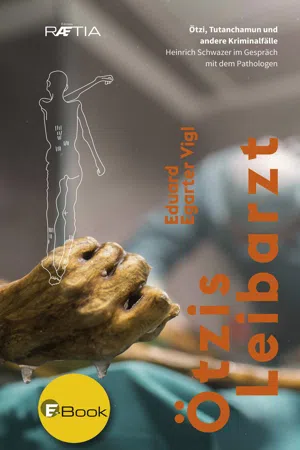![]()
Pathologen sind Detektive
Als Pathologe blickt Eduard Egarter Vigl ins innerste Gewebe des Menschen, als Gerichtsgutachter auch in seelische Abgründe. Er baut die Abteilung für Pathologie am Krankenhaus Bozen auf und erlebt die rasante Entwicklung seines Berufes von der mikroskopischen Diagnostik zur Molekularpathologie mit.
Warum sind Sie Arzt geworden? Hat Ihre Familie dabei eine Rolle gespielt?
Nein. In unserer Familie gab es keine Ärzte und meine Eltern ließen mir bei der Wahl der Studienrichtung völlig freie Hand. Ich erinnere mich, dass wir in der Maturaklasse einen Multiple-Choice-Test zwecks Berufsberatung gemacht haben. Der Psychologe sagte bei der anschließenden Besprechung der Ergebnisse zu mir: Besondere Neigungen kann ich nicht feststellen, aber wie wäre es mit Meteorologie? Für das Medizinstudium entschieden habe ich mich wohl auch deshalb, weil mehrere meiner Mitschüler diese Richtung einschlagen wollten. Ein technisches Fach mit viel Physik und Mathematik wollte ich nicht, ebenso hatte ich kein besonderes Interesse an Literatur. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut, meine Arbeit hat mir immer Freude bereitet.
Wo haben Sie studiert?
Mein Studium begann ich in Innsbruck, wechselte nach einigen Semestern an die Universität Padua, wo ich meinen Abschluss machte. Besonders diese letzten Studienjahre haben mich in vielerlei Hinsicht, auch sprachlich, geprägt. Nach dem Militärdienst und einer kurzen Zeit als Assistenzarzt am Krankenhaus Bozen begann meine Facharztausbildung für Labormedizin und Pathologie in Mailand. Eine weitere Station meiner beruflichen Ausbildung war München. Dort arbeitete ich in verschiedenen Einrichtungen als Pathologe, bis ich nach nach Bozen kam, wo ich zuerst als Oberarzt arbeitete und später als Chefarzt die Abteilung für Pathologie neu aufbaute.
Was heißt „aufbaute“?
Die Abteilung war damals in einem eher bescheidenen Zustand, der weder der Größe noch der Rolle des Krankenhauses entsprach. Es hat einige Zeit gebraucht, die Leute der Verwaltung und der Direktion zu überzeugen, dass es wichtig ist, in dieses Fach zu investieren.
War das nicht klar?
Nein, das Fach Pathologie wurde lange Zeit als eine akademische Thematik verstanden, als Ort der Grundlagenforschung und Universitätslehre. In der klinischen Praxis war die mikroskopische Diagnostik als Entscheidungshilfe für den behandelnden Arzt kaum etabliert, besonders nicht in den kleineren und mittelgroßen Krankenhäusern. Wenn überhaupt, wurde die Arbeit des Pathologen mit der Autopsie identifiziert. In der Nachkriegszeit entstand unter dem Einfluss der amerikanischen Medizin der Begriff der Klinischen Pathologie. Gewebeproben wurden zunehmend in der Diagnostik und zur Verlaufskontrolle von Therapien eingesetzt. Die moderne Tumorlehre mit den verschiedenen Klassifikationen bösartiger Erkrankungen und die daraus abzuleitenden Behandlungsformen wurden erst durch die Pathologie möglich. Am Krankenhaus Bozen bestand bis in die 60er- oder 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts keine eigene Abteilung für Pathologie, sondern nur eine Ein-Mann-Sektion, die Teil des klinischen Labors war. Gewebeproben aus den übrigen Krankenhäusern Südtirols wurden an die Universität Innsbruck verschickt, was natürlich zu längeren Diagnosezeiten führte. Erst Ende der 70er-Jahre entstand im neuen Krankenhaus in Bozen-Moritzing, das gerade aufgebaut wurde, eine eigene Abteilung für Pathologie unter Giuseppe Scomazzoni. Nach wenigen Jahren verließen sowohl Scomazzoni als auch sein einziger Oberarzt, Eugenio Dall’Orso, von einem Tag auf den anderen das Krankenhaus Bozen für eine Stelle im Veneto. Die Abteilung für Pathologie war verwaist. Für mehrere Jahre fristete sie ein stiefmütterliches Dasein: Die Proben wurden verschickt, ein Arzt aus der Abteilung für Hämatologie, Vito Colombetti, versah zeitweise den Dienst fürs Grobe. Für ein 900-Betten-Krankenhaus ein untragbarer Zustand. Als ich nach Abschluss meiner Ausbildung eine Einladung erhielt, nach Bozen zurückzukehren, nahm ich sowohl aus persönlichen als auch aus beruflichen Gründen gerne an. Die Abteilung befand sich in einem erbärmlichen Zustand, die wenigen Mitarbeiter erledigten zwar mit allem Einsatz ihre Arbeit, aber ohne ein Ärzteteam war an eine qualifizierte Diagnostik nicht zu denken. Ich war damals voll jugendlichem Eifer und Idealismus und war überzeugt, eine gute und fundierte Ausbildung hinter mir zu haben. So begann ich die Aufbauarbeit, die in der Schaffung eines neuen Gebäudes im Jahr 2000 und einer modernen Einrichtung gipfelte. Das Team war auf zwölf Fachärzte, vier Biologen und insgesamt 65 Mitarbeiter angewachsen und deckte alle Bereiche der Pathologie für das ganze Land einschließlich des Südtiroler Tumorregisters ab.
Hat man Sie aus München geholt, um eine pathologische Abteilung aufzubauen?
Ich erinnere mich an mein Vorstellungsgespräch beim damaligen Sanitätsdirektor Kuno Steger, dem charismatischen und gefürchteten Chefchirurgen des Hauses. Er entließ mich mit den Worten: Eigentlich brauchen wir die Pathologie gar nicht. Wir sehen ja mit freiem Auge, was der Patient hat. Da dachte ich mir, ich bleibe wohl besser in München. Es hat aber dann doch Bestrebungen gegeben, eine eigene Abteilung aufzubauen, es gab politischen Druck aus der Südtiroler Landesregierung und 1984 – ich war damals 35 Jahre alt – habe ich in Bozen angefangen und sofort eine kleine Gruppe gebildet.
In der Vorstellung vieler ist der Pathologe ein „Metzger“ am Seziertisch, der den ganzen Tag Leichen zerteilt. Wie kam es, dass Sie sich gerade auf die Pathologie spezialisiert haben?
Meinen ersten Kontakt mit dem Fachgebiet hatte ich an der Universität Padua, lustigerweise aber nicht über die Fachschiene, sondern über den Fußball. Ich hatte einen Studienkollegen, ein Praktikant an der Pathologie, der zu mir gesagt hat: Du, wir haben eine Fußballmannschaft am Institut, wir brauchen noch jemanden, hast du nicht Lust mitzuspielen? Wir haben ein Mal pro Woche trainiert, es war eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Süditalienern, Griechen, Schweizern und Venetern. So bin ich als Student über die sportliche Vorzugsschiene in das Institut für Pathologie gekommen. Später bin ich dann studente interno geworden, eine Funktion mit didaktischen Aufgaben und der Möglichkeit, die Doktorarbeit zu schreiben.
Gab der Fußball den Ausschlag?
Nein, das wäre wohl etwas wenig gewesen für eine Berufsentscheidung. Den Ausschlag gab der Lehrstuhlinhaber Mario Piazza, der mich schätzte und mir die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten bot. Er wusste von meinen Deutschkenntnissen und trug sich schon lange mit dem Gedanken, ein Lehrbuch für Pathologie aus dem Deutschen ins Italienische zu übersetzen. Er bot mir die Zusammenarbeit für die Übersetzung des Textes an, circa 600 Seiten Fachsprache. Ich habe zugesagt, konnte wohl auch nicht anders, habe einen ganzen Sommer über bis spät in die Nacht hinein gearbeitet und viel gelernt. Im Rückblick kann ich sagen, dass diese Übersetzung und der damit verknüpfte enge Kontakt zum Professor und seinen engsten Mitarbeitern ein wesentlicher Grund dafür war, dass ich bei der Pathologie geblieben bin.
Ein Glücksfall, der Ihr Leben geprägt hat.
Jeder Medizinstudent macht während seines Studiums und später in der frühen Ausbildung Erfahrungen, die seinen weiteren Berufsweg bestimmen. Nur wenige wissen von vorneherein, was sie werden wollen. Darüber hinaus sind es private Dinge, Beziehungen und Rahmenbedingungen wie eine väterliche Praxis, die eine Entscheidung mit beeinflussen. Der Rest, und das ist nicht wenig, ist Zufall oder Glück.
„Für viele Menschen ist der Umgang mit Toten zumindest ungewöhnlich. Aber in vielen Berufen gehört er zur täglichen Berufsrealität.“
Hatten Sie nie Probleme, mit Leichen zu arbeiten?
Die Frage ist berechtigt. Für viele Menschen ist der Umgang mit Toten zumindest ungewöhnlich. Aber in vielen Berufen gehört er zur täglichen Berufsrealität. Ich meine nicht nur den Leichengräber oder den Bestatter. Auch Krankenpfleger, Seelsorger und Ärzte kommen oft mit Toten in Kontakt. Irgendwann wird das Routine. Der Pathologe hat einen anderen Zugang. Er schaut in den Körper des Verstorbenen hinein, eröffnet aus fachlichen Notwendigkeiten seine Körperhöhlen und kommt somit mit Blut, anderen Körpersäften und Geweben in Kontakt. Von außen betrachtet, hat das anatomische Zerlegen einer Leiche vielleicht etwas Abstoßendes an sich. Auch der Geruch, der sich bei der Untersuchung von Organen verbreitet, trägt zu diesem Eindruck maßgeblich bei. Aber auch hierbei kommt es zu einem Gewöhnungseffekt und die meisten jungen Pathologen empfinden schon nach wenigen Untersuchungen kaum mehr Ekel. Allerdings gab es schon in seltenen Fällen Kollegen, die wegen einer anhaltenden Abneigung gegenüber der Tätigkeit am Seziertisch die Berufsausbildung abbrechen mussten. Mich persönlich kostet es eine viel größere Überwindung, an das Bett eines leidenden Patienten treten zu müssen, um ihm mitzuteilen, dass seine Zeit langsam abläuft. Ich halte die Kollegen der Onkologie und Palliativmedizin für die wahren Helden unter uns Ärzten. Die Belastung, der sie täglich ausgesetzt sind, ist unvergleichlich größer als die eines Pathologen, der am Seziertisch arbeitet. Ich habe in meinem Beruf nie den engen Kontakt zum Patienten vermisst, obwohl viele Kollegen der Meinung sind, ich wäre ein guter Kliniker geworden.
„Die Pathologie ist entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht ein Fach, das total abgehoben ist von der Patientenwelt – im Gegenteil.“
Wie intensiv sind die Kontakte eines Pathologen zu den Patienten?
Die Pathologie ist entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht ein Fach, das total abgehoben ist von der Patientenwelt – im Gegenteil. Gerade in der modernen Pathologie ist der Umgang mit dem lebenden Patienten immer stärker in den Vordergrund gerückt. Auch wenn man nur durch das Mikroskop schaut und eine Diagnose erstellt, sieht man dahinter den lebenden Patienten mit all seinen Problemen und Leiden. Der Pathologe gehört heute, in einer modernen Krankenhausmedizin, in unverzichtbarer Weise zum multidisziplinären Team, das sich um den Patienten kümmert. Wenn die Diagnose einer Tumorerkrankung erstellt wurde, geht es an die Therapieplanung. Die hängt von wichtigen Informationen ab, die nur der Pathologe liefern kann. Auch die Arbeit am Seziertisch verfolgt einen ähnlichen Zweck, nämlich die behandelnden Ärzte abzusichern, dass sie richtig gehandelt haben oder sie auf Fehler im Sinne einer Qualitätskontrolle hinzuweisen. Es gehört zur Transparenz des ärztlichen Handelns, dass man die Ergebnisse einer Leichenschau mit den Angehörigen des Verstorbenen bespricht. Sorgen und Ängste vor Kunstfehlern oder Nachlässigkeiten in der Patientenbetreuung spielen im Spitalsleben immer häufiger eine bedeutsame Rolle. Da geht es oft auch um Schadenersatzforderungen und Schuldzuweisungen. In solchen Fällen muss der Pathologe Rede und Antwort stehen.
Sind Pathologen ein „detektivischer“ Menschenschlag? Wer ist für den Beruf geeignet?
Es gibt Menschen, die haben zwei linke Hände und schneiden sich bei einer Obduktion fünfmal ins eigene Fleisch. Wenn das zwei-, dreimal passiert, sollte man ihnen den Rat geben: Such dir eine andere Arbeit, so hat das keinen Sinn. Das Infektionsrisiko ist zu groß und solche Menschen sind auch zu zaghaft oder schusselig. Man muss imstande sein, direkt auf ein Problem loszugehen. Der Umgang mit Toten, nicht mit dem Tod, ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Unsere Kultur grenzt den Tod aus, somit auch die Toten. Viele haben Probleme, in eine Leichenhalle zu gehen, wo fünf Leichen liegen und wo dann der Leichendiener das Leintuch vom Gesicht nimmt und sagt: Das ist Ihr Vater. Auf dem Seziertisch ist der tote Mensch ein Studienobjekt, das uns bei sachkundiger Betrachtung Informationen vermittelt, die Lebenden zugutekommen können.
Gerät diese wissenschaftliche Distanz nie ins Wanken?
Es gibt zwei Einschränkungen zu dieser Aussage und sie sind persönlicher Natur oder beziehen sich auf persönliche Erfahrungen und Betrachtungen. Die erste betrifft den Umgang mit toten Kindern. Es gibt Menschen, die verständlicherweise sehr empfindsam sind bei Obduktionen von Kindern, insbesondere, wenn sie selber Kinder in vergleichbarem Alter haben. Ich hatte einen jungen Kollegen, der als vielversprechender Pathologe seine Ausbildung begann und der sein eigenes Kind im ersten Lebensjahr tragisch verlor. Er hat seinen Beruf aufgegeben beim Gedanken, ein Kind sezieren zu müssen.
Und der zweite Punkt …
Der zweite Grund, der viele vor dem Kontakt mit Leichen zurückschrecken lässt, ist die fortgeschrittene Verwesung. Als Pathologe hat man selten mit verwesten Leichen zu tun, weil die Verstorbenen aus dem Krankenhaus stammen und in der Regel in einem guten Erhaltungszustand sind. Ganz anders ist es in der forensischen Medizin. Die Untersuchung einer Leiche, die im Sommer einige Tage an einem Flussufer gelegen hat, erfordert zuweilen einen starken Magen und eine starke Konzentration, nicht durch die Nase zu atmen. Öffnet man dann im Seziersaal den Leichentransportsack, hüpfen einem Tausende von Maden und Fliegenlarven aus den zersetzten Geweben entgegen.
Ist Ihnen das passiert?
Ja, schon öfter. Diese Möglichkeit besteht immer, wenn man forensische Pathologie betreibt. Die Madenwürmer, die aus den verschiedenen Fliegenarten entstehen, haben einen wahnsinnigen Appetit und zerfressen den noch feuchten Organismus. Wenn sie plötzlich mit Licht und Wasser konfrontiert werden, wehren sie sich. Sie rollen sich zusammen, strecken sich, hüpfen richtig vom Tisch. Ein Gewöhnungseffekt stellt sich eher schleppend ein. Die Geruchsempfindung verfolgt einen noch für Tage trotz mehrfachen Duschens und Parfümübertünchung. Der Geruch, man kann ruhig von Gestank reden, kann stark variieren. Am eindringlichsten ist mir das Süßliche daran in Erinnerung geblieben.
Was war das Schlimmste, was Sie gesehen haben?
Das Wort „schlimm“ ist aus meiner Sicht nicht angebracht. Der Eindruck von Ekel, der sich bei starker Verwesung einstellt, kann gut verdrängt oder durch Konzentration beiseitegeschoben werden. Abgesehen davon gibt es heute Mittel gegen die Geruchsbelästigung, zum Beispiel stark riechende Cremes, die m...