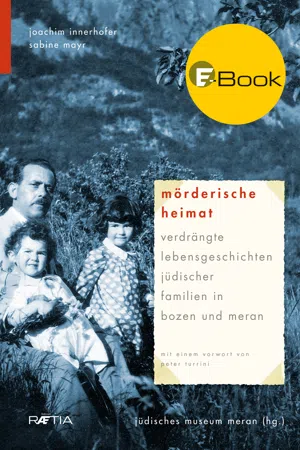![]()
Teil II
Rassisch verfolgt und deportiert
„Meran war 1933 die einzige Stadt Italiens, in der es zu antisemitischen Aktionen (Aufschriften, Anpöbelungen von Juden etc.) kam; es war dies sowohl eine Fernwirkung der NS-Machtergreifung in einer Stadt, in der es schon seit 1931 eine (aus reichsdeutschen Staatsbürgern bestehende) NSDAP-Ortsgruppe gab, als auch Ausdruck einer judenfeindlichen Einstellung gewisser Bevölkerungskreise Merans selbst“,1 beobachtet Leopold Steurer. So wirkten Turnerbund-Mitglieder in Meran entscheidend auf die Entstehung des Völkischen Kampfrings Südtirols ein. Die fatale Folge dieser antisemitischen Vorreiterposition war, dass die jüdischen Einwohner Merans zu den ersten Opfern der „rassischen“ Verfolgung durch die deutsche Besetzung in Italien wurden.2
Unter den Dokumenten über die Deportation der Juden aus Meran finden sich zusammenfassende Darstellungen, die sich auf die 1945 verfassten Berichte des Präfekturkommissars der jüdischen Gemeinde Walter Götz, des „Comitato Ricerche Deportati Ebrei“ in Rom, des „Comitato di Liberazione Nazionale Merano“ (CLN) und des „Counter Intelligence Corps“ (CIC) stützt, die gemeinsam mit Täter- und Tatbeschreibungen den Alliierten, dem Bozner und Meraner Gericht, der Präfektur, der Polizei und den Carabinieri zugesandt wurden, jedoch „ohne daß dies jemals irgendwelche Folgen für die Angeklagten gehabt hätte“, wie Federico Steinhaus später kommentiert3. Diese und weitere Dokumente wurden für die Rekonstruktion der „rassischen“ Verfolgungen in Südtirol ab September 1943 durch Federico Steinhaus, Cinzia Villani und Thomas Albrich herangezogen. Im September 1945 archivierte die Mitbegründerin des Kibbuz Lohamei Haghetaot Miriam Novitch für das Ghetto Fighters House in Israel Dokumente, in denen die NS-Verbrechen in Meran mit Täternamen aufscheinen.4
Laut „Storia della Persecuzione degli Ebrei nella Provincia di Bolzano“ hatte die jüdische Gemeinde in Meran in den Jahren vor 1938 circa 600 Mitglieder, von denen allein rund 400 in der Stadt Meran lebten. Dazu kommen die nichtreligiösen Einwohner Merans jüdischer Herkunft, die keinen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde hatten, und zum Katholizismus oder Protestantismus Konvertierte, die von den Maßnahmen der „Rassenschutzgesetzgebung“ genauso betroffen waren. Zusammen mit Kurgästen und Urlaubern, die oft auch länger in Meran blieben, wurden die assimilierten jüdischen Einwohner bis 1933 auf jährlich weitere 600 geschätzt. Federico Steinhaus ergänzt, dass 1931 die jüdische Gemeinde in Meran 332 Mitglieder hatte. Als der Modewarenhändler Illes Eisenstädter 1931 das Amt des Präsidenten der jüdischen Gemeinde übernahm, erkundigte er sich beim Meraner Podestà, dem Bürgermeister, nach der genauen Anzahl der jüdischen Einwohner des gesamten Triveneto. Zu dieser Zeit verzeichnete es für das Jahr 1931 1.293 Juden, von denen 1.114 eine ausländische Staatsbürgerschaft hatten.5
Der Reichsadler wird von der Meraner Postbrücke entfernt, dahinter die von Martin Szamatolski geleitete Merkur-Bankfiliale an der Winterpromenade.
Ab 1933 befanden sich in Südtirol zahlreiche deutsche und ab 1938 österreichische „nicht-arische“ Flüchtlinge, die – nach Bezahlung der 25 Prozent des Vermögens betragenden „Reichsfluchtsteuer“, der 25-prozentigen „Judenvermögensabgabe“, die ab 12. November 1938 galt, sowie weiterer fingierter Steuerrückstände und Schadenersatzleistungen – ihren gesamten Besitz zurücklassen mussten und gerade noch ihr nacktes Leben retten konnten. Am 22. August 1938 ließ das „Ufficio centrale demografico“ des italienischen Innenministeriums, das bald zur „Generaldirektion für Demografie und Rasse“ aufgewertet wurde, im Zuge der einsetzenden rassenpolitischen Gesetzgebung in Italien eine Zählung der in- und ausländischen „jüdischen“ Bevölkerung durchführen. Dabei wurden 58.142 in Italien lebende „Juden“ mit italienischer und ausländischer Staatsbürgerschaft gezählt. 48.032 „Juden“ schienen als italienisch auf.6 Eine weitere Zählung erfolgte mit dem „Zensus der ausländischen Juden“ Anfang September 1938, bei dem nur die ausländische „jüdische“ Bevölkerung Italiens erfasst werden sollte. Am 12. Oktober 1938 wurden die Ergebnisse der Zählung in Tageszeitungen, auch in „La Provincia di Bolzano“, veröffentlicht. Insgesamt wurden 938 Einwohner der Provinz Bozen von den faschistischen Behörden als „jüdisch“ erfasst, darunter waren 771 „direkt anwesende“ oder mutmaßliche „jüdische“ Einwohner Merans und 69 „jüdische“ Einwohner der Stadt Bozen. Wer es schaffte, diesen Zählungen durch die faschistischen Behörden zu entgehen, hatte bei den späteren Verfolgungen durch die Nationalsozialisten größere Überlebenschancen.7
„Die Meraner Kultusgemeinde hatte einen Zustrom von Glaubensgenossen aus Deutschland zu verzeichnen, nach den Jahren 1934/35,“ erläutert Heinrich Eisenstädter im Gespräch mit der Journalistin Elisabeth Gasser, die 1987 die Filmdokumentation „Im Zeichen Davids. Die jüdische Kultusgemeinde von Meran in Geschichte und Gegenwart“ erstellte. Eine internationale Hilfsorganisation hatte einen Fluchtweg über Meran nach Mailand organisiert. Einem Teil der in Meran gestrandeten Juden konnte zur Einreise in andere Länder verholfen werden, „und teilweise wurden die Leute im italienischen Reichsgebiet angesiedelt“.8
Am 12. September 1938 wurden die „Maßnahmen gegenüber den ausländischen Juden“ veröffentlicht. Es wurde verordnet, dass „ausländische Juden“, die nach dem 1. Januar 1919 nach Italien gekommen waren, Italien und seine Kolonien außer Abessinien binnen sechs Monaten verlassen mussten und allen „Juden“ die italienische Staatsbürgerschaft entzogen wurde, sofern sie diese nach dem 1. Januar 1919 erworben hatten. Der Historiker Klaus Voigt nennt etwas mehr als 11.000 aus dem Ausland nach Italien zugewanderte Juden, von denen etwa 9.000 Menschen Italien infolge des Ausweisungsdekrets bis zum 12. März 1939 verlassen mussten. Knapp die Hälfte der betroffenen 9.000 jüdischen Einwohner waren Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Machtbereich, für die Italien ein wichtiges Transitland für die Überfahrt nach Palästina, Schanghai oder Nord- und Südamerika geworden war.9 Zu ihnen gehörten Dorothea und Emil Humburger, die in der Wiener Berggasse 19 im selben Haus wie Sigmund Freud wohnten und deren Tochter Grete mit dem Schriftsteller Leo Perutz verheiratet war. Sie verließen Wien im Sommer 1938. Auf ihrem Fluchtweg nach Palästina machten sie zuerst in Bozen Halt, wo sie im Hotel Mondschein wohnten, und kamen schließlich bei ihrer Tochter Hedwig in Athen an, wo Dorothea Humburger starb. 1941 erreichte Emil Humburger schließlich Grete und Leo Perutz in Tel Aviv.10
Vom NS-Regime Verfolgte, die sich in Bozen und Meran aufhielten, wurden von einem Hilfskomitee der jüdischen Gemeinde in Meran unterstützt, bis selbst die letzten Mittel erschöpft waren. Sie waren den faschistischen Behörden zunächst sehr willkommen, da diese glaubten, auf diesem Weg die in Südtirol rasant zunehmende NS-Propaganda eindämmen zu können. Doch das Gegenteil war der Fall, der Antisemitismus nahm noch weiter zu.11
Am 14. Juli 1938 wurde das von Wissenschaftlern verfasste und von Mussolini redigierte „Manifesto della Razza“ veröffentlicht, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass es biologisch begründete Rassen gebe, die Italiener „Arier“ seien und die „Juden“ nicht zur italienischen Rasse zählten. Am 13. September 1938 veröffentlichte die „Gazzetta Ufficiale“ die „Maßnahmen zur Verteidigung der Rasse in der faschistischen Schule“ („Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista“), die alle „Juden“ aus den staatlichen und halbstaatlichen Schulen Italiens ausschlossen.12 Am 18. September 1938 verdeutlichte Mussolini in einer Rede in Triest seine neue Haltung gegenüber dem „Weltjudentum“, das plötzlich als ein „unversöhnlicher Feind des Faschismus“ dargestellt wurde, der angeblich schon „seit nunmehr 16 Jahren“ existiert habe.13
Am 17. November 1938 wurden in Italien die italienischen Rassengesetze unter der offiziellen Bezeichnung „Maßnahmen zur Verteidigung der italienischen Rasse“ („Provvedimenti per la difesa della razza italiana“) dekretiert, wobei die Tageszeitung „Dolomiten“ diese bereits am 12. November 1938 verkündet und bis ins letzte Detail erklärt hatte.14 Das Rassendekret definierte, wer als „Jude“ zu gelten habe: Wer von zwei jüdischen Elternteilen abstammte, auch wenn er sich zu einer anderen Religion bekannte, wer von einem jüdischen und einem ausländischen Elternteil abstammte, wer von einer jüdischen Mutter und einem unbekannten Vater abstammte und schließlich, wer sich mit nur einem jüdischen Elternteil zur jüdischen Religion bekannte, zu einer jüdischen Gemeinde gehörte oder irgendwelche „Bekundungen von Judentum“ („manifestazioni di ebraismo“) geäußert habe. Nicht als jüdisch galt, wer nur einen jüdischen Elternteil italienischer Eltern hatte und am 1. Oktober 1938 einer anderen als der jüdischen Religion angehörte.15 Das italienische Rassendekret sah vor, dass jüdische Bürger bis März 1939 auf dem Standesamt ihrer Gemeinde eine „Erklärung über ihre Rassenzugehörigkeit“ abgeben mussten. Es bestätigte nochmals, dass „ausländische Juden“ die Provinz Bozen innerhalb von sechs Monaten verlassen mussten, wobei über 65-Jährige und mit Italienern Verheiratete noch verschont blieben. Die „Maßnahmen zum Schutz der italienischen Rasse“ sahen ferner vor, dass Zuwendungen wie Heiratsdarlehen („Premi di natalità“), öffentliche Aufträge oder Baugenehmigungen an die „Erklärung, der italienischen oder arischen Rasse zuzugehören“, gekoppelt waren.
Wer den Behörden nun als „jüdisch“ galt und die italienische Staatsbürgerschaft besaß, konnte diese nur dann behalten, wenn sie vor dem Jahr 1919 erworben wurde. Allen „rassisch“ Verfolgten, welche die italienische Staatsbürgerschaft nach 1919 erhalten hatten, wurde diese nun entzogen. Wie der Großteil der Südtiroler Bevölkerung waren auch die meisten Meraner Juden vor 1919 österreichische Staatsbürger und erwarben die italienische frühestens ab 1922. Nach den Rassengesetzen galten sie nun nicht mehr als Italiener, ungeachtet der Tatsache, dass sie oft ihr gesamtes Vermögen in Südtirol oder anderen Provinzen Italiens investiert hatten. Der Entzug der Staatsbürgerschaft und des dadurch garantierten persönlichen Schutzes sowie die darauf folgende Ausweisung aus der Provinz Bozen wurden dann in der Nachkriegszeit noch einmal bestätigt. Die verfolgten jüdischen Kaufleute und Unternehmer, welche aufgrund glücklicher Umstände den NS-Terror überlebt hatten, ließ man in konsequenter Fortsetzung der Logik des Gesetzes von 1938 wissen: Als nunmehrige ausländische Staatsbürger hätten sie auf eine Entschädigung durch den italienischen Staat kein Anrecht.16 Allerdings wurde auch der Antrag des früheren Hotelangestellten, NSDAP-Angehörigen und SS-Mannes Erich Priebke, der mit Herbert Kappler am 24. März 1944 an der Erschießung von 335 Zivilisten in den Ardeatinischen Höhlen beteiligt war und 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, negativ beschieden. Priebke hatte im Mai 1944 einen Antrag auf Entschädigung für ein Depot in Bozen mit diversem Mobiliar und unter anderem zwei SS-Uniformen gestellt, das im Oktober 1943 durch einen Bombentreffer zerstört worden war.17 In Südtirol wurden im Zusammenhang mit dem Erlass der Rassengesetze Vorträge über das „Rassenprestige“ gehalten, bei denen betont wurde, dass die „italische Rasse“ von den Völkerwanderungen und Einfällen anderer Stämme wie etwa der Sarazenen nicht betroffen gewesen sei. Gleichzeitig wurden zahlreiche Menschen als „ausländische Juden“ aus der Provinz Bozen ausgewiesen. Das betraf deutsche, ehemals österreichische und polnische Einwohne...