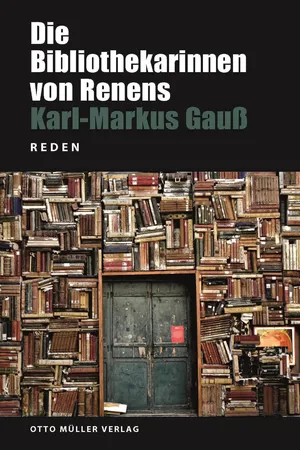![]() I
I![]()
Wider die europäische Ohnmacht
Die Lehre der kleinen Nationalitäten
Vor ein paar Jahren machte ich in den Vereinigten Staaten von Amerika eine merkwürdige europäische Erfahrung. In einem Provinznest in Connecticut hatten wir ein Motel bezogen, an dessen Swimmingpool von vormittags um zehn bis abends um zweiundzwanzig Uhr ein freundlicher Bursche mit schmalem Gesicht und rötlichem Haarschopf seinen Dienst versah. Er hatte darauf zu achten, dass niemand in dem drei mal drei Meter großen Becken ertrinke oder durch einen ungestüm ins Wasser springenden Rowdy verletzt werde. Er saß den ganzen Tag auf seinem Klappstuhl, studierte eifrig ein Wörterbuch, aus dem er sich einzelne Wendungen in ein Schulheft notierte, und hatte nicht viel zu tun, weil wir die einzigen Gäste und überdies vorsichtig genug waren, uns den Gefahren des Badevergnügens erst gar nicht auszusetzen.
Nachdem ich mehrmals an ihm vorbeigegangen war, stets mit einem aufmerksamen Kopfnicken bedacht, lag es nahe, an diesem menschenverlassenen, wie aus der Zeit gefallenen Ort ein paar Worte mit dem strebsam gelangweilten Bademeister zu wechseln. Es stellte sich heraus, dass er aus Albanien stammte, vor einem Jahr mit der Green Card ins Land gekommen war und bereits tüchtig daran arbeitete, seinen albanischen Traum von Amerika zu verwirklichen. Als er hörte, dass ich aus Österreich kam, begann er zu strahlen und es fehlte nicht viel, dass er mich umarmt hätte, so beglückt war er von der Tatsache, hier im Nordosten der Vereinigten Staaten einen Nachbarn zu treffen, einen neighbour, wie er sagte; fast so etwas wie einen Verwandten schien er in mir zu erblicken, zumindest aber einen Landsmann, dem man im Notfall beistehen und den man jedenfalls ein wenig ausfragen musste, wie sich die Dinge in der Heimat inzwischen entwickelt hatten.
Dass Österreich und Albanien Nachbarn seien, wird in Europa kaum jemand behaupten, aus der Ferne eines anderen Kontinents, der Distanz einer neuen Lebenserfahrung aber rücken unsere Länder zusammen. Der Bursche war sich keineswegs im Unklaren über die geographischen Gegebenheiten Europas, er sah sie jedoch, im Unterschied zu uns, die wir hier leben, in ihren großen Umrissen, und nahm den Kontinent, den er verlassen hatte, wie selbstverständlich als Ganzes. Er hatte völlig Recht, nur wir, die wir unsere Arbeit nicht in der Fremde suchen müssen, haben vergessen, wo wir eigentlich zuhause sind. Schon längst sind die Verklärer und die Verächter Europas, diese ungleichen Zwillinge, in die Minderheit geraten gegenüber jenen, die ihren Kontinent weder in gewohnheitsmäßiger Begeisterung zu rühmen noch leidenschaftlich angewidert zu verwerfen pflegen, die ihn vielmehr schlicht vergessen haben.
Die allgemeine und gleiche Amnesie ist aber ein fragwürdiges Menschenrecht. Wem das historische Bewusstsein, das ihm abgeht, gar nicht mehr abgeht, der wird kaum davon zu überzeugen sein, dass es zu den Begabungen des Menschen zählt, das Kommende vorauszuträumen, vorwegzunehmen und damit, paradox gesprochen, seine eigene Zukunft zu verändern. Dass Europa von den Europäern vergessen wurde, ist mehr als eine bittere Pointe auf die wirtschaftliche und politische Einigung ihrer Länder. Der Sinn für die Vergangenheit geht vielmehr zugleich mit dem Selbstvertrauen verloren, seine Zukunft auch selbst gestalten zu können. Wer sich und seine Existenz nicht in einem historischen, wenigstens in einem familiengeschichtlichen Zusammenhang zu verstehen vermag, dem kommt mit der Vergangenheit auch die Zukunft abhanden, er wird sie, wenn sie begonnen hat, und das ist immer schon morgen, stets als etwas erfahren, auf das er keinerlei Einfluss nehmen kann, als etwas Fremdes, das ihm vom Schicksal, von anonymen Mächten oder den längst geradezu mythisierten Brüsseler Bürokraten zugefügt wird. Auf die Idee, dass seine Zukunft auch von ihm selber abhänge, kann der gedächtnislose als der wahrlich ohnmächtige Mensch nicht kommen.
Kein Zweifel, „Europa“ stand bei den Europäern in höherem Ansehen, als noch der Eiserne Vorhang durch den Kontinent schnitt und ein jeder Staat seiner angemaßten Größe und vermeintlichen, in Wahrheit gerade damals erheblich reduzierten Souveränität verpflichtet war. Zu Zeiten des Kalten Krieges war Europa das Andere zur Enge des Nationalstaates, zur Borniertheit des Bündnissystems, zur Zwangsordnung der Volksdemokratien, zu den Gefahren von Wirtschaftskrisen und Kriegen. Fragt man die Europäer hingegen heute nach Europa, nach der Union, fühlt man sich angesichts von so viel Ahnungslosigkeit in eigenen Angelegenheiten betrüblich an die Weisheit der Kabbala erinnert, die da lehrt, dass „das Unwissen des Unwissenden das Wissen des Wissenden übertrifft, weil der Wissende nie so viel weiß, wie der Unwissende nicht weiß“.
Dass die Europäer sich kaum für Europa interessieren, kann man larmoyant beklagen oder mit bitterem Hohn kommentieren: die Schuld wird beide Male dem dummen Volk zugewiesen, das unfähig wie unwillig sei, sich dem rasanten ökonomischen Wandel anzupassen und die neuen Möglichkeiten zu nützen, die sich ihm in einem Europa bieten, das dem Tüchtigen und dem Neugierigen so viele Grenzen und Begrenzungen aus dem Weg geräumt hat. Solche Kritik ist billig und hilflos zugleich. Wichtiger wäre es zu fragen, warum uns das Interesse für uns selber, für die nächsten und für die ferneren Nachbarn, sagen wir: die albanischen Landsleute abhanden gekommen ist – ein Interesse, das viele durchaus verspürten, solange Europa ein Versprechen, keine Realität war. Natürlich hat es mit einer Erfahrung der Ohnmacht zu tun, und wir werden keiner Generation weltoffener und begeisterter, aufbruchsbereiter und selbstbewusster Europäer den Weg gebahnt haben, bis dieses lähmende Gefühl der Ohnmacht nicht beseitigt ist. Doch hören wir nicht alle Tage, dass die Menschen ihre Geschichte nicht selber machen, sondern dass es der Zwang der Sachen, die unentrinnbare Logik der ökonomischen Entwicklung, die wie theologische Dogmen anerkannten Gesetze des Marktes sind, die uns gar keine Entscheidung lassen? Werden wir nicht alle Tage belehrt, dass wir uns dem Sog der globalen Modernisierung nur bei Strafe des Untergangs entziehen können und es nicht darauf ankommt, was wir, auch in europäischen Angelegenheiten, für richtig halten, sondern ob wir uns unaufhaltsamen Prozessen so flexibel und willfährig wie möglich anzupassen bereit sind?
Wie sollte, da die Europäer aller Länder darin unterwiesen werden, dass mit der europäischen Einigung eine Dynamik entfesselt wurde, der sie sich zu ihrem eigenen Nutzen nur ergeben können, das Selbstbewusstsein wachsen, dass sie, diese Hunderten Millionen, an ihrem eigenen Schicksal etwas ändern können? Nur dann aber könnte aus diesem Europa ihr Europa werden. Wer Ohnmacht lehrt, kann nicht demokratisches Engagement erwarten.
Ich weiß nicht, woher es rührt, dass ich schon in meiner Jugend von den kleinen, den randständigen europäischen Nationalitäten so fasziniert war; ich weiß nicht, wann und warum ich schon als junger Mensch auf die Minderheiten gekommen bin, die es auf keinen eigenen Staat gebracht noch einen solchen in ihrer Geschichte je angestrebt haben. Ich weiß aber, dass ich bei ihnen, bei den Aromunen in Mazedonien und in Griechenland, den Sorben im Osten Deutschlands, bei den Karaimen in Litauen, den Zimbern im Gebirge Norditaliens, den Kaschuben in Polen, den Ruthenen der Ostslowakei und der Westukraine, den versprengten Deutschen Bessarabiens, dass ich bei diesen und anderen Minderheiten ein Europa gefunden habe, ohne das mir das prächtige und mächtige Europa, wie es sich zuerst wirtschaftlich zusammengeschlossen hat und nun endlich auch politisch zu formieren beginnt, ärmer und unvollständig erschiene. Die kleinen, kulturell immer um ihr Überleben kämpfenden Nationalitäten, die oft missachteten, im besten Falle mit paternalistischem Wohlwollen betrachteten Minderheiten gelten häufig als sympathische oder renitente Überbleibsel einer Welt von gestern. Doch war und ist es keine völkische Romantik, nicht die Liebe zum imaginären Museum, in dem die sterbenden Europäer ausgestellt werden, was mich an ihnen fasziniert und, ja, zunehmend bewegt und begeistert hat. Vielmehr gehört dieses Wissen zu ihren historischen Ur-Erfahrungen: dass man nur dann eine Zukunft hat, wenn man sich in seiner Gegenwart nicht in beflissener Gedächtnislosigkeit zu behaupten versucht.
Minderheiten können nämlich nur überleben, wenn sie sich ihre Vergangenheit, ihre Herkunft, die Bedrängnisse und Niederlagen ihrer Vorfahren, ihren Kampf um Selbstbehauptung immer wieder und neu vergegenwärtigen. Verlieren sie die kollektive Erinnerung, das Interesse dafür, wie sie zu dem wurden, was sie sind, haben sie schon verloren. Das Gefühl der Ohnmacht können sie sich einfach nicht leisten, sie müssen daran glauben, dass es nicht allein von ihren Gegnern und auch nicht von global wirksamen Strukturen abhängt, ob es sie auch weiterhin geben wird, sondern von ihrer Leidenschaft, ihrem Beharren, ihrem Stolz.
Natürlich bin ich auf den Reisen zu den anderen, den unbekannten, den randständigen Europäern auch auf Borniertheit, auf den narzisstischen Stolz gestoßen, der die kleinen Unterschiede groß und heilig sprechen möchte. Aber viel öfter bin ich Menschen begegnet, die so frei waren, nicht einer Nationalität alleine zuzugehören, sondern sich gewissermaßen als national und kulturell multiple Persönlichkeiten zu entwerfen. Die Arbëreshë, um jetzt nur sie für viele andere Minderheiten zu erwähnen, die Arbëreshë Kalabriens sind über ein halbes Jahrtausend Albaner geblieben, sie haben sich die Sprache, die sie nach Italien mitnahmen, nicht nehmen lassen, und auch nicht bestimmte religiöse und kulturelle Besonderheiten; aber sie sind zugleich Italiener geworden, wenngleich es schon ziemlich lange her ist, dass Garibaldi ihren italienischen Patriotismus und ihre Tapferkeit im italienischen Einigungskampf rühmte, und es dann sehr lange, beschämend lange dauerte, nämlich bis ans Ende des 20. Jahrhunderts, dass sie in Italien als Minderheit auch anerkannt wurden.
Sie sind Albaner und Italiener – und sie sind Europäer, wie ich sie mir denke: Als ich sie in ihren Dörfern im Gebirge besuchte, lernte ich bei ihnen einen Sozialcharakter kennen, den es gemäß fortschrittlicher Doktrin gar nicht geben kann, nämlich den weltoffenen Hinterwäldler, den weit gereisten Provinzler, den aufgeklärten, freigeistigen Verfechter uralter Traditionen und Sitten. Die Arbëreshë sind selbstbewusste Europäer, und nicht nur einmal wurde ich von ihnen auf einen bemerkenswerten Sachverhalt aufmerksam gemacht, dass nämlich all die schmucken Heimatmuseen, die sie in den letzten Jahren errichtet haben, nicht etwa den Hinweis tragen, dass dieses Museum, jenes Kulturhaus von der Region Kalabrien und der italienischen Regierung gefördert wurde. Nein, all diese für die Arbëreshë so wichtigen Stätten, in denen sie einander und ihrer Geschichte begegnen können, sind von den Arbëreshë selber gebaut – und im Sprung über den italienischen Nationalstaat hinaus gleich mit Mitteln der Europäischen Union gefördert worden.
Sie werden sich fragen: Wohin zielt diese Rede, die bei einem jungen Albaner beginnt, der in Amerika die Österreicher für Landsleute hält, und zu den Arbëreshë im Gebirge Kalabriens führt, die sich widerspenstig ihre Eigenheiten bewahren und doch für alles Neue, das Europa zu bieten hat, offen sind? Nun, ich möchte Ihre Geduld nicht über Gebühr beanspruchen, sondern abrupt mit einem Bekenntnis enden: Ich glaube, dass uns der Blick aus der Ferne manchmal einfache Dinge, die wir vergessen haben, in Erinnerung rufen kann – und ich bin überzeugt davon, dass die kleinen Nationalitäten, die von alters her schon um ihres eigenen Überlebens willen die alltägliche Grenzüberschreitung praktizierten, nicht die romantische Nachhut, sondern vielmehr die Avantgarde jenes Europa sind, das erst entsteht. Gerade darum gilt es sie zu respektieren und zu studieren; und zu begreifen, dass Europa, das viel gepriesene, viel geschmähte, von dem wir oft am liebsten schon gar nichts mehr hören wollen, immer noch Terra incognita ist.
Rede zum Kongress „Evropa, svet in humanost v. 21. Stoletju. Dialog kulturi – dialog med kulturami“ (Europa, die Welt und die Menschheit im 21. Jahrhundert. Kultur des Dialogs – Dialog zwischen den Kulturen), gehalten in Ljubljana am 9. April 2008 im Grandhotel Union
![]()
Die Roma und wir
Zum Internationalen Tag der Roma
1
Im Sommer 2014 war ich einige Wochen in Bulgarien unterwegs, einem Land, reich an landschaftlicher Schönheit und mit herzergreifend armen Landstrichen, die aussahen, als wären sie von ihren Bewohnern verlassen worden. Fast kam mir vor, die einzigen, die ihren Weilern, Dörfern, kleinen Städten die Treue gehalten und geblieben waren, wären die Roma gewesen. Ich habe es in Bulgarien mit hilfsbereiten und aufgeklärten Menschen, mit nationalen, liberalen, konservativen, sozialistischen Leuten zu tun bekommen, aber den Eindruck gewonnen, das Einzige, was sie alle noch eint, das ist die gemeinsame Verachtung der Roma. Was die Roma auch tun, ob sie betteln oder die Straßen fegen, als Tagelöhner auf dem verödeten Land ihr karges Auskommen finden oder in den Städten zu einigem Wohlstand gekommen sind: man wirft es ihnen immer vor, ihre Armut und ihren Wohlstand, ihre Randständigkeit und ihren Erfolg. Sind sie arm, gelten sie für faul, schuften sie bei der Müllabfuhr, dann haben sie diesen Posten nur dank der unablässigen Bemühung der Kommunen ergaunert, sie vom Stehlen ab- und zur Arbeit anzuhalten; sind gerade keine von ihnen in der Innenstadt zu sehen, sitzen sie sicher irgendwo in ihren dreckigen Siedlungen und hecken Böses aus, geht einer von ihnen gut gekleidet mit einer Aktentasche vorbei, dann handelt es sich natürlich um einen Ganoven, der seinen Status dem Verbrechen verdankt.
Was für Bulgarien gilt, das ist in den allermeisten Ländern, die einst dem Ostblock zugehörten, nicht besser. Wer sich darüber wundert oder gar ärgert, dass in den letzten Jahren so viele Roma aus dem Osten aufgebrochen sind und in unseren schmucken Städten durch ihren schieren Anblick den Wohlstandsfrieden stören, der hat keine Ahnung, was in dem Teil Europas geschieht, aus dem sie sich auf den Weg gemacht haben. Was aber erwartet sie im anderen Teil, im Westen? Von Skandinavien bis Griechenland suchen die nationalen Regierungen nach Möglichkeiten, wie sich den Roma als einzigen Europäern das Recht, innerhalb der Europäischen Union ihre Freizügigkeit durchzusetzen, absprechen ließe. Wer aber den Roma, und nur ihnen, durch nationale Zusatzregelungen kollektiv Rechte verweigert, die zu den Rechten aller Bürger der europäischen Union gehören, der mag in politischen Sonntagspredigten noch so fromm vor dem Rassismus warnen, er ist doch dabei, über die größte europäische Minderheit im Reichsgebiet der Union die Apartheid zu verhängen. Es ist der Pesthauch von „Sondergesetzen“, der aus diesen Bemühungen weht, Sondergesetzen, die nur für eine einzige Volksgruppe gelten und über die in der Geschichte immer schon mittels Entrechtung der Weg zur Verfolgung frei gemacht wurde.
2
Kann man also, wenn über die Situation der Roma gesprochen wird, nur von Elend und Verfolgung und von sonst gar nichts berichten? Keineswegs. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass sich noch niemals so viele Menschen so sehr für die Roma interessiert haben wie jetzt. Und wer etwas über die Roma erfahren, mehr von ihnen und ihrer Geschichte wissen will, der hat heute wahrlich genügend Möglichkeiten, sich kundig zu machen. In den letzten Jahren hat die wissenschaftliche Beschäftigung mit so vielen Aspekten der Geschichte, Kultur, Sprache der Roma ein Niveau erreicht, das vor zwei, drei Jahrzehnten noch kaum vorstellbar war. Überall haben sich zudem gesellschaftliche Gruppen gebildet, die die Roma unterstützen, über ihre prekäre Lage von heute unterrichten, aber auch über Geschichte und Kultur der Roma informieren. Und nicht zuletzt hat die Europäische Union etliche Forderungen erhoben und Ziele formuliert, die ausdrücklich auf die Integration der Roma in die europäische Gesellschaft abzielen.
Das alles wäre jedoch für nichts, wenn in den letzten fünfzig Jahren nicht etwas viel Wichtigeres geschehen wäre: Wenn sich nämlich nicht überall die Roma selbst zu ihrem Wort gemeldet hätten. Heute gibt es in jedem europäischen Land eine Vielzahl von Organisationen, in denen die Roma ihre Sache in die eigenen Hände nehmen, Aufklärung und Hilfe bieten und im Übrigen zunehmend selbstbewusst nicht nur das Elend anprangern, sondern auch von interessanten Initiativen, gelungenen Projekten, von vielerlei Erfolgen berichten. Gleichwohl ist mit Blick auf ganz Europa zu sagen, dass Millionen Roma in äußerst schwierigen Verhältnissen leben – und dass wir doch im selben historischen Zeitpunkt dank der Selbstorganisation der Roma und der Arbeit von Wissenschaftlern, Künstlerinnen, Menschenrechtsaktivisten, ob sie nun eine Roma-Herkunft haben oder nicht, heute viel mehr von deren Kultur wissen als früher, dass wir diese Kultur besser in ihren Eigenheiten und in ihren Zusammenhängen mit der Kultur der Nicht-Roma verstehen, ihren Reichtum erkennen, über ihre Vielfalt staunen können.
3
Wo immer Roma sich ihrer Rechte besannen und ihre gerechten Ansprüche erhoben, hat es mit der Erinnerung angefangen, mit der persönlichen und der kollektiven Erinnerung. Mit der persönlichen Erinnerung einzelner Roma und Romnija, die sich daran erinnerten, wie ihre Eltern und Großeltern, wie sie selbst gelebt und überlebt haben und die Zeugnis davon geben wollten; mit der kollektiven Erinnerung kleiner und großer Gruppen, die sich ihrer Traditionen versicherten und an das Leid erinnerten, das ihnen und ihren Leuten angetan worden war. Um sich selbst in der Gegenwart zu behaupten und gegenüber den Gesellschaften von heute Forderungen erheben zu können, mussten die Roma und Romnija also zuerst ihre eigene Vergangenheit entdecken.
Nun trifft aber auch auf die Roma zu, was für uns alle gilt: Vergangenheit haben wir, Geschichte müssen wir uns erst erschaffen. Dieser Prozess vollzieht sich niemals simpel wie von selbst, im Falle der Roma aber ist er besonders kompliziert: Hatten viele von ihnen durch Missachtung und Verfolgung doch gelernt, sich mit dem, was vergangen war, nur im Geheimen, im Kreis der Familie zu beschäftigen und in der Öffentlichkeit tunlich oft sogar zu verbergen, dass sie überhaupt Roma waren. Wo der Nachweis, einst verfolgt worden zu sein, üblicherweise mit dem Anrecht einhergeht, als Opfer anerkannt, rehabilitiert oder gar entschädigt zu werden – entschädigt mit ...