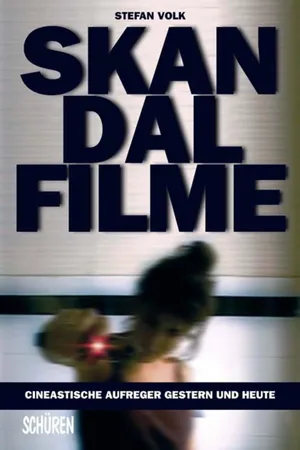![]()
Von den Anfängen bis 1949
Den Kinogegnern der ersten Stunden hätte die Rede vom «Skandalfilm» wohl wie eine Tautologie erscheinen müssen. Der Skandal steckte für sie im Film automatisch mit drin. Kinematographie galt ihnen als Jahrmarktsschund, eine Sensation für den Pöbel, kulturell minderwertig und verderblich dazu. Hinter den bewegten Bildern vermuteten sie eine suggestive Kraft, die sie als bedrohlich empfanden. Es kursierten Berichte von mehr oder weniger schockierenden Nachahmungstaten. Ein Junge jagte sich angeblich mit dem väterlichen Revolver eine Kugel in den Kopf, als er eine Filmszene nachspielte.1 Ein anderer schmierte einem 10-jährigen Mädchen trockenes Farbpulver ins Gesicht. Auch daran sollte das Kino, diese «Schule des Verbrechers»2 schuld sein.3 Es stellten sich Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Rezeption und Ausübung von Gewalt, die an die Debatten um Amokläufe und Killerspiele erinnern und bis heute nicht vollständig beantwortet sind.
«Wie schützen wir die Kinder vor den schädlichen Einflüssen der Theater lebender Photographie?» fragte sich 1907 eine Kommission, die der Hamburger Lehrerverein «Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens» ins Leben gerufen hatte.4 Ein mögliches Mittel zu diesem «Schutz» war die Film-Vorzensur, die am 5. Mai 1906 in Berlin durch einen Erlass des Berliner Polizeipräsidenten erstmalig eingeführt worden war. Vorausgegangen waren dieser Polizeiverordnung mehrere Filme, die über das ohnehin Skandalöse des Mediums hinaus für Aufregung sorgten, weil sie die Polizei kritisierten oder sich über sie lustig machten. Gegenstand der Filme war ein zeitgenössischer Kriminalfall: die Geschichte des Raubmörders Rudolf Hennig und seiner spektakulären Flucht vor der Berliner Polizei. Der bekannteste dieser Filme war Gustav Schönwalds (1868–1919) DIE FLUCHT UND VERFOLGUNG DES RAUBMÖRDERS RUDOLF HENNIG ÜBER DIE DÄCHER VON BERLIN (1905). Wenn man so will, war dieser circa 100 Meter kurze, von der «Internationalen Kinematograph- und Lichtbild-Gesellschaft» in Berlin hergestellte Streifen der erste Skandalfilm der deutschen Filmgeschichte.
Hennig war mittlerweile gefasst worden, als das Berliner Polizeipräsidium am 13. April 1906 ein Vorführungsverbot über alle «auf künstlichem Wege hergestellten Darstellungen von Hennigs Mordtat und seiner Flucht» verhing, weil darin die Polizei verunglimpft und in ein schwebendes Verfahren eingegriffen werde. Das Verbot wurde zwar bereits am 18. April wieder aufgehoben. Gleichzeitig aber wurde für die Zukunft Vorsorge getroffen. Am 5. Mai, vier Tage nachdem Hennig zum Tode verurteilt worden war, führte der Berliner Polizeipräsident die Vorzensur ein. Kinobesitzer mussten ihr Programm fortan im Polizeipräsidium einreichen. Filme konnten zur Vorführung «freigegeben» oder «verboten» werden oder auch in die Kategorie «verboten für Kinder» fallen. Auch Schnittauflagen konnten als Voraussetzung für eine Freigabe verhängt werden.5
Deutschlandweit fand der Berliner Erlass Nachahmer, und Filmprüfstellen wurden eingerichtet. Die Filmzensur wurde in den kommenden Jahren zunehmend vereinheitlich und systematisiert. Doch erst mit dem Ministerialerlass vom 30. April 1912 und seiner Präzisierung im Juli 1912 konnte zumindest für Preußen von einer einheitlichen Filmzensur unter dem Dach der Polizeibehören gesprochen werden.6
Diese Situation änderte sich grundlegend nach Ende des 1. Weltkrieges in der Übergangsphase vom Kaiserreich zur Weimarer Republik als der «Rat der Volksbeauftragten» am 12. November 1918 die Zensur abschaffte. Im Artikel 118 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 wurde diese Zensurfreiheit zwar prinzipiell bestätigt, gleichzeitig jedoch potenziell eingeschränkt: «Eine Zensur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen werden. Auch sind zur Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur sowie zum Schutze der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen gesetzliche Maßnahmen zulässig.» Eine solche «abweichende Bestimmung» erfolgte am 12. Mai 1920 mit dem 1. Reichslichtspielgesetz.
In den 18 Monaten aber, die zwischen der Abschaffung der Filmzensur und ihrer Wiedereinführung lagen, traf die Kunstfreiheit in Deutschland auf eine durch die Erfahrungen des verlorenen Krieges hochgradig verunsicherte, inhomogene Gesellschaft mit in weiten Teilen dennoch unverändert strikten Moralvorstellungen. Das ideale Klima für Skandalfilme. Eine Welle von Aufklärungs-, Sitten- und Animierfilmen, auf die im Zusammenhang mit dem Skandal um Richard Oswalds ANDERS ALS DIE ANDERN (1919) noch näher eingegangen wird, ergoss sich über die Lichtspielhäuser und wurde von ihren Gegnern mit einer Gegenwelle wutschäumender Empörung beantwortet. Kinokritiker, die sich in ihrem Kampf gegen den «Schundfilm» ereiferten, unterschieden oft kaum noch zwischen ernstgemeinter und nur geheuchelter Aufklärung über Themen wie Prostitution, Ehebruch, Geschlechtskrankheiten, Homosexualität, Abtreibung oder Mädchenhandel. Einmal mehr drohte das Kino per se als Hort der Unmoral diffamiert zu werden. In einem Bericht an das Reichsinnenministerium fasste die «Kölner Volksgemeinschaft zur Wahrung von Anstand und guter Sitte» ihre Erfahrungen aus dem Besuch von 36 Lichtspieltheatern 1920 folgendermaßen zusammen: «Was zunächst die Zuschauer betrifft, so stammten diese in überwiegender Zahl aus Arbeiterkreisen. Die besseren Bürgerfamilien und die Gebildeten scheinen das Kino gänzlich zu meiden. […] Viele Frauen, oft mit kleinen Kindern, meist ohne Begleitung ihrer Männer, waren zu bemerken, auch manchmal mit Männern, die wohl nicht ihre Ehemänner sind. […] Vielfach wurden auch junge Pärchen aus dem Arbeiterstand beobachtet, die sich in nicht ganz einwandfreier Weise auf den weniger beleuchteten Plätzen benahmen. […] Ausgesprochene Straßendirnen, die in ihrem Benehmen sofort erkennbar waren, suchten hier ihre Opfer.»7
Und wenn die «besseren Bürgerfamilien» dann doch einmal ins oder vors Kino gingen, dann, so schien es beinahe, um gegen die «unsittlichen Zustände» zu demonstrieren, zu pfeifen und ihr Geld zurückzuverlangen. Allerorten kam es zu Zwischenfällen und öffentlicher Empörung. Selbst liberale Zeitgeister wie Kurt Tucholsky alias Ignaz Wrobel entrüsteten sich: «Inzwischen bilden die Leute Queue, wenn Parvus Rehwiese8 wieder einen Paragraphen des Strafgesetzbuches verfilmt hat (es stehen noch aus: § 176,3 – wer mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt…; § 177 – Notzucht; § 183 Öffentliche Erregung eines geschlechtlichen Ärgernisses; und nur der § 184 ist vor dem Filmisten sicher, weil er selber drunter fällt: Verbreitung unzüchtiger Schriften.) Die Leute also stehen vor der Kasse bis auf die Straße, unser Mahnruf wird da auch nichts helfen, und es bleibt schon bei unserm guten alten Spruch: Jeder seins.»9
Es blieb nicht dabei. Am 12. Mai 1920 trat das Lichtspielgesetz in Kraft, das die öffentliche Vorführung von Filmen nur noch erlaubte, wenn sie zuvor von «amtlichen Prüfungsstellen» zugelassen wurden. Diese Filmprüfstellen, die anschließend in München und Berlin eingerichtet wurden, hatten in erster Instanz die Zulassung zu versagen, wenn «die Vorführung eines Bildstreifens geeignet» schien, «die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gefährden, das religiöse Empfinden zu verletzen, verrohend oder entsittlichend zu wirken, das deutsche Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands zu auswärtigen Staaten zu gefährden». Der große Spielraum, den die Zensoren aufgrund dieser allgemein gehaltenen und vage formulierten Verbotsgründe erhielten, sollte durch die von der SPD und DDP durchgesetzten «Tendenzklausen» wieder etwas eingeschränkt werden. Danach durfte ein Film «wegen einer politischen, sozialen, religiösen, ethischen oder Weltanschauungstendenz als solcher» nicht verboten werden. Das Lichtspielgesetz legitimierte damit eine Wirkungszensur, die sich nicht am Geschmack der Zensoren oder reinen Inhalt des Filmstreifens zu orientieren hatte, sondern an der von ihm ausgehenden Wirkung. Diese wiederum musste ihren Ursprung im Film selbst haben. Aus «Gründen, die außerhalb des Inhalts des Bildstreifens liegen», durfte einem Film die Zulassung nicht verweigert werden. Filmen, «bei denen die Gründe der Versagung der Zulassung nur hinsichtlich eines Teils der dargestellten Vorgänge zutreffen», konnte die Prüfstelle Schnittauflagen für eine Zulassung erteilen. Für eine Zulassung zur Vorführung vor Jugendlichen musste zusätzlich «eine schädliche Einwirkung auf die sittliche, geistige oder gesundheitliche Entwicklung oder eine Überreizung der Phantasie der Jugendlichen» ausgeschlossen werden können. Kinder unter sechs Jahren war der Kinobesuch nicht erlaubt.
Das Lichtspielgesetz erfuhr mehrere Novellierungen; eine davon als Reaktion auf den von den Nationalsozialisten provozierten Skandal um IM WESTEN NICHTS NEUES (1930). Im Oktober 1931 wurde per Notverordnung ein weiterer Verbotsgrund in das Gesetz aufgenommen. Eine Zulassung war demnach auch dann zu versagen, wenn «lebenswichtige Interessen des Staates» gefährdet wurden. Gegen eine Zulassung durch die Prüfstelle, die jeweils für das gesamte Reichsgebiet galt, konnten die Länder Widerspruch einlegen. Auch konnte der Vorsitzende der Prüfstelle oder, im Fall eines Verbotes, die betroffene Filmproduktionsfirma Beschwerde gegen den Entscheid einlegen. In letzter Instanz entschied jeweils die Filmoberprüfstelle in Berlin über die Zulassung des Films. Sowohl die Kammern der Prüfstellen als auch die Oberprüfstelle setzten sich aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern zusammen, von denen «einer dem Lichtspielgewerbe und zwei den Kreisen der auf den Gebieten der Volkswohlfahrt, der Volksbildung oder der Jugendwohlfahrt besonders erfahrenen Personen zu ent...