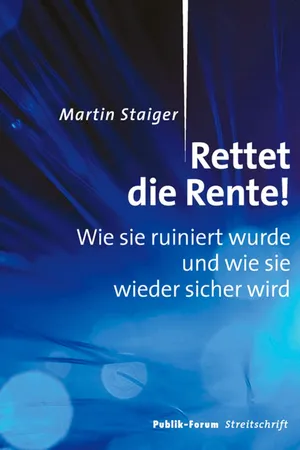
- 112 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Sinkende Renten und wachsende Altersarmut sind keine Naturkatastrophen. Sie sind Folgen einer Politik, der das Wohl von Banken und Versicherungen wichtiger ist als das Wohl älterer Menschen. Diese Politik gibt vor, für die Jüngeren zu handeln, und stiehlt dabei allen Generationen die Zukunft.Im vorliegenden Buch entlarvt der Rentenexperte Martin Staiger die Mythen und Interessen einer Rentenpolitik, die sich als alternativlos darstellt. Und schildert dann realistische Alternativen, damit alle im Alter gut leben können.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Rettet die Rente! by Martin Staiger in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economics & Political Economy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Über dieses Buch
Sinkende Renten und wachsende Altersarmut sind keine Naturkatastrophen. Sie sind Folgen einer Politik, der das Wohl von Banken und Versicherungen wichtiger ist als das Wohl älterer Menschen. Diese Politik gibt vor, für die Jüngeren zu handeln, und stiehlt dabei allen Generationen die Zukunft.
Im vorliegenden Buch entlarvt der Rentenexperte Martin Staiger die Mythen und Interessen einer Rentenpolitik, die sich als alternativlos darstellt. Und schildert dann realistische Alternativen, damit alle im Alter gut leben können.
Über den Autor

Martin Staiger, geb. 1967 in Stuttgart, studierte Theologie und Sozialarbeit an den Hochschulen Tübingen, Bochum, Heidelberg und Ludwigshafen, war lange als Schuldnerberater tätig und arbeitet inzwischen als freier Journalist und Autor (Schwerpunkte Sozialpolitik und Sozialrecht). Martin Staiger ist außerdem in der Fortbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern tätig und ist Lehrbeauftragter für Sozialrecht der Hochschulen Ludwigsburg und Darmstadt. Er lebt mit seiner Familie in Esslingen.
Für Johanna
Persönliches Vorwort
Als ich kürzlich in einem Erwerbslosen-Treff über das Thema Arbeitslosengeld II sprach, fragte ein Teilnehmer, was er als Hartz-IV-Bezieher für seine Rente tun könne. Obwohl die Frage rechtlich einfach zu beantworten war, zögerte ich. Schließlich gab ich ihm doch die gewünschte Auskunft. Wer Hartz IV bekommt, hat die Möglichkeit, eine Riester-Rente abzuschließen, und erhält bei einem monatlichen Eigenanteil von fünf Euro ein Mehrfaches an Zulagen, die ebenfalls in den Riester-Rentenvertrag fließen.
Warum habe ich gezögert? Für einen Hartz-IV-Bezieher kann es im Hinblick auf seine Altersversorgung wichtig sein, ob er einmal Zahlungen aus einer Riester-Rente bekommt oder nicht. Für die Gesellschaft jedoch ist jeder Euro, der aus Steuergeldern in eine Riester-Rente fließt, ein verlorener Euro, der in der gesetzlichen Rentenversicherung viel besser und effizienter aufgehoben wäre. Noch teurer als die Riester-Renten von Hartz-IV-Bezieherinnen und -Beziehern sind die Riester-Renten von Erwerbstätigen. Millionen Riester-Renten verschlingen Milliarden an Steuergeldern. Durch Teile des Arbeitslohns gespeiste Betriebsrentenverträge, für die sich die Bezeichnung »Entgeltumwandlung« eingebürgert hat, kosten den Fiskus und die Sozialkassen weitere Milliarden. Sie senken außerdem über komplizierte gesetzliche Mechanismen die Renten aller ab und machen die Altersversorgung in einem ungesunden Maß vom Kapitalmarkt abhängig. Die Bildung von Eigentum, das nach Artikel 14 des Grundgesetzes dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll, gereicht so der Allgemeinheit zum Schaden, ermöglicht durch die Sozialgesetzgebung selbst.
Wer nicht mitmacht und sich der Vorsorge am Kapitalmarkt verweigert, dem kommt zwar das Verdienst zu, die gesetzliche Rentenversicherung stabilisiert zu haben. Er oder sie wird jedoch unter Umständen im Alter mit einer geringen Rente oder sogar mit Armut bestraft. Unter der momentanen Rechtslage ist dieses Dilemma, in dem jeder und jede Einzelne steht, nicht auflösbar. Es zeigt jedoch besonders eindrücklich, dass die seit Langem propagierte Überlegenheit der Eigenverantwortung gegenüber der sozialstaatlich organisierten Alterssicherung ein Märchen ist, erzählt von denjenigen, die daran verdienen. Dieses Buch schildert, wie das Märchen entstanden ist und warum es sich bis heute hält. Es will alle Interessierten ermutigen, an einer menschen- und gesellschaftsfreundlicheren Lösung der Rentenfrage mitzuarbeiten.
»Die Renten sind sicher«
Die gesetzliche Rentenversicherung in der alten Bundesrepublik
»Die Renten sind sicher.« Dieser Satz von Norbert Blüm steht für den Anspruch der Rentenpolitik bis in die 1990er-Jahre – und er wurde zur Lachnummer der Klamauksendungen, als die Rentenversicherung Schritt für Schritt demontiert und damit die Rente von Jahr zu Jahr immer unsicherer wurde. Die Renten waren zwar nie ganz sicher, aber für einige Jahrzehnte konnte dieser Satz im Großen und Ganzen Gültigkeit beanspruchen. Bis vor etwa zwanzig Jahren verfolgten in seltener Einmütigkeit zumindest CDU, CSU und SPD – sowie auch die in den 1980er-Jahren neu aufkommenden Grünen das Ziel, sichere Renten zu garantieren. In Rentenfragen wurde zumindest zwischen den damals großen Parteien meist ein Konsens erzielt – zuletzt 1989, als CDU, CSU und SPD knapp eine Stunde vor Öffnung der Berliner Mauer gemeinsam die Rentenreform 1992 beschlossen, die allerdings bereits die ersten Rentenkürzungen vorsah.
Seit Bundestag und Bundesrat auf Initiative des damaligen Kanzlers Konrad Adenauer die Rentenreform 1957 beschlossen hatten, war der Generationenvertrag über mehrere Jahrzehnte nahezu unumstritten. Seit 1957 werden die Renten über das Umlageverfahren bezahlt. Das heißt, sie werden paritätisch durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge finanziert, ohne dass die gesetzliche Rentenversicherung nennenswerte Rücklagen bildet. Nach zwei Währungsreformen innerhalb von nicht einmal dreißig Jahren, bei denen große Teile des Sparvermögens wertlos wurden, überzeugte dieses Konzept die Mehrheit der Bevölkerung sowie auch die Mehrheit der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände. Die Idee der dynamischen Rente, die für die Teilhabe der Rentnerinnen und Rentner am wachsenden Wohlstand sorgte, war weitgehend unumstritten. Die sozialpolitische Funktion der Rente war es, den im Berufsleben erreichten Lebensstandard im Alter zu sichern.
Unter ethischem Blickwinkel galt die Rente als ein verdienter Lohn für die Lebensleistung. Unter volkswirtschaftlichem Aspekt diente sie als ein wichtiger Pfeiler der Binnennachfrage, der insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Konjunktur stützte. Die nach dem Krieg grassierende Altersarmut verschwand nahezu; die Rentnerinnen und Rentner hatten am wachsenden Wohlstand teil. Obwohl manche Skeptikerinnen und Skeptiker um die Konjunktur fürchteten, waren bis in die 1970er-Jahre hinein die Wachstumsraten hoch und die Arbeitslosenquoten niedrig. Die Vollbeschäftigung, wie diese Phase der jüngeren Geschichte gerne charakterisiert wird, war jedoch eine Männer-Vollbeschäftigung. Die Frauenerwerbsquote war äußerst niedrig.
Diese Zeit sollte nicht vorschnell zum goldenen Zeitalter verklärt werden, denn es gehört auch zur Wahrheit, dass insbesondere alte Frauen, die in ihrem Berufsleben oft wenig verdient hatten, sowie viele geschiedene Rentnerinnen und Witwen bitter arm waren. Viele Frauen- und manche Männerrenten lagen unter dem Sozialhilfesatz. Viele Betroffene trauten sich nicht, zum Sozialamt zu gehen, um ihre karge Rente durch Sozialhilfe aufstocken zu lassen – sie schämten sich oder hatten Sorge, dass das Amt auf ihre Kinder zurückgreifen würde.
Wer jedoch zum Sozialamt ging, war deutlich besser gestellt als heute. Zwar war die Höhe der Sozialhilfe nie ausreichend; alte Menschen bekamen aber einen zwanzig-, ja zeitweise dreißigprozentigen Zuschlag zum Sozialhilferegelsatz. Dieser Zuschlag wurde 1997 weitgehend abgeschafft. Er gilt seither nur noch für über 65-jährige Gehbehinderte mit Schwerbehindertenausweis. Die Folgen dieser Politik lassen sich heute auf jedem Bahnhof beobachten, wo immer mehr alte Menschen in den Mülleimern nach Pfandflaschen suchen.
Die Demontage der gesetzlichen Rente, erster Akt
Veränderungen beginnen im Kopf
Es gibt ein sehr interessantes kleines Buch von Erhard Eppler mit dem Titel »Kavalleriepferde beim Hornsignal. Die Krise der Politik im Spiegel der Sprache«, in dem sich der Autor mit der Wirkmächtigkeit und Ohnmacht der politischen Sprache beschäftigt. Eppler führt in diesem 1992 erschienenen Buch den Begriff »Fahnenwort« ein. Fahnenwörter sind für ihn solche Wörter, hinter denen sich die meisten Menschen mit einem positiven Gefühl versammeln können – so wie viele Menschen nach dem Sieg ihrer Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft fahnenschwenkend Autocorso fahren. Der Gegenbegriff zum Fahnenwort ist bei Eppler das »Stigmawort«. Stigmawörter sind Wörter, die für die große Mehrheit einen negativen Klang haben. Eppler schreibt: »Es spricht für das hohe Maß an Konsens im Grundsätzlichen, zu dem unsere Gesellschaft gelangt ist, wenn es kaum noch Wörter gibt, die von einer Seite als Fahnenwort, von der anderen als Stigmawort empfunden und gebraucht werden.« Drei dieser Fahnenwörter, die »von beiden großen Parteien« – das waren 1992 die SPD und die CDU/CSU – »positiv, als Fahnenwörter gebraucht« werden, waren nach Epplers Analyse die Begriffe »soziale Sicherheit«, »soziales Netz« und »Solidargemeinschaft«.
Der von Eppler beobachtete »Konsens im Grundsätzlichen« bestand Anfang der 1990er-Jahre nicht nur zwischen den genannten Parteien, sondern auch in den Gewerkschaften und – zumindest überwiegend – im Lager der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihrer Verbände. Obgleich es zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberlager schon immer Auseinandersetzungen in der Tarifpolitik gegeben hat, verteidigten sie doch beide den Wohlfahrtsstaat gegen seine schon damals vorhandenen Verächter. Der Sozialstaat galt als Garant für gesellschaftliche Stabilität, sozialen Frieden, hohe Produktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Dieser gelegentlich als rheinischer Kapitalismus bezeichnete Konsens geriet jedoch just um die Zeit, als Epplers Buch erschien, ins Wanken. In Ost und West brachen Hunderttausende von Industriearbeitsplätzen weg, und die Zahl der Arbeitslosen stieg stark an. Parallel dazu erhöhten sich die heute gern als »Lohnnebenkosten« bezeichneten Sozialversicherungsbeiträge. Mussten 1990 noch 35,6 Prozent des Bruttolohns eines abhängig Beschäftigten an die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung überwiesen werden, so waren nur sieben Jahre später bereits 42,1 Prozent des Bruttolohns an die (inzwischen um die Pflegeversicherung ergänzten) paritätisch finanzierten Zweige der Sozialversicherung zu zahlen.
Der deutliche Anstieg der Lohnnebenkosten hatte im Wesentlichen vier Gründe:
- die wachsende Arbeitslosigkeit, die eine Erhöhung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages nach sich zog;
- eine auch aufgrund der Frühverrentungsprogramme vieler Betriebe stark wachsende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern, was eine Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrags zur Folge hatte;
- die Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995;
- die Kosten der deutschen Einheit, die zum Teil den Sozialkassen aufgebürdet wurden, anstatt sie ausschließlich aus Steuern zu bezahlen, was angemessen gewesen wäre. Schließlich war die Finanzierung der deutschen Einheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht vordringlich Angelegenheit der abhängig Beschäftigten und ihrer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
Dass eine Entwicklung, die zu einer anderen Entwicklung parallel verläuft, diese nicht zwangsläufig bedingen muss, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Dennoch wurde die zunächst nur von einer kleinen Minderheit aus dem Dunstkreis der FDP verbreitete Ansicht, der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei eine unmittelbare Folge der gestiegenen »Lohnnebenkosten«, innerhalb weniger Jahre mehrheitsfähig. In Wahrheit gab es für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den 1990er-Jahren ein ganzes Bündel von Ursachen, die viel entscheidender waren. Schon im vorangegangenen Jahrzehnt hatte der Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft begonnen. Er hatte nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland zu Arbeitsplatzverlusten geführt. Infolge der überstürzten gesamtdeutschen Wirtschafts- und Währungsunion mussten dann Anfang der 1990er-Jahre viele ostdeutsche Betriebe schließen, was die Arbeitslosenzahlen weiter erhöhte. Zusätzlich drängten die geburtenstarken Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt, was das Arbeitskräfteangebot stark vermehrte und ebenfalls zum Anstieg der Arbeitslosigkeit beitrug. Dazu kam eine »geldpolitische Vollbremsung« (Albrecht Göschel) der Deutschen Bundesbank, die nach dem kurzen Vereinigungsboom die Zinsen so drastisch erhöhte, dass viele Unternehmen nicht oder nur noch wenig investierten, was einen drastischen Wirtschaftseinbruch und eine weitere Steigerung der Arbeitslosigkeit zur Folge hatte.
Trotz dieser schon damals deutlich zutage tretenden Fakten, schoss man sich immer mehr auf die steigenden Lohnnebenkosten als Krisenursache ein. Befeuert wu...
Table of contents
- Rettet die Rente!