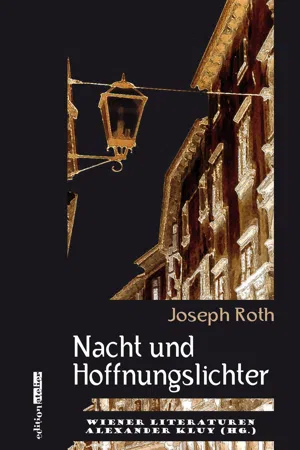
- 248 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Radetzkymarsch, Die Legende vom heiligen Trinker, Hotel Savoy: Die Romane von Joseph Roth gehören auch heute noch zum viel gelesenen Teil des literarischen Kanons. Dass der Vielschreiber aber auch sehr engagiert als Journalist tätig war, ist weniger bekannt. Sowohl in Wien als auch in Berlin machte sich Joseph Roth früh einen Namen als kritischer Beobachter seiner Zeit.Diese sorgfältig zusammengestellte Ausgabe präsentiert eine Auswahl von Feuilletons und Kolumnen aus Berlin und Wien sowie den »kleinen Roman« Der blinde Spiegel. Ein umfassender Anhang gibt Einblick in das Leben und die Zeit von Joseph Roth.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Nacht und Hoffnungslichter by Joseph Roth, Alexander Kluy in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literatur & Altertumswissenschaften. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
LiteraturSubtopic
AltertumswissenschaftenFEUILLETONISTEN,
FLANEURE UND
ANDERE BERLINER
PETER PANTER (KURT TUCHOLSKY): BRIEF NACH WIEN
Lieber Herr!
Wir hören hier so viel von Wien, und davon, wie schlecht es dieser sterbenden Stadt nun geht, und wie hilfsbedürftig sie geworden ist, und wie orientalisch: es gebe nur ganz oben und ganz unten, und zwischen Lumpenproletariat und gleißendem, lackiertem Reichtum zuckt eine ganze Mittelschicht in der Agonie. Aber Sie wissen doch wenigstens – bei allem Elend –, woran Sie sind. Wir wissens nicht.
Bei uns liegen die Dinge so, dass noch niemand ahnt, was aus der Entwicklung des neuen Berlin herauskommen wird. Nur: dass etwas unsagbar Scheußliches herauskommt, das wissen wir schon. Aber alles ist noch im Lauf, alles fließt, und so sieht es jetzt hier aus:
Dem Mittelstand gehts am schlechtesten. Er zehrt vom alten Ruhm, vom alten Glanz und von der Erinnerung an den alten Kempinski (der eine spezifisch berlinische Erscheinung gewesen ist und so recht ein Symbol für diesen alten luxuriösen Mittelstand). Das ist dahin. Sie laufen noch auf den alten Stiefeln – aber wie lange sollen die halten? Was dann kommt, ist die schmerzlich-bittere Erkenntnis, dass es nun aus ist mit der bescheidenen Lebenshaltung (»Sechserdasein« nannte es Fontane), mit jenem kargen Leben, das aber immer noch reich war, weil man billig Butter und noch billiger geistige Werte einkaufen konnte. Und bei allem leisen Lächeln über die Kunstwart-Leute: sie haben doch immerhin ein Licht in ihr Leben hineingetragen, und wenn ich das Neue alles mit ansehe, dann kann ich über die Leute von damals nicht mehr lächeln.
Denen gehts also nicht gut, und über ein Weilchen werden sie klaftertief in ihrer Lebenshaltung gesunken sein. Und die Neuen? Und die Heraufgekommenen?
Sehen Sie, lieber Herr, das ist ja das Traurige, wer da heraufgekommen ist. Wenn früher einmal solch große Umwälzungen vor sich gingen, dann stiegen vielleicht Freibeuter auf, politische Abenteurer oder starkknochige Geschäftsleute der Fugger-Zeit, deren Väter wohl noch den Pflug gelenkt hatten. War das schlimm? Für die grade Unterliegenden sicherlich. Aber es kam frisches, unverbrauchtes Blut in die Gesellschaft, es kamen neue, windumwehte Leute herein, breitbeinige Kerls, deren Söhne dann die Verfeinerung rasch weghatten, doch auch noch lange Generationen hindurch die Stärke vom Stammvater, der Muskeln wie Eisen gehabt hatte. Bei uns?
Bei uns ist ein schwacher und verbrauchter Großstadttyp heraufgekommen – Leute, die zwar viel Skrupellosigkeit, aber doch verhältnismäßig wenig Kraft aufzuweisen haben. Was sind denn das meist für Menschen, diese neuen Reichen? Bauern? Ach, wären sies! Um die reich gewordenen Bauerngenerationen ist mir nicht bange. Aber die Mehrzahl, das sind doch kleine Krämer, denen eine richtige Konjunktur die richtigen Waren in die Hände gespielt hat und die nicht so dumm gewesen sind, die nun von der Hand zu weisen. Schlechtes Blut. Keine Rasse. Und vor allem: keine Kraft.
Und das nun bestimmt hier den Ton, das hat Geld und gibt es mit vollen Händen aus. Man sieht in den elegantesten Lokalen Berlins Gesichter mit Mündern – Münder können einem ja nichts vormachen –, mit Mündern, lieber Herr, wie sie früher die Nachtportiers nicht gehabt haben. Das ist obenauf, das kauft Bilder und füllt die Logen. Noch halten die guten alten Familien, soweit sie nicht ausgestorben sind, noch halten sie Stange, noch leisten sie Widerstand, noch spürt man hier und da kleine Hemmungen. Aber wie lange wird das anhalten? Schließlich ist ja doch Geld eine Waffe, der die Gesellschaft auf die Dauer der Jahre nicht widerstehen kann – und dann? Und dann?
Dann haben wir die Verpöbelung Deutschlands, nicht nur Berlins in vollem Maße. Denn dieses neue verbrauchte, nicht gute Blut wird natürlich in der zweiten Generation noch übler werden. Es ging mit diesen neuen Reichen allenfalls an, solange sies noch nicht waren, damals, als sie um jedes Markstück sich quälen mußten. Aber nun sehen Sie sich diese dicken, in Samt gequetschten Frauen an, sehen Sie diese blutleeren, pinselblonden Söhnchen, denen heute Vaterns Geld alles leicht macht, und die nicht mehr zu kämpfen brauchen, also noch widerstandsunfähiger werden. Und es ist nicht einmal das schöne Schauspiel einer Dekadenz: es ist einfach Schwäche, die sich hinter Frechheit verbirgt. Und stillose Schwäche.
Das Malheur kommt erst. Es ist dann da, wenn diese kurzstirnige, kleinkalibrige Rasse – ob Christen oder Juden, ist ganz gleichgültig – fest im Sattel sitzt, wenn die kleinen Unsicherheiten abgestreift sein werden, und wenn dem Sohn die kleinen faux pas, die heut alle Welt beim Vater belächelt, nicht mehr passieren. Er ißt Hummer nicht mit dem Suppenlöffel, o nein! Er weiß, was sich gehört. Mit Rilke wird er nicht ganz so richtig umgehen.
Doch er wird sich da auch ein Air geben. Aber dass diese Schiebermoral, diese Selbstvergottung, diese Anbetung des alten schlechten deutschen Geistes (»Bei uns herrschte damals doch wenigstens Ordnung« – notabene: eine, die sie reich gemacht hat … ), dass diese unbedingte Sicherheit, herrührend von der Annahme, dass zwar nicht alles mit Geld, aber alles mit sehr viel Geld zu machen sei – dass diese neue Welt die alte in Grund und Boden korrumpieren wird: darauf können Sie sich verlassen.
Unser Elend ist groß. Ob es wirtschaftlich je eure Not erreichen wird, steht dahin. Aber dass wir in dreißig Jahren eine nette Gesellschaft an der Spitze haben werden – wo sitzt heute Geld! –: das weiß ich gewiß.
Grüßen Sie Wien von mir, lieber Herr. Ich kenne es gar nicht – aber grüßen Sie es. Grüßen Sie den großen Schriftsteller und grüßen Sie die paar guten. Grüßen Sie die lustige Zeichnerin Ada und grüßen Sie sich recht herzlich. Und sagen Sie allen, dass es Berlin noch nicht so schlecht geht wie Wien. Aber wir werden sehen, was sich tun läßt.
Die Weltbühne, Nr. 2, 8. 1. 1920
VICTOR AUBURTIN:
DIE DEMÜTIGUNG DES GELDES
In Wien hat ein Bankbeamter einem Kunden irrtümlich eine Million Kronen zuviel ausgezahlt. Der Kunde hat dieses Versehen selbstverständlich gar nicht bemerkt.
Aber auf der Bank ist der Fehler schließlich doch entdeckt worden, als die Monatsabrechnung aufgestellt wurde. Und nun weiß man nicht, was man machen soll.
Man könnte ja dem Kunden eine Postkarte schreiben und ihn bitten, die Million wieder zurückzubringen. Aber das Porto einer Postkarte beträgt rund 400 000 Kronen, die Fahrt auf der Straßenbahn für den Kunden, der das Geld zurückbringt, kostet 300 000 Kronen, und die übrigbleibenden 300 000 Kronen braucht der Bankbeamte, der das Mahnschreiben aufsetzen muß, für seine Virginia.
So wird man den Unterschied stillschweigend verrechnen.
Wenn ich in den Straßen von Berlin eine Zeitung kaufen will und mein Portefeuille heraushole, so pflegt stets ein böser Wind aus West zu kommen, der in dem Portefeuille wühlt und einige Banknoten von dannen führt. Ich denke gar nicht daran, diesen Banknoten nachzulaufen. Da hätte ich viel zu laufen.
Aber regelmäßig stelle ich dann Betrachtungen darüber an, wie merkwürdig stark doch zu dieser Jahreszeit die Winde in der norddeutschen Tiefebene sein können. Weiß Gott, nicht einmal in den Alpen und in dem tönenden Tal der Rhône habe ich solche Stürme erlebt, wie sie jetzt hier in Berlin unter gewissen Umständen vorwalten können.
Und hoffentlich ist es schon aller Welt aufgefallen, daß kein Mensch mehr sich bückt, wenn ein Geldstück auf die Erde fällt. Im Restaurant oder am Bahnhofsschalter, man sieht sich einfach gar nicht danach um.
Am nächsten Morgen kommt die Aufwartefrau und fegt das ganze Zeug zusammen, Streichhölzer, Zigarettenstummel und die Münzen, auf denen der Adler des Reiches seine heraldischen Flügel spreizt.
Aber wenn sie in dem Kehrichthaufen eine alte Haarnadel sieht, dann bückt sie sich danach.
Victor Auburtin: Ein Glas mit Goldfischen,
Albert Langen Verlag, München 1922
SLING:
WIE WIR BERLINER SO SIND
Von einer sehr unbeliebten Nation kann man wohl behaupten, daß sie eines nicht sei: kokett. Unter den Deutschen sind wir Berliner die unbeliebtesten. Wir gehen allen anderen auf die Nerven. Wir wissen das, ändern aber nichts an unserem Betragen. Denn wir haben keine Lust, uns zu verstellen. Das ist unsere Tugend.
Wir sind immerhin stolz und bewußt genug, um darüber unterrichtet zu sein, daß wir eine Reihe ausgezeichneter Eigenschaften haben. Aber wir tragen sie nicht wie Sandwichmen auf Brust und Rücken. Wir überlassen es den anderen, unsere Tugenden zu finden. Daß diese sie nicht einmal suchen, spricht nur gegen die Intelligenz der anderen. Wären diese Leute wirklich klug, würden sie lieber mit angenehmen als mit unangenehmen Menschen zusammensein. Sowie sie aber unseren guten Eigenschaften auf die Spur kommen, wenden sie sich ab, sie können es nicht vertragen, daß wir (neben allem anderen) auch noch liebenswürdig sind.
Eines unserer Hauptverdienste ist, daß wir Berlin bewohnen. Das ist sozusagen eine Last, die wir für die ganze Nation auf uns genommen haben. Anstatt uns dafür auf den Knien zu danken, sagt man uns ins Gesicht, Berlin sei scheußlich, und wir seien daran schuld.
Der Berliner aber ist bis zu dem Grade wahrheitsliebend, daß er ebenfalls behauptet, Berlin sei scheußlich – was wiederum nur auf seinen Mangel an Koketterien zurückzuführen ist. Jeder Einwohner von Neustadt an der Knatter oder ähnlichen Metropolen ist überzeugter von den Schönheiten seiner Heimat als der Berliner von den Vorzügen seiner Vaterstadt. Deshalb wurde auch nichts aus Neustadt, wohingegen Berlin – ich würde es loben, wenn ich nicht Berliner wäre.
Den äußersten Mangel an Koketterie zeigt der Berliner in seiner Behandlung der deutschen Sprache. Man beachte nicht nur Gespräche von Müllkutschern, sondern etwa das Frühlingsgezwitscher der Berliner Schulmädel. Mit dem Ausdruck einer gewissen Übelkeit werden die Worte herausgequetscht und auf das Straßenpflaster geworfen, von den Straßenfegern zusammengekehrt. Ein unerhörtes Temperament tut sich kund, das kein anderes Objekt hat als die deutsche Sprache. Die Beinchen sind krumm vom Asphalt, die Augen stumpf von den hohen Häusern, die armen Händchen greifen in die dicke, von Industrie geschwängerte Luft. Jedes Rasenplätzchen eingezäunt – und meist zu weit entfernt für die spärliche Freistunde. Das Kleidchen muß geschont werden, die Stiefel nicht minder, und sogar die Schürzen haben die Aufgabe, sauber zu sein. Was nicht immer gelingt. Das einzige, womit das Berliner Kind machen kann, was es will, ist die deutsche Sprache. Wir kennen die Folge.
Das Wahrzeichen unseres Mangels an Koketterie ist die Berliner Droschke. In anderen Städten und Ländern ist es etwas Feines, Droschke zu fahren. Kutscher, Pferd und Gast und Wagen haben ein Bewußtsein davon. Die kunsthistorische Bildung des Florentiner Kutschers, der beißende Witz des Parisers, die unnachahmliche Eleganz des Wiener Fiakers findet in Berlin kein Gegenstück. Sogar der Münchner Kutscher hat einen Ehrgeiz, er tut so, als sei er zugleich der Diener auf dem Bock und springt ab, um dem Fahrgast den Schlag zu öffnen. Der Berliner steht zu dem Fahrgast in gar keinem Verhältnis. Am Ende des Krieges gab es eine Zeit, in der er wenigstens versuchte, ihn zu betrügen. Auch das hat aufgehört. Er ist sachlich, und er rechnet auf kein Trinkgeld. Er ist nicht von dem Gefühl durchdrungen, einer Equipage vorzustehen, oder der Fahrgast sei etwas Feineres als er selbst, und er trägt den zweiundzwanzigmal geflickten blauen Mantel mit demselben Gleichmut, mit dem der Fahrgast sich auf das zerschlissene Polster niedersetzt. Auch er hat nicht das Gefühl, der Welt Bewunderung dadurch abzuringen, daß er Droschke fährt.
Der Berliner liebt es, zuzeiten ein gut geführtes, wohlausgestattetes Restaurant aufzusuchen. Dort haben die Kellner eine gewisse Haltung, die eine Mischung von Hochmut und Bedientenhaftigkeit ist. Unter diesen vornehmen Kellnern befinden sich selten Berliner. Der Eingeborene unterliegt zuweilen den Reizen der Vornehmheit. Er ist leicht befangen, und wenn er mehr zahlt, als er eigentlich mußte, so ist es aus Schüchternheit. Aber es gibt auch Berliner, die nicht schüchtern sind, und die machen Krach, wenn ihnen eine zu hohe Rechnung vorgelegt wird. Niemals zahlt der Berliner, weil er das für vornehm hält. Immer läßt er seinen Gefühlen freien Lauf: entweder es kracht, oder er ist eben schüchtern.
Wenn der schüchterne Typ sich auf die Reise begibt, hält ihn niemand für einen Berliner. Der krachmachende Typ ist außerordentlich unbeliebt – besonders bei den Kellnern.
Im Grunde haben wir alle ein bißchen von Michael Kohlhaas. Ich erinnere mich an eine Fahrt über den Bodensee vor der Kommandobrücke, als ein rot angelaufener Herr dahergestürmt kam und den Kapitän zu sprechen wünschte. Dies war der Tatbestand: Der Herr reiste mit zwei Damen. Während er und seine Frau sich noch um das Gepäck kümmerten, war die zweite Dame in die Kajüte gegangen, hatte sich bei dem Kellner ein Schnitzel bestellt. Bevor dieser Befehl noch ausgeführt war, kam der Herr mit seiner Frau dazu und bestellte (in Unkenntnis des bereits verlangten Schnitzels) deren drei. Infolgedessen brachte der Kellner vier. Der Kellner verlangte dafür auch Bezahlung. Jeder andere hätte das vierte Schnitzel (so überwältigend groß war es nicht) gegessen und bezahlt. Der Herr war aber aus Berlin. Infolgedessen machte er einen unerhörten Krach, der Kellner kam ihm nachgelaufen und krachte mit. Wer sich in der Nähe des Zankenden zeigte, wurde angezapft: »Mein Herr, wollen Sie Schiedsrichter sein.«
Als wir auf der Schweizer Seite ankamen, ließ man den Berliner nicht vom Schiff, ehe er bezahlt hatte. Das Schnitzel aß später der Kellner. Dieser Berliner hatte sich sehr lächerlich gemacht, aber ich liebe ihn gerade, weil er so gar nicht kokett war, sondern seine Lächerlichkeit mitten auf dem Bodensee angesichts der Schweizer Alpen und einiger mitreisender Ententediplomaten ausbreitete. Die anwesenden Süddeutschen und Schweizer lächelten vergnügt vor sich hin und sagten: »Ein Berliner.« Niemand ist auf den Gedanken gekommen, daß der Restaurateur des Schiffes kulanterweise hätte sagen können: »Verzeihen Sie den Irrtum, ich nehme das Schnitzel mit Vergnügen zurück – die Schnitzel, die Sie gegessen haben, sind ja auch von gestern.« Daß er das nicht gesagt hat, hätte man ihm nur verübelt, wenn sich die Szene nicht auf dem Bodensee, sondern auf dem Wannsee abgespielt hätte. Die Bewohner von Nichtberliner Gegenden können eben noch auf ganz anderen Gebieten machen, was sie wollen, wie wir, die eben nur die deutsche Sprache zur Verfügung haben.
Vossische Zeitung, März 1921
ARNOLD HOLLRIEGEL:
KAFFEE UND DER KLEINE PLOETZ. MOKKA ZU MITTAG
Früher gab es etwas Langes, Feierliches, schon das Wort hatte vier Silben? Mittagessen. In Berlin sagt man schon längst lieber: Frühstück. In Amerika: Lunch. Ehe man: Lunch gesagt hat, ist er auch schon wieder vorbei.

Ein Café war ursprünglich ein Lokal für Müßige, oder für Leute, deren Tagesarbeit schon vorbei war. Jetzt gibt es an dem großen...
Table of contents
- Cover
- Titel
- GELEITWORT
- VORWORT
- RUDOLF OLDEN: NACHRUF AUF EINEN FREUND
- JOSEPH ROTH: WIENER SYMPTOME. 1915–1923
- JOSEPH ROTH: DER BLINDE SPIEGEL
- JOSEPH ROTH: WIENER HOFFNUNGSLICHTER. 1919–1920
- WIEN: REPORTER, REVOLUTIONÄRE UND ANDERE ÖSTERREICHER
- JOSEPH ROTH: ABENDGANG DURCH ALT-BERLIN. 1920–1924
- BERLIN: FEUILLETONISTEN, FLANEURE UND ANDERE BERLINER
- BIOGRAFIE JOSEPH ROTH
- KURZBIOGRAFIEN DER BEITRÄGER
- INHALT
- Impressum