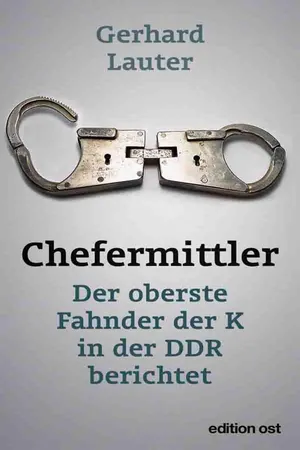Spiegel-Exkurs als Anlage: »Die Nacht der Wildschweine«
Ein großer Plan, ein Komplott oder nur Schusseligkeit? Was ist der Grund, warum Berlin am 9. November 1989 zwischen Gewalt und Euphorie schwebte? Drei Kommunisten waren es, die der wankenden DDR den Rest gaben – getriebene Akteure in einer Mauerkomödie.
Er sitzt in seiner Kanzlei in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs, im zweiten Stock eines Altbaus aus der Gründerzeit, Gerhard Lauter schaut seine Gesprächspartner immer noch so von unten an, mit gesenktem Kopf, wie vor 20 Jahren. Damals konnte man denken, das ist die Körperhaltung eines Menschen mit schlechtem Gewissen, damals war er Leiter der Pass- und Meldeabteilung der DDR, Spitzenbürokrat eines Systems, das gerade auseinanderflog. Heute ist er Anwalt, und seine Vergangenheit liegt in Klarsichthüllen vor ihm, Politbüro-Vorlagen aus der Zeit des Mauerfalls und Ministeratsbeschlüsse.
Gerhard Lauter, heute 59 Jahre alt, inzwischen grauhaarig, spricht mit der gleichen Präzision und Zurückhaltung eines studierten Kriminalisten über diesen historischen Tag wie damals.
»Eine Episode« nennt er den 9. November, eine Episode, in der er neben Günter Schabowski eine Hauptrolle spielte. Er formulierte am Vormittag des 9. November den Zettel, der die Mauer am Abend einstürzen und die Nachkriegsordnung in Europa zusammenkrachen ließ. In der Nacht wurde er zum Informationszentrum einer führungslosen Macht. Es ist wie mit dem Tod von John F. Kennedy, dem 11. September in New York oder dem Schuss auf Benno Ohnesorg – Ereignisse, die dem Lauf der Welt eine neue Richtung geben, produzieren immer Mythen, Fragen und Legenden. Welchen Umständen ist es zu verdanken, dass kein einziger Schuss fiel in den stundenlangen Auseinandersetzungen an den Grenzübergangsstellen? Warum waren die Grenzer nicht vorbereitet auf den Ansturm? Was waren die wahren Absichten der DDR-Führung an diesem 9. November? Waren die Geheimdienste – BND, CIA, KGB – wirklich so vollkommen ahnungslos? Hatte Gorbatschow Krenz die Maueröffnung befohlen? War die legendäre Pressekonferenz mit Schabowski eine Inszenierung? War der Zettel mit der neuen Reiseregelung, den Schabowski hervorholte und vorlas, war der ihm tatsächlich vom KGB zugesteckt worden?
In Gerhard Lauters Klarsichthüllen liegen Antworten auf diese Fragen, er ist der Kronzeuge für die Vorgänge im Innenministerium der DDR. Schabowski weiß, wie es ihm und seinen Genossen aus dem Politbüro passieren konnte, dass die wertvollste Immobilie ihrer Republik umgetreten wurde wie ein morscher Lattenzaun.
Und dann ist da vor allem Harald Jäger, damals Oberstleutnant der Staatssicherheit, an jenem 9. November der stellvertretende Leiter der Passkontrolle an der Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße – wo die Schlagbäume zuerst hochgingen in dieser Nacht.
Jäger wohnt heute außerhalb von Berlin im Örtchen Werneuchen, zusammen mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung, in der die Miete niedriger ist als die 500 Euro seiner letzten Wohnung in Berlin-Mitte. Wenn er aus dem Fenster schaut, sieht es aus wie vor dem Mauerfall, gegenüber ein verfallenes Haus, unten auf der Straße grobes Kopfsteinpflaster. Jäger ist inzwischen Rentner, die meisten Tage verbringt er mit seiner Frau in dem Kleingarten, den er kurz vor dem Mauerfall, im August 1989, beantragt hat und nach dem Mauerfall, im Frühling 1990, zugesprochen bekam.
Jäger öffnete – ohne Befehl, ohne Kompetenz – am 9. November eine halbe Stunde vor Mitternacht den Schlagbaum am Berliner Grenzübergang Bornholmer Straße und verhinderte so, dass dieser Tag in einer blutigen Konfrontation endete. Der Stasi-Offizier brach die Regeln eines Systems, das ihn geprägt hatte, er maßte sich an, in den Gang der Dinge einzugreifen. Das taten an diesem Tag auch Günter Schabowski und Gerhard Lauter. Sie funktionierten nicht mehr. Ohne voneinander zu wissen, waren die drei Kommunisten Komplizen eines Komplotts gegen die DDR, von morgens neun Uhr bis nach Mitternacht griff das, was sie taten, ineinander wie das Werk von Verschwörern. Wenn einer von ihnen an diesem Tag anders gehandelt hätte, als er es tat, wäre der 9. November nicht als der Tag des Mauerfalls in die Geschichte eingegangen. Aber sie handelten nicht aus freiem Entschluss, sie waren Getriebene, die handeln mussten, weil Hunderttausende sie zwangen.
Gegen ihren Willen gaben die drei Kommunisten ihrem geliebten Arbeiter-und-Bauern-Staat den Rest, nach Monaten voller Unruhen. Über Ungarn und die ČSSR waren immer mehr DDR-Bürger geflüchtet, die Oppositionsgruppe des »Neuen Forums« hatte sich gebildet, auf Montagsdemonstrationen machten sich die Leute Luft, auf der Straße prügelte die Volkspolizei Oppositionelle zusammen, auch in der SED formierte sich Widerstand, am 18. Oktober musste Erich Honecker abdanken, Egon Krenz, als neuer SEDChef, versprach Reformen, aber am 4. November versammelte sich über eine halbe Million Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz, unüberh.rbar in ihren Forderungen, am 6. November reagierte die SED mit einem neuen Reisegesetz, es wurde verhöhnt von den Oppositionellen – und dann kam der 9. November.
9. November, 7.00 Uhr, Berlin, im Stadtteil Hohenschönhausen
Harald Jäger nimmt an diesem Morgen den Dienstwagen, um zur Arbeit zu kommen. Er ist stellvertretender Leiter der Passkontrolleinheit, die nächsten 24 Stunden ist er im Dienst, darum darf er den Dienstwagen benutzen. Seinen gebraucht gekauften Wartburg schont er, lange hat er um ihn gekämpft. Er musste sich an seinen obersten Chef wenden, den Leiter der Hauptabteilung VI der Staatssicherheit, um nicht 18 Jahre lang auf seinen Wartburg warten zu müssen; der General hatte ihm einen gebrauchten verschafft, immerhin, und als der Motor bei der ersten Autobahnfahrt verreckte, hat er ihm einen Kontakt geknüpft, zu einer Wartburg-Werkstatt, geführt von einem IM, und ihm so einen gebrauchten Motor beschafft, immerhin.
Harald Jäger, 45 Jahre alt, seit 25 Jahren bei der Staatssicherheit, führt ein Doppelleben. Seine drei Kinder wissen, dass er am Grenzübergang Bornholmer Straße Pässe kontrolliert, dass er bei der Stasi ist, wissen sie nicht. Jägers Kampfauftrag: an der Grenzübergangsstelle von Ein- und Ausreisenden im freundlichen Gespräch Informationen sammeln über staatsfeindliche Bestrebungen »feindlich-negativer Kräfte«. Und weil Jäger das gut kann, freundlich plaudern, und zudem einen offenen Blick hat, ist er im letzten Vierteljahrhundert bis zum Oberstleutnant aufgestiegen und seine »Operativkartei« mit den Erkenntnissen über Tausende West- und Ostdeutsche prächtig angewachsen.
Jäger sieht sich nicht als Schnüffler, sondern als Staatsdiener, der hilft, den Sozialismus, diese wunderbare Idee der Solidarität und Brüderlichkeit, zu verteidigen. Im 40. Jahr der Republik erklärt er sich die großen Probleme der DDR damit, dass das Politbüro in der Hand von Greisen ist.
Allerdings: Jüngeren Kadern, wie dem Berliner Parteichef Günter Schabowski, traut er auch nicht. Der hat auf einer Parteiaktivtagung die 40.000 Mark für den neuen Wartburg zornig verteidigt, Qualität habe nun mal ihren Preis. Am Nachmittag des selben Tages hat Jäger denselben Schabowski auf einer 1.-Mai-Veranstaltung in einem Volvo vorfahren sehen, das hat gereicht, um ihn für ihn unglaubwürdig zu machen.
Knapp 20 Minuten braucht Jäger von der Vierraumwohnung im Plattenbauviertel Hohenschönhausen zur Bornholmer Straße, er ist in »Novemberstimmung «, wie er es nennt, es ist morgens noch dunkel und neblig, und vor ihm liegen 24 Stunden Langeweile. Der Donnerstag ist traditionell reiseschwach.
Waldsiedlung Wandlitz, bei Berlin
Gestern hat Günter Schabowski zum ersten Mal vor hundert westlichen Journalisten im Pressezentrum der Hauptstadt vorgeführt, dass er der westlichste aller ostdeutschen Führungskr.fte ist. Mit wehnerhaft verschachtelten Sätzen, mit Humor und Selbstironie hat er auf die Journalisten gewirkt, wie ein Kommunist, der froh ist, endlich dem Gefängnis der Funktionärssprache entrinnen zu können. Er hat über den ersten Tag der 10. Sitzung des SED-Zentralkomitees informiert, mit den üblichen Phrasen, aber zwischendurch waren diese ungehörten Formulierungen aufgeblitzt, die ihn schnell zur westlichen Medienhoffnung machten.
Frühmorgens beim Frühstück hört Schabowski im Deutschlandfunk die Presseschau, um rüber in den Westen zu horchen. Von der Waldsiedlung Wandlitz, dem Ghetto der Politbürokraten, in der Schabowski mit seiner Familie lebt, bringt ihn der Volvo jeden Morgen ins ZK-Gebäude. Honecker hat die russischen Straßenkreuzer ausgetauscht gegen diese Volvos, damit seine Leute in Autos herumfahren wie ihre westlichen Gegenspieler; ein Mercedes, so Schabowski, roch ihm zu sehr nach Klassenfeind. 45 Minuten braucht sein Fahrer bis ins Zentrum der DDR-Hauptstadt, um zehn Uhr beginnt der zweite Tag der ZK-Tagung, Schabowski soll bald nach Beginn darüber reden, wie die DDR-Medien über Demonstrationen und Massenflucht berichten. Er war sieben Jahre lang ein treuergebener Chefredakteur des Neuen Deutschland, am Vortag ist er zum Medienverantwortlichen des Politbüros bestimmt worden.
9.00 Uhr, Berlin, Mauerstraße, Innenministerium der DDR
In Gerhard Lauters Dienstzimmer treffen drei Besucher ein: Oberst Hans-Joachim Krüger und Oberst Udo Lemme, sie sind von Stasi-Chef Mielke geschickt worden; dazu Generalmajor Gotthard Hubrich von der Hauptabteilung für Inneres im Innenministerium. Die Stasi-Obristen haben einen 19-zeiligen Entwurf für das mitgebracht, was die vier in den nächsten Stunden ausarbeiten sollen: eine Regelung für all die DDRBürger, die ihr Heimatland für immer verlassen wollen.
Lauter hat den Auftrag am Vortag von Innenminister Friedrich Dickel bekommen. Die Ansage: Beschlussvorlage für den Ministerrat bis morgen Mittag, parallel dem Politbüro vorzulegen, am 10. November sollen Anträge zur Ausreise von DDR-Bürgern direkt in die Bundesrepublik möglich sein. Auch über Westberlin? Ja, auch über Westberlin. Warum so dringend? Die Regierung der ČSSR will die Grenze zur DDR schließen, weil zu viele DDR-Bürger über die ČSSR in die Bundesrepublik fliehen, das belaste die politische Stabilität des Brudervolkes.
Vorab ist Lauter in Gesprächen mit seinen Mitarbeitern zu der Auffassung gelangt, dass eine Regelung ausschließlich für Republikflüchtlinge widersinnig ist. Warum soll der, der sich in der DDR wohl fühlt, nicht auch mal eben über die Mauer gucken dürfen, warum soll man ihn bestrafen dafür, dass er staatstreu ist?
Zu seiner Überraschung widersprechen die Stasi-Offiziere nicht groß, auch sie sind weichgeprügelt durch die täglichen Flüchtlingszahlen, auch sie waren wie Lauter an der Formulierung jenes missglückten Reisegesetzentwurfs beteiligt, der am 6. November veröffentlicht und innerhalb von Stunden zum Gespött der DDR-Bürger geworden war. Es war ein Reiseverhinderungsgesetz, nur 30 Tage im Jahr sollen die DDR-Bürger rausdürfen, jede Reise kann aus nicht überprüfbaren Gründen untersagt werden, und Anspruch auf den Umtausch von genügend Westgeld gibt es nicht.
10.00 Uhr, Berlin, im Gebäude des Zentralkomitees
Der zweite Tag der Beratungen des Zentralkomitees beginnt, Demonstrationen und Massenflucht lassen auch den innersten Machtzirkel des Arbeiter-und-Bauern-Staats erbeben. 40 Jahre lang waren die 213 Mitglieder und Kandidaten des ZK einerseits die zweithöchste Machtinstanz, andererseits waren sie Claqueure des 17-köpfigen Politbüros. An diesem 9. November bricht das sorgsam austarierte Machtgefüge auseinander.
Besonders Egon Krenz, der genug Machtinstinkt besessen hatte, Honecker drei Wochen vorher zu stürzen, irrlichtert durch den Tag mit derselben lächelnden Unbedarftheit eines Vico Torriani, mit der er seit seiner Machtergreifung durch die deutsche Revolution tapst. Das Netteste, was man über seine Rolle an diesem 9. November sagen kann: Er geht irgendwann schlafen und lässt die Dinge laufen, die seinen und den Untergang seiner Partei bedeuten.
Jetzt, um kurz nach zehn Uhr morgens, gibt er noch einmal den strengen Herrscher. Er empört sich vor den Mitgliedern des Zentralkomitees darüber, dass die DDR-Medien nicht so ergriffen wie gewohnt vom ersten Tag der ZK-Tagung berichtet haben.
11.00 Uhr, Berlin, Grenzübergang Bornholmer Straße
Seit der DDR-Staat von innen und außen unter Druck gerät, hat sich auch für Oberstleutnant Jäger der Dienst an der Bornholmer Straße verändert. Der Grenzübergang, einer von sieben in Berlin, liegt im Prenzlauer Berg, von der Stasi als Stadtbezirk von negativfeindlichen Kräften eingeschätzt, hier wohnen Staatsfeinde, Kirchenaktivisten, Umweltfreunde. Einreisende sind darauf zu überprüfen, ob sie mit dem Ziel ...