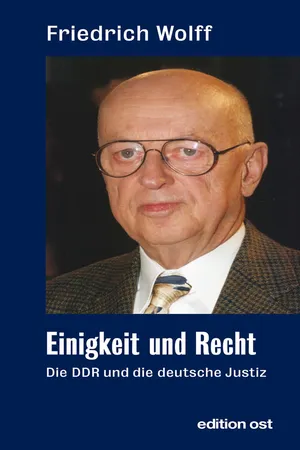![]()
Die juristische Vergangenheitsbewältigung nach dem 3. Oktober 1990
Die juristische Bewältigung der DDR-Vergangenheit durch die BRD erfolgte total und schlagartig. Die DDR-Hinterlassenschaft wurde keineswegs nur mit den Mitteln des Strafrechts bewältigt. Die Juristen waren an vielen Fronten (darf oder muß man Fronten sagen?) mit ihrer Bewältigung befaßt.
Zuerst setzte die BRD das gesamte bundesdeutsche Recht mittels Art. 8 des Einigungsvertrages im ehemaligen Staatsgebiet der DDR in Kraft. Administrativ lief alles vorzüglich ab. Juristen aus dem DDR-Justizministerium hatten fleißig mit denen des Bundesjustizministeriums zusammengearbeitet und so im Eiltempo das juristische Kunstwerk des Einigungsvertrages vollbracht, in dem alles geregelt wurde. Das alte Recht wurde das neue.
Das bundesdeutsche Recht ist im Kern das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vom 1. Januar 1900, der Zivilprozeßordnung (ZPO) vom 30. Januar 1877, des Strafgesetzbuches (StGB) vom 15. Mai 1871, der Strafprozeßordnung (StPO) von 1. Februar 1877 und des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 27. Januar 1877. Diese Gesetz sind natürlich vielfach geändert und den modernen Lebensverhältnissen angepaßt worden, den Zeitgeist ihrer Entstehung können und wollen sie jedoch nicht verleugnen. Bismarck und Kaiser Wilhelm stehen als Ahnherren hoch im Kurs. In einer der gängigsten Ausgaben der heute geltenden Fassung des BGB heißt es in der Einleitung: »Die wesentlichen Materien des bürgerlichen Rechts sind – trotz aller Änderungen – immer noch im BGB von 1900 enthalten.«
An die Stelle der sozialistischen Moral traten wieder die guten Sitten, und im Erbrecht gab es wieder einen Pflichtteilanspruch. Alles wie bei Kaiser Wilhelm. Scheidung ging wieder nur mit Rechtsanwalt, dauerte lange und kostete viel. Abtreibung war nicht mehr einfach und kostenfrei. Richter waren unabhängig, Gesetze unverständlich. Die berühmten Worte des liberalen Justizministers der Weimarer Republik, Eugen Schiffer, von der Volksfremdheit des Rechts und der Rechtsfremdheit des Volkes galten wieder, wurden jedoch so nicht mehr ausgesprochen. Schüchterner klingen heute Worte wie die des Saarbrücker Professors Lüke: »Wenn die Menschen das Recht nicht mehr verstehen, was z. B. für Teile des Familienrechts zutreffen dürfte, wird die Gefahr heraufbeschworen, daß der Rechtsstaat zu einem abstrakten Gebilde, zu einer dem Staatsvolk gleichsam übergestülpten Glocke wird. Große Sorge bereitet der Befund, daß der Rechtsstaat bisher nicht nur nicht in den Herzen der Menschen im Osten angekommen ist, um eine Formulierung Steffen Heitmanns aufzugreifen, sondern daß er – anders als in den Jahren nach 1949 – überhaupt nicht mehr in den Herzen der Menschen ist, folglich auch nicht mehr aus ihren Herzen kommt. Dies scheint die eigentliche Krise des Rechtsstaats zu sein.«
Das Alte wurde also nun das Neue für den neuen Bundesbürger. Das geschah, von Ausnahmen abgesehen, bereits am 3. Oktober 1990 um 0.00 Uhr. Vom Bürgerlichen Gesetzbuch über das Strafgesetzbuch bis zum Sozialgesetzbuch, dem Steuerrecht und der Straßenverkehrsordnung trat eine neue Rechtsordnung über Nacht in Kraft. Hatte der Bürger des Deutschen Reichs noch vom 18. August 1896, dem Zeitpunkt der Verabschiedung des BGB, bis zum 1. Januar 1900, dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens, Gelegenheit, sich mit dessen 2.385 Paragraphen zu beschäftigen, so sollte der nunmehr mündige Neubundesbürger eine vielfach größere Paragraphenflut sozusagen im Handumdrehen verinnerlichen. Seine Vertreter in der Volkskammer hatten dies Kunststück bereits vor ihm bewältigt, indem sie dem Einigungsvertrag mit seinen Anlagen und den Tausenden von Paragraphen nach Prüfung (?) von wenigen Tagen zustimmten. Der Bundestag stand vor demselben Problem, auch er mußte dem Einigungsvertrag zustimmen, auch er tat es blindlings. Nur 40 Abgeordnete der SPD hatten Bauchschmerzen. Sie erklärten: »Schwer erträglich ist für uns die unzureichende parlamentarische Behandlung des Vertrages. Der Bundestag und seine Ausschüsse hatten nicht die Möglichkeit, das Vertragswerk mit seinen zahlreichen Anlagen gründlich und sachgerecht zu prüfen. Kein Ausschuß, kein Abgeordneter hatte die Möglichkeit, auf die Gestaltung der Gesetze, die in diesem Vertrag eingeschlossen sind, Einfluß zu nehmen, beispielsweise durch Änderungsanträge in der zweiten Lesung. Hier werden in einem beispiellosen Schnellverfahren Gesetze verabschiedet, deren Folgen keiner von uns heute übersehen kann.« Auf der ersten Seite der Bundestagsdrucksache, die den Gesetzentwurf enthielt, war zu lesen:
»A. Zielsetzung (Einheit)
B. Lösung (Einigungsvertrag)
C. Alternativen – Keine
D. Kosten (»Der Einigungsvertrag und seine Anlagen haben nur begrenzte unmittelbare finanzielle Auswirkungen […]«)
So wurde den neuen Bundesbürgern Demokratie beigebracht.
Nach und neben der fortwirkenden Gesetzgebung und der emsigen Verwaltung bewältigte vom 3. Oktober 1990 an die Justiz in Gestalt der Straf-, Zivil-, Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- und Arbeitsgerichte und letztlich das Bundesverfassungsgericht in ungezählten Prozessen die DDR-Vergangenheit. Völlig bewältigt ist die Bewältigung auch heute noch nicht. Viele Juristen, Polizisten und andere Staatsdiener haben von ihr gelebt, vielen BRD-Bürgern hat sie ein Vermögen beschert. Bettina Gaus beschrieb einen solchen Fall in dem Nachwort zu den »Erinnerungen« ihres Vaters. Sie erinnerte sich, »daß eine enge Freundin meiner Eltern von einer in bescheidenen, wenngleich auskömmlichen Verhältnissen lebenden Frau zu einer reichen Erbin geworden ist […] Bemerkenswert finde ich vielmehr, daß ich – die sie ziemlich gut kannte – erst mehrere Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR überhaupt erfuhr, daß sie an diese Entwicklung berechtigte Hoffnungen auf Wohlstand knüpfen durfte. Die Vorkriegsstellung: Sie spielte keine Rolle in dem Nachkriegsdeutschland, das ich kennengelernt habe, jedenfalls nicht in materieller Hinsicht. Hin ist hin, weg ist weg.«
Parallel zur juristischen Vergangenheitsbewältigung lief die ökonomische. Die Wirtschaft der DDR wurde umstrukturiert, das ehemalige Territorium der DDR wurde deindustriealisiert. Die Volkseigenen Betriebe verschwanden. Dafür entstanden neue Supermärkte, Einkaufspassagen, Shoppingzentren. Aus HO wurde Kaiser, Reichelt, Aldi, Lidl, Spar oder REWE. Sie eroberten die »grünen Wiesen«, gaben den DDR-Einzelhändlern, die den Sozialismus überlebt hatten, den Rest. Ost war out. Die Betriebe wurden geschlossen, Westbetriebe übernahmen ihre Kunden und ihre Immobilien, aber wenig oder keine Arbeitskräfte. Westeigentümer kamen in die »neuen Bundesländer« und forderten ihre Grundstücke von den »Ossis«, die Jahrzehnte dort gelebt, gebaut und gearbeitet hatten. Das passierte, bevor die Justiz zum Zuge kam, und setzte sich danach in rechtlich geordneten Bahnen fort. Alles mußte anders werden, alles wurde anders. Adlige erhielten Goethes Grabstätte, seinen Nachlaß und Sachsens Schätze zurück. Das war die Art, wie zusammenwuchs, was zusammengehörte. Recht und Justiz halfen dabei. Wie sie das taten, soll im folgenden deutlich gemacht werden. Was die Wirtschaft außerhalb des Rechts tat, steht auf einem anderen Blatt und kann hier nicht erörtert werden. Es muß jedoch immer mit berücksichtigt werden.
Die strafrechtliche Vergangenh...