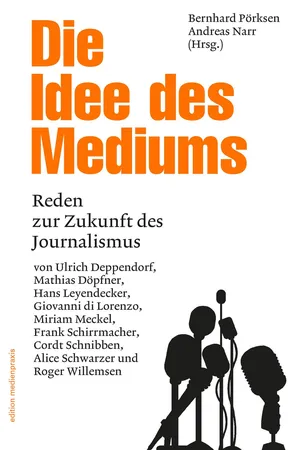![]()
Roger Willemsen
Das blinde Medium.
Rede zur Lage des Fernsehens
Ich freue mich, hier zu sein und etwas zu improvisieren über das Medium, von dem ich in einer Verballhornung eines Satzes von Kurt Tucholsky sagen darf: Ich hasse das Fernsehen und ich darf es hassen, denn ich liebe es. Was ich zu sagen habe, ist allerdings stärker angeregt von dem Konjunktiv des Fernsehens als von seinem Indikativ. Sehen wir unser Verhältnis – das zwischen Ihnen und mir – ein wenig wie das zwischen dem Komponisten Arnold Schönberg und einem jungen Mann. Die beiden stritten sich einmal über Kunst. Und im Verlauf dieses Gespräches sagte der junge Mann unvorsichtigerweise: »Das kann ich beweisen.« Daraufhin sagte Schönberg missvergnügt: »In der Kunst kann man überhaupt nichts beweisen.« Und dann machte er eine Pause und sagte: »Und wenn, dann nicht Sie.« Und dann machte er noch eine Pause und sagte: »Und wenn Sie, dann nicht mir!«
Ich glaube, in diesem Beispiel sind Sie eher Schönberg und ich bin der junge Mann, denn ich versuche, etwas zum Fernsehen zu beweisen – immer unter der Prämisse, dass das, was ich sagen werde, vollkommen gleichgültig ist. Denn das Fernsehen ist in einer Weise resistent gegen seine eigene Kritik, dass es sich fast erübrigt, Überlegungen dazu anzustellen, zumal die Einschaltquote für Fernsehmacher als alleinige Bezugsgröße etabliert ist. Auch weil das so ist, hat sich das Fernsehen zum eitelsten Medium entwickeln können, das es gibt, was man schon daran ablesen kann, dass zwar die sogenannte ›Medienkompetenz‹ beim Publikum ständig zunimmt – wie nicht zuletzt Blogs und Foren beweisen, die oft den Medien-Teil einer Zeitschrift in den Schatten stellen –, es aber im ganzen Fernsehen inzwischen kein einziges nennenswertes medienkritisches Magazin mehr gibt. Und auch die Medienteile der großen Zeitungen liefern – wohl auch, um die Anzeigenkunden nicht zu verschrecken – kaum Hintergrund, aber viel Erdnussflips mit Couch-Gegrummel.
Dieser Sachverhalt ist durch die kommerzielle Verflechtung von Zeitschriften-Konzernen mit anderen Medienhäusern gegeben, und er macht eine unabhängige Medienkritik kaum mehr möglich. So leistete sich der Spiegel zwar über viele Jahre eine Fernsehkritik, für die nichts so schlimm schien wie das »Diktat der Lust« der Erotik-Magazine und die »Quasselbuden« der Talkshows. Als aber bekannt wurde, dass das Magazin selbst seit vielen Jahren die Sex-Sendung Wa(h)re Liebe produzierte und die Johannes B. Kerner Show co-produzierte, hielt man sich beim Spiegel mit der Kritik der Genres und mit noch mehr Kulturpessimismus eher zurück und fand stattdessen ARTE und sein elitäres Programm anstößig. Wie viel unabhängige Medienkritik aber ist noch denkbar, wenn sich Print- und elektronische Medien unter einem Dach befinden, in Personalunion finanziert und verwaltet werden?
Angesichts der Bedeutung, auch der Macht des Mediums, sollte man denken, auch das Fernsehen müsste sich jener Aufgabe stellen, die noch jede künstlerische Artikulationsform in dieser Kultur für sich zu lösen versucht hat: nämlich die Selbstreflexion des Mediums. Wir haben diese aber weder in der diskursiven Form der Fernsehkritik im Fernsehen noch als Thematisierung der Ausdrucksmittel und -gattungen noch als Analyse der Werte, die unsere filmische Vergewisserung über die Außenwelt bis in die Nachrichten hinein bestimmen. Wo dieser Diskurs zumindest in Ansätzen geführt wird – wie etwa in den Eigenproduktionen von Alexander Kluge – trifft er auf Ablehnung, auf Spott. Ihre mangelnde Kommerzialität wird den Sendungen wie ein moralischer Makel angelastet, der Blick bleibt blind. Das Verdikt, das diese Produktionen trifft, erledigt zugleich wesentliche Epochen der Filmgeschichte, etwa Teile der Arbeiten aus der Nouvelle Vague, Frühwerke Oshimas, Straub-Huillets und selbst so heterogener Gestalten wie Jim Jarmusch, Sergei Eisenstein oder Luis Buñuel.
Diese Namen stehen nämlich für jene Differenzierung der Form wie der ästhetischen Mittel visueller Gestaltung, die im heutigen Fernsehen ohne Ort ist. Man nehme eine beliebige Aussage Jean-Luc Godards, wie die, die Entfernung der Kamera zum Gesicht der Frau lege die Moral der Einstellung fest, und man erkennt, dass das Fernsehen weitestgehend im Zeichenraum von Signalen oder Piktogrammen denkt. Auch wären heute Bildanalysen wie die in A Letter to Jane (zu einem Zeitungsfoto, dass Jane Fonda unter vietnamesischen Kriegsopfern zeigt) ebenso notwendig wie undenkbar, und schließlich käme eine radikale Erörterung jener Prinzipien, unter denen heute Nachrichten ausgewählt und bildlich eingerichtet werden, einer Art Systemveränderung gleich.
Sie alle haben eine avancierte Beobachtung dieses Mediums. Sie alle wissen sich theoretisch zu verständigen über das, was das Medium leistet. Sie können wie in einer Stammeskultur beschreiben, was Moderatoren tun, was sie für einen Geruch haben, welches Aroma sie verströmen, welche Botenstoffe von ihnen ausgehen. Sie wissen das alles. Aber das Fernsehen selber ist zu der Beschreibung dieser Dinge nicht in der Lage, so wie auch die Fernsehzeitungen in der Regel nur noch Programmbegleitung leisten und selbst ein Medienteil wie der der Süddeutschen in der Regel nicht gerade durch den Begriff ›Kritik‹ zusammengehalten wird.
Man kann also sagen, der junge Mann, der ich nicht mehr bin, aber der hier stünde, wenn er an der Seite von Arnold Schönberg stünde, der würde das Sinnloseste und das Notwendigste im gleichen Akt tun. Das Notwendigste, weil es dringend nötig ist, dass wir uns verständigen über das, was Massenmedien tun, in welcher Weise sie formatieren, was wir sind, was wir sein wollen, in welcher Weise wir einen immateriellen Begriff von Kultur in Zirkulation bringen. Und auf der anderen Seite das Sinnloseste, weil außer uns, die wir hier wie die Urchristengemeinde in einer Höhle sitzen, niemand zuhört und niemand antwortet und kein Intendant erschrickt und sagt: »Willemsen hat in Tübingen gesagt, das ist falsch, was wir machen.«
Nein, was ich hier versuche, das heißt bei Karl Kraus, Locken auf einer Glatze zu drehen. Aber es ist eine schöne Tätigkeit. Ich glaube, dass an den Poststationen im 18. Jahrhundert die Reisenden gesessen haben. Sie warteten auf die Erscheinung des Groschenromans: der hätte ihnen die Zeit so schön verknappen können. Und als er da war, da haben sie vielleicht innerlich geschwärmt von einem Medium, das ihnen die Möglichkeit geben würde, Bilder in Bewegung zu sehen. Und dann kam das Fernsehen. Als es da war, da saßen sie schon halb erloschen auf ihrer Couch und sie träumten von etwas, das ›Fernbedienung‹ heißen, und das erlauben würde, dass sie unbewegt, dort halb kompostiert sitzen bleiben könnten und sie sich das, was ihnen die Netzhaut belichten würde, irgendwie abrufen und nacheinander sich einverleiben könnten.
Und all das geschah. Das Prinzip des telegenen Lebens kam in die Welt, und die Fernbedienung unterwarf sich den Lebensraum und wird es weiter tun. Ja, auch sie ist, was man rüstungstechnisch eine smart weapon nennt. Und man kann mit Carlo Mierendorffs schönem Aufsatz Hätte ich das Kino von 1920 sagen: Es ist nicht sinnlos zu fragen: Was wäre eigentlich, hätte ich das Fernsehen? Was für ein grandioses Medium für eine Gesellschaft, die in den Gründerjahren meinte, sich in diesem Medium selbst reflektieren zu können. Ein Medium also, das geeignet wäre, die disparaten Interessen einer Gesellschaft in Zirkulation zu bringen, Minderheiten miteinander in Verbindung zu setzen, partikulares Wissen, Gebiete des kulturellen Abseitigen miteinander zu vernetzen und dadurch etwas zu schaffen, in dem sich eine Öffentlichkeit bilden könnte. Wohlgemerkt nicht unter dem Rubrum, dass Demokratie in diesem Medium die Herrschaft der Masse sei, sondern dass sie der Schutz der Minderheit unter dem Protektorat der Masse sei.
Das wäre der nobelste Begriff von Demokratie und in ihr wäre das Fernsehen tatsächlich ein Medium der Aufklärung, die ja, laut Kant etwas im Auge hat wie »die Emanzipation vom infantilen Bann«. Inzwischen übt das Fernsehen diesen Bann lieber aus, vertieft ihn, rüstet ihn durch Gesinnung, durch Moral auf. Wenn wir da weiter träumen – und wir träumen weiter: Hätte ich das Fernsehen! – dann wäre es möglich, auf diese Weise all das, was in der Gesellschaft versprengt existiert, zum Sprechen zu bringen und damit unserem Begriff von Kultur einzuspeisen, einem insofern immateriellen Begriff von Kultur, als sie nicht im Kern aus dem besteht, was Bücher sind, was CDS, Operninszenierungen und DVDs bedeuten, was alles Warencharakter hat. Sondern im Kern besteht diese Kultur aus dem, was die Rezeption aller dieser Dinge aus unserer Kommunikation macht, d. h. in welcher Weise sie unser Trösten, Ahnen, Trauern, Begehren, Altwerden und so fort differenziert. Diese Form, Einsamkeit zu überbrücken, Kommunikation in einem emphatischen Sinn zu sein, das ist es eigentlich, was Kultur im immateriellen Sinne ausmacht, und so kann man ihr überall begegnen, wo sie im materiellen Sinne zerstört ist.
In dieses Gelände, dieses Weichbild der inneren Verfasstheit einer Gesellschaft, eines Bewusstseins zu einer speziellen historischen Situation, speist sich das Fernsehen ein. Als es erschien, da haben zwar die einen gedacht, es ist vom Teufel (und Argumente dafür lassen sich finden), aber es haben andere Leute festgestellt (und es waren die ersten Untersuchungen zum Fernsehen, die das ermittelten), dieses Medium erzeuge eine Art Verstehensillusion, d.h. Menschen fänden plötzlich, sie seien näher am Geschehen, sie könnten sich besser orientieren und kompetenter entscheiden. Aus dieser Orientierung, so wurde zumindest gedacht, könne man eine veränderte Form des Handelns ableiten. Der Glaube, dass es sich beim Fernsehen um etwas Bewusstseinsbildendes und insofern abweichend Praxisanleitendes handeln könnte, war die Voraussetzung dafür, etwas zu stiften, was Rundfunkstaatsvertrag heißt. Dieser Rundfunkstaatsvertrag, der die Voraussetzung dafür ist, dass wir Gebühren zahlen, der also ein Pakt ist, den wir mit den Fernsehanbietern geschlossen haben, der sagt im Kern, dass die Grundversorgung – so ein zentraler Terminus dieses Vertragswerkes – alle verschiedenen Bereiche dessen betrifft, was die Aufklärung noch als Vernunft bezeichnet hat, nämlich den vollständig gebildeten Menschen, der ein Verhältnis findet zwischen Rationalität, seinen materiellen und allen kulturellen Interessen, die ein Mensch haben könnte.
Wenn das so ist, dann würde eine gleichmäßige Versorgung der Nachrichten, der Kultur, des Sports, der Unterhaltung usw. im Fernsehen gleichermaßen repräsentiert sein müssen. Dann wäre unsere finanzielle Leistung für dieses Fernsehen, die ja eine verkappte Steuer ist, verbunden mit dem Anspruch auf eine bestimmte Form der Empormenschlichung, wie Robert Musil es nannte. Dergleichen sollte ein Medium leisten, das alle finanzieren, das wahrhaft Massenmedium ist und demokratisch, gleichmäßig auf alle Schichten wirkend, gedacht ist. Soweit die Konjunktive des Fernsehens.
Von Pier Paolo Pasolini aber stammt der bittere Satz: »Die wahre Antidemokratie ist die Massenkultur« – gesagt zu einer Zeit, als man dachte, das Volk habe Interessen, die man im Auftrag der Kultur nicht verraten dürfe. Inzwischen scheinen die Interessen des Volkes weitgehend ökonomische zu sein und man setzt voraus, im Augenblick, da es nur Geld hat, wird es schon glücklich sein – um festzustellen, dass in jenem Augenblick die Leere beginnt, die Ratlosigkeit vor der Realität und die Orientierungsstörung.
Das Fernsehen ist Massenkultur und es hat, so fürchte ich, nach einiger Zeit begonnen, die Interessen der Massen eben diesen Massen wegzunehmen, d. h. sie zu sedieren, sie auf andere Felder zu lotsen, ihnen Illusionen zu vermitteln, ihnen bestimmte Formen des Denkens, des Fühlens, vor allen Dingen des moralischen Urteilens anzudienen, sie auf diese Weise in ein einziges massenförmiges Individuum zu übersetzen, das letztlich der Glotzer ist, der das, was er da sieht, die Glotze nennt. Dabei hat Françoise Sagan in den 1960er-Jahren so schön gesagt: »Das Fernsehen hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht.« Ja, es ist zu einer Form der Gesellschaftsanleitung, der Gesellschaftsbildung, aber gleichzeitig zur gesellschaftlichen Deformierung geworden. Man kann also sagen, immer noch auf der Spur des Satzes von Pier Paolo Pasolini, wenn Massenkultur geeignet ist, uns unsere vitalen Interessen wegzunehmen, dann könnte man umgekehrt fragen: Worin bestehen denn diese vitalen Interessen? Wie müsste ich sie also formulieren, wenn ich sie retten wollte?
Nun, mit einem schönen lästerlichen Satz von Gottfried Benn gesagt: »Penthesilea wäre nie geschrieben worden, wenn vorher darüber abgestimmt worden wäre.« Das heißt, alles, was wir innerhalb der Kultur für bedeutend halten, ist irgendwann einmal Teil einer Minderheit gewesen. 90 Prozent dessen, wonach wir Straßennamen benennen, Denkmäler errichten, Texte veröffentlichen, Preise verleihen etc. sind Menschen gewesen, die ihre Verleger und Agenten ruiniert haben, die abweichend dachten, die bewusstseinserweiternde Substanzen über jede Vernunft hinaus pflegten und die nicht zu dem taugen, was Frauke Ludowig als vorbildlichen Menschen bezeichnen würde. Ich sehe, Teile von Ihnen wissen sogar, wer Frauke Ludowig ist. Sie sollten sich schämen! Ich könnte eine Parenthese zu Frauke Ludowig machen und sagen, zur Entpolitisierung des Fernsehens gehört auch, dass heute bestimmte gesellschaftliche Botschaften nicht mehr auf dem Wege der politischen Nachricht vertrieben werden, sondern über die bunte Nachricht. Die bunte Nachricht, der sogenannte ›Boulevard‹, er sagt uns, dass Amy Winehouse vom Teufel ist, weil sie zu viele Drogen genommen hat, und in dieser Durchsetzung des ungesunden Menschenverstandes ist der Boulevard moralisch performativ. Denken Sie, ehemals hat das FBI sogar zugegeben, politische Kampagnen wie die gegen Martin Luther King zunächst über den Boulevard-Journalismus einzuleiten. Aber ich mache keine Parenthese zu Frauke Ludowig. Man kann jedoch sagen, der Boulevard-Journalismus ist heute an der Demontage oder auch am Aufbau von Personen – sehr gut studierbar am Falle Guttenberg – sehr viel intimer beteiligt, als es zum Teil das politische Fernsehen ist. Deshalb ist Frauke Ludowig eben nicht ganz so boulevardesk, auch wenn sie so grotesk sein mag, wie sie zunächst erscheint.
Das alles bedeutet, das Fernsehen erschuf in den Frühzeiten seiner Entwicklung eine Art Verblendungszusammenhang, der darin bestand, dass man zunächst dachte, Probleme seien leichter lösbar, Entscheidungen seien leichter zu fällen. Dem Bild wurde auf eine ganz andere Weise getraut, als das jemals zuvor der Fall gewesen war, und glaubte man zunächst noch an einen Zusammenhang von Bild und Information oder Botschaft, so verselbstständigte sich der reine Schauwert des Bildes mehr und mehr und löste sich vom Ideologischen und auch Aufklärerischen allmählich ab.
Lassen Sie es mich mit einer plakativen Episode illustrieren: Ich bin einmal vor zahlreichen Jahren in Gütersloh bei Bertelsmann aufgetreten, was ich nicht hätte tun sollen. Es war ein Tag, an dem viele Bertelsmann-Vertreter zugegen waren und ich wurde eingeladen, einen Vortrag zur Kritik des Fernsehens zu halten. Das tat ich und machte aus meinem Herzen keine Mördergrube. Danach gab es beim Chef von Bertelsmann einen Empfang im Garten. Alle standen und lösten den Schlips im Augenblick, in dem der Chef von Bertelsmann das auch tat. Es gab dort irgendeinen großen amerikanischen Medienmacher, dessen Namen ich nicht kannte; nennen wir ihn Mr. Jones. Mr. Jones, der offenbar die Fäden in Amerika zog, stand neben mir und Herrn Middelhoff, der damals der Chef von Bertelsmann war, stand da und sagte zu ihm: »Did you listen to his speech?« Und der sagte dann: »Sorry I missed it, what was it about?« Daraufhin erwiderte Middelhoff, mich anguckend: »Content.« Und dann blickte mich Herr Jones an und fragte: »And, are you for or against it?«
Das ist die Frage. Die Grundfrage ist nicht mehr: Sind Sie für bestimmte Inhalte, sind Sie für Aufklärung, sind Sie für/gegen Chauvinismus, Revanchismus oder die Darstellung psychischer Kranker in Heimatfilmen, sondern die Grundfrage ist: Sind Sie für oder sind Sie gegen Inhalt? Und als ich sagte: »I’m for«, erwiderte er: »Shame on you.« Das heißt, ich gehörte zu denen, die immer noch Probleme machen, dadurch, dass sie sagen, es geht im Fernsehen um irgendetwas anderes als um die Erwirtschaftung von Profit oder von Marktanteilen. D. h., jede Haltung, die das nicht berücksichtigt und die das nicht selbst auf die Tagesschau anwendet, ist im Kern eine träumerische, eine illusionäre und nur noch bei Kinderpornografie, bei Antisemitismus und vielleicht noch bei Rechtsradikalismus gibt es bestimmte Formen des reflexartigen Einspruches, aber sonst ist das Fernsehen im Wesentlichen davon zusammengehalten, Quote machen zu wollen.
Nun kann man sagen, in vielerlei Hinsicht lässt sich das Fernsehen nicht durch das beschreiben, was es sichtbar macht, sondern durch das, was es zum Verschwinden bringt. Wir können z. B. sagen, dass Menschen mit komplexen Redeformen, Leute, die z. B. wie ich die Hypotaxe gerne mögen, also einen Satz, der nach der Kleist’schen Art gebaut ist: »Der Graf, indem er, das Pferd stand noch vor dem Stall, kurz überlegend, ob er im letzten belgischen Krieg nicht doch jene Frau, die nun in einem Unterrock an dem Fenster vorbeiging, hätte freien können, hatte in dem […].« Das geht nicht im Fernsehen! Wenn Sie nicht mehr eingeladen werden wollen in eine Sendung: machen Sie ein einziges Mal eine solche Hypotaxe, damit schaffen Sie es.
Man kann sagen, dass die Sprechform das eine ist, samt einer ambitionierten Vorstellung von der Art, wie gesprochen werden kann. Wie wenig Sie im Massenmedium Fernsehen abstrahieren dürfen, hat unter Umständen wenig Zusammenhang mit Ihrer Lebenspraxis. Es kann sein, dass Sie für Ihre Selbstbeschreibung Sprechformen brauchen, die das Fernsehen nicht duldet. Es kann sein, dass Sie Probleme haben, die nicht fernsehförmig sind. Und ein Mensch, der nicht integrierbar ist in eine Soap, fühlt heute schon, dass ihm etwas fehlt.
Im Grunde genommen werden Charaktere auch außerhalb des Fernsehens zu einem guten Teil danach beurteilt, welchen Stellenwert sie in der Lindenstraße einnehmen würden oder in Gute Zeiten schlechte Zeiten, welchen charakterologischen Typ sie bilden oder was Dieter Bohlen über sie sagen würde. D. h., die Ausbildung einer vollständigen Persönlichkeit ist etwas, was Heidi Klum zwar simuliert, was aber letztlich in einer solchen Sendung niemals überhaupt eine Rolle spielen kann. Betrachten Sie all das nicht als schnöden Trash. Auch auf der tagespolitischen Agenda des Fernsehens hat sich die Bild-Zeitung weitgehend durchgesetzt und massenhaft vorbildlich ist, was sich in der Massenabstimmung durch die Fernbedienung bewährt hat.
Es lässt sich also erkennen, wie die Massenabstimmung durch die Fernbedienung und die Willfährigkeit der Macher das Verschwinden von Sprechformen fördern. Es ist nicht wenig bigott, wenn dieselben Inhaber einer potenziellen Volksbildungsanstalt auf die geringe Alphabetisierung von Jugendlichen oder die Ergebnisse von PISA-Studien verweisen und die Alleinverantwortung Lehrern und Eltern zuschieben. Nein, das Fernsehen hat weiß Gott andere Probleme als den geringen Bildungsstand der Bevölkerung.
Abe...