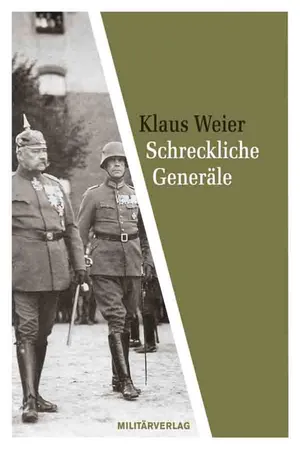
- 350 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Jahrzehntelang hielt sich in der Bundesrepublik das Bild von der "sauberen Wehrmacht". Einzig der Befehlsnotstand habe die Militärs zu Handlungen gezwungen, die ihren humanistischen Überzeugungen widersprachen. Klaus Weier räumt mit dieser Legende endgültig auf und liefert anhand von Archivunterlagen und Selbstzeugnissen eine faktenreiche Abrechnung mit dem deutschen Militarismus sowie den Kriegsplänen seit 1919 und schlägt den Bogen bis zu den Verbrechen der Gegenwart im Irak oder in Libyen.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Schreckliche Generäle by Klaus Weier in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & German History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. Kapitel
Ansichten deutscher Militärs zur Führung eines Krieges (1919-1936)
1. Zur Fehleinschätzung des kaiserlichen Generalstabes 1914
Der bedeutende preußische Militärreformer Carl von Clausewitz hatte sich umfassend mit den zahlreichen Kriegen seiner Zeit und deren Organisation und Führung befasst. Dabei war er zu der Grunderkenntnis gekommen, dass jeder Krieg sowohl unter den Bedingungen der strategischen Offensive als auch der Defensive stattfinden kann. Daraus zog er die Schlussfolgerung, dass zwischen Angriff und Abwehr ein enges Wechselverhältnis bestehen muss, sich der Sieg aber nur mittels eines Angriffes erringen lässt. Von Clausewitz forderte daher von jeder Armee, beide Kampfarten zu beherrschen, um einen Krieg erfolgreich führen zu können.1
Entgegen diesen grundsätzlichen Clausewitz’schen Erkenntnissen zur Kriegführung hatte der kaiserliche deutsche Generalstab in Vorbereitung auf den Ersten Weltkrieg ausschließlich auf einen Angriffskrieg gesetzt. Die proklamierte »Vernichtungsstrategie« und der »Schlieffenplan« – er sah strategische Offensiven mit kriegsentscheidenden Zielen an allen Fronten vor – sollten den Sieg in relativ kurzer Zeit garantieren. Die Möglichkeit, Kampfhandlungen unter den Bedingungen der strategischen Defensive führen zu müssen, wurde von den kaiserlichen Militärs als ein ausgesprochenes Element der Schwäche angesehen. Die Abwehr hatte deshalb – wie General der Artillerie W. R. von Leeb in den 30er Jahren konstatieren musste – »ein stiefmütterliches Dasein« geführt.2
Die Realität des Ersten Weltkrieges widersprach jedoch schnell den Vorstellungen des kaiserlichen Generalstabes. Seine geplante Führung als beweglicher Angriffskrieg erwies sich an der Westfront bereits nach kurzer Zeit als falsch. Die deutschen Offensiven wurden durch die französischen Truppen erfolgreich abgefangen. Das kaiserliche deutsche Heer sah sich gezwungen, an breiter Front vom Angriff zur Abwehr überzugehen und um deren Geschlossenheit erbittert zu kämpfen. Der kaiserliche Generalstab musste unerwartet und völlig überrascht seine Kriegführung den Bedingungen eines Stellungskrieges anpassen.3 Doch seine Truppen waren weder auf einen erfolgreichen Durchbruch französischer Stellungen noch auf das Führen von eigenen Abwehrkämpfen in der strategischen Defensive über einen längeren Zeitraum vorbereitet und deshalb auch nicht in der Lage notwendige Veränderungen herbeizuführen.
Im Rahmen des Stellungskrieges entstand zunächst das System der starren, tiefgestaffelten Stellungsverteidigung. In den Jahren 1917/18 wurde schließlich das System der elastischen Verteidigung, die so genannte »bewegliche« oder Manöververteidigung entwickelt. In beiden Verteidigungssystemen erreichte die Abwehr im operativen Rahmen ein Ausmaß von vier bis zwölf Kilometern. Im weiteren Verlauf der Kämpfe erfuhr der taktische Bereich zunehmend eine stärkere Ausdehnung in die Tiefe. In ihm wurden mehrere Verteidigungsstreifen mit zwei bis vier Stellungen angelegt. Beim Einsatz der Kräfte und Mittel in den Stellungen ging man von einer zunächst gleichmäßigen Verteilung zur Bildung von Abwehrschwerpunkten über, die pioniermäßig mit betonierten Feuerpunkten, beschusssicheren Unterständen sowie zusätzlichen Riegelstellungen zu starken Widerstandsknoten ausgebaut wurden. Dadurch gelang es immer besser, einen durchgebrochenen Frontabschnitt zu schließen, wenn auch mitunter erst in einer zurückliegenden Stellung. Ein taktischer Durchbruch in die operative Tiefe konnte so verhindert werden und der Zusammenhang der Gesamtfront blieb bewahrt. Durch diese Entwicklung erreichte die Abwehr zunehmend eine größere Wirksamkeit, nicht nur bei Angriffen der Infanterie, sondern auch bei deren Unterstützung durch Artillerie, Panzer und Flugzeuge.
Das rasche Scheitern des Schlieffenplanes an der Westfront und die insgesamt ungenügende Vorbereitung der Truppen, Kampfhandlungen auch in der strategischen Defensive führen zu können, trugen wesentlich zur militärischen Niederlage des kaiserlichen Deutschland im Ersten Weltkrieg bei. Beides zwang die deutschen Militärs so direkt zur »militärischen Schmach« von Versailles.
2. Die Machtlosigkeit des Militärs nach dem Vertrag von Versailles 1919
Wie prekär für die deutschen Militärs Ende des Jahres 1918 die Situation war, zeigte eine Beratung von Offizieren des kaiserlichen Generalstabes, die am 26. Dezember unter Leitung des Generalquartiermeisters, General Groener, in Berlin stattfand. Die Analyse der militärischen und politischen Lage führte bei den Militärs zu folgender Erkenntnis: »Niemand darf aufstecken; alle müssen fest zusammenstehen; die Oberste Heeresleitung muss unter allen Umständen ihre Arbeit fortsetzen, komme, was immer wolle, […] früher oder später […] werden wir die Macht wiedererlangen«.4
Ein erster Schritt auf dem Weg zur Wiedererlangung der Macht war der Erlass vom 6. März 1919 für das »Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr« durch die im Februar 1919 gewählte Nationalversammlung der neuen Weimarer Republik. Pikanterweise hatte die Oberste Heeresleitung den Entwurf dafür selbst erarbeitet. Er sah als wesentlichste Maßnahme vor, das Offizierskorps der neuen Armee aus den Generalsstabsoffizieren des alten kaiserlichen Heeres zu bilden. Damit setzte sich das wichtigste Machtinstrument der neuen deutschen Republik ausgerechnet aus jenen Kräften zusammen, die – wie einer, der es wissen musste, später schrieb – »aus Tradition antimarxistisch bis auf die Knochen« waren.5 Doch damit hatte der kaiserliche Generalstab erreicht, dass »das […] stärkste Element des alten Preußentums in das neue Deutschland hinübergerettet« wurde.6
Nur wenige Monate später, am 27. Juni 1919, überreichte die Oberste Heeresleitung dem neuen Reichspräsidenten Friedrich Ebert eine Denkschrift mit dem Titel: »Richtlinien für unsere Politik«. Die Forderungen der Militärs an die Politik lauteten: »Deutschland muss vor allen Dingen innere Politik betreiben. Dazu gehören in erster Linie die restlose Wiederherstellung der Staatsautorität und dann die Sanierung unseres Wirtschaftslebens. […] Unter den größten Anstrengungen und dank der selbstlosen und hingebenden Mitarbeit des Offizierskorps ist es gelungen, in der Reichswehr ein einigermaßen brauchbares Instrument für die Regierung zu schaffen. Dieses Instrument muss nun aber rücksichtslos eingesetzt werden, um auf allen Gebieten […] die Staatsautorität zu sichern. […] Die Gesundung unseres Wirtschaftslebens, die Vorbereitung für jeden Wiederaufbau […] ist […] hauptsächlich von zwei Dingen abhängig: Ordnung und Arbeit. Das bedeutet unter den derzeitigen Verhältnissen Belagerungszustand und Streikverbot«.7
Welch ein »Bekenntnis« zur gerade erst gewählten Weimarer Republik.
Ende Juni 1919 trat der Vertrag von Versailles in Kraft. Seine militärischen Bestimmungen trafen die deutschen Militärs wie ein Schlag mit einer riesigen Keule und lasteten für Jahre wie ein Fluch auf allen ihren Bemühungen zur Erhaltung und Wiedererlangung ihrer militärischen Macht. Der kaiserliche Generalstab – das Hirn der alten Armee – musste aufgelöst und die allgemeine Wehrpflicht aufgehoben werden. Die zahlenmäßige Stärke der künftigen deutschen Streitkräfte wurde auf 100.000 Mann beim Heer sowie auf 15.000 Mann bei der Kriegsmarine begrenzt. Die alte Kriegsflotte war ganz abzuliefern und der Besitz schwerer sowie moderner Waffen, wie Panzer, Flugzeuge und U-Boote verboten. Die Heeresstruktur wurde auf sieben Infanterie- und drei Kavallerie-Divisionen festgelegt, deren Ausrüstung aus 792 schweren, 1134 leichten Maschinengewehren (M.G.) sowie 252 Minenwerfern zu bestehen hatte. Außerdem durfte Deutschland nur wenige, größtenteils veraltete Festungen, behalten und keine neuen Befestigungsanlagen an den deutschen Grenzen errichten. Besonders hart traf die deutschen Militärs die Festlegung, zur Sicherheit Frankreichs und Belgiens, rechts des Rheines, eine 50 Kilometer breite entmilitarisierte Zone zu schaffen.
Um zumindest den Großen Generalstab – die wichtigste Institution der deutschen Militärs zur Führung eines Krieges – zu retten, wurde am 3. Juli 1919 – also bereits wenige Tage nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages – die Oberste Heeresleitung mit Sitz in Kolberg aufgelöst und dafür die Kommandostelle Kolberg unter Leitung General Groeners gebildet.
Am 1. Oktober 1919 musste auf Drängen der Ententemächte der Große Generalstab offiziell liquidiert werden. Trotzdem blieb er erhalten, denn an seine Stelle trat insgeheim das neu geschaffene »Allgemeine Truppenamt« mit seinen Abteilungen: T1 Heeresabteilung, T2 Heeresorganisationsabteilung, T3 Heeres-Statistische Abteilung und T4 Heeresausbildungsabteilung. Das »Allgemeine Truppenamt« wurde zur bedeutendsten Dienststelle beim Chef der Heeresleitung im Reichswehrministerium. Es entwickelte sich in relativ kurzer Zeit zum Führungsstab der neuen Armee. Nach Meinung des späteren Generals Erfurth stellte es »den Traditionsträger des Großen Generalstabes dar« und wurde »sehr rasch wieder zu einer Schule einheitlichen operativen Denkens«.8 Noch am gleichen Tag entstand das Reichswehrministerium als oberste Kommandobehörde der zu schaffenden neuen Streitkräfte der Weimarer Republik.
Die militärischen Festlegungen des Versailler Vertrages führten dazu, dass die regulären Streitkräfte der gerade erst gegründeten Weimarer Republik nicht in der Lage waren, auch nur kurzzeitig erfolgversprechende Kampfhandlungen gegen irgend eine Armee eines anderen europäischen Staates zu führen. Die verbliebene deutsche Rumpfarmee – dem Charakter nach mehr eine Polizeitruppe – konnte nicht einmal ihrer Verfassungsaufgabe: den Schutz und die Sicherheit der Weimarer Republik zu gewährleisten – gerecht werden.
Ausgehend von dieser konkreten militärpolitischen und militärischen Situation musste zwangsläufig die stufenweise Revidierung des Versailler Vertrages in dem Mittelpunkt aller Überlegungen und Planungen der deutschen Militärs rücken. Dabei lautete der Grundsatz: Auch wenn es den Bestimmungen des Versailler Vertrages widerspricht: Es ist alles erlaubt, was der Sicherheit und der Verteidigung des Landes dient, auch das Risiko eines neuen Krieges.
Die Realisierung dieser globalen Zielstellung wurde von den Militärs als ein längerfristiger und vielschichtiger Prozess betrachtet, der sich nur schrittweise und unter der ständigen Gefahr militärischer Reaktionen der alliierten Siegermächte – insbesondere Frankreichs – verwirklichen ließ. Im Mittelpunkt standen dabei zwei parallel verlaufende Aufgaben, die sich wie ein roter Faden durch die Militärpolitik und -wissenschaft der 20er und 30er Jahre bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges zogen:
1. Der Aufbau einer Massenarmee, ausgerüstet mit modernsten Waffen und jedem Gegner überlegener Kampftechnik, deren Strukturen dem militärischen Charakter des zukünftigen Krieges so angepasst waren, dass der Sieg auf jedem einzelnen Kriegsschauplatz errungen werden kann.9
2. Die Erarbeitung von Grundsätzen, die dem Charakter des Krieges der Zukunft, insbesondere den Methoden seiner Führung – zunächst für die Verteidigung und später auch für den Angriff – am besten entsprachen.
3. Vorstellungen zur Führung eines »Befreiungskrieges« 1924/25
Festlegungen zur Gefechtsführung eines zukünftigen Krieges fanden erstmals ihren Niederschlag in der Vorschrift »Führung und Gefecht«.10 Sie wurde bereits im Jahre 1922 in Kraft gesetzt, bis 1934 neunmal aufgelegt und zum Vorläufer der Herresdienstvorschrift 300 »Truppenführung« (H.Dv.300), deren Teil 1 im Jahr 1933 und deren Teil 2 1934 erschienen. In der Vorschrift »Führung und Gefecht« orientierten die deutschen Militärs – im Unterschied zum kaiserlichen Generalstab vor 1914 – auf neue Grundsätze und Verfahren bei der Truppen- und Kriegführung. Sie basierten auf einer gründlichen Auswertung der Erfahrungen des Ersten Weltkrieges sowie des militärischen Erkenntnisstandes anderer europäischer Staaten und deren Armeen. Das zeigte sich insbesondere in der Tatsache, dass die Erfahrungen des praktischen Einsatzes von Panzer- und Fliegerkräften bei der Stellungs- bzw. Manöververteidigung im Ersten Weltkrieg verallgemeinert worden waren. So sollte vor allem ihr Masseneinsatz auf operativ-taktischer Ebene einen neuen Stellungskrieg verhindern und den angestrebten Bewegungskrieg wieder möglich machen, da nur er den Sieg sichern konnte.
Diese Vorstellungen der deutschen Militärs blieben zunächst reine Theorie. Die Realität sah ganz anders aus. Ihre Truppen waren zu dieser Zeit zu keinerlei kriegerischen Handlungen in der Lage. Das zeigte sich besonders gravierend im Jahr 1923. Gewehr bei Fuß stehend, musste die Reichswehrführung tatenlos und ohnmächtig zusehen, wie am 11. Januar französische und belgische Truppen in die entmilitarisierte Rheinlandzone einmarschierten und das Ruhrgebiet besetzten. Für die militärische Elite Deutschlands bedeutete diese Aktion ihres »Erzfeindes« Frankreich – nach der militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg, den Novemberereignissen im Reich und dem Friedensdiktat von Versailles – den vierten Schock seit 1918.
In Auswertung – nicht nur aus Sicht der Militärs war es ein Willkürakt – begannen sich die Führungsstäbe der Reichswehr ganz gezielt mit Fragen eines Krieges und seiner Führung zu befassen. Die dazu im Verlauf des Jahres 1923 durchgeführten Plan- und Kriegsspiele bestätigten jedoch allesamt, dass die zur Verfügung stehenden Truppen nicht einmal kurzfrist in der Lage waren, in einem aufgezwungenen Krieg erfolgversprechende Kampfhandlungen zu führen.11
Diese Tatsache bildete den Diskussionsstoff für einen internen Kreis von Reichswehroffizieren im Truppenamt, deren Erkenntnisse schließlich durch Oberst von Stülpnagel in einer Denkschrift zum Thema »Gedanken über den Krieg der Zukunft« zusammengefasst wurden.12 Besagter Oberst war zu dieser Zeit Chef der als Heeresamt (T1) getarnten Operationsabteilung im Truppenamt des Reichsheeres. Er kannte sich mit der Planung eines Krieges bestens aus, hatte er doch bereits unter Generalfeldmarschall Erich von Luden...
Table of contents
- Cover
- Impressum
- Titel
- Vorwort
- 1. Kapitel Ansichten deutscher Militärs zur Führung eines Krieges (1919-1936)
- 2. Kapitel Grundsätze zur Vorbereitung eines Angriffskrieges unter den Bedingungen mehrerer Fronten (1937-1939)
- 3. Kapitel Operationsführung gegen die Rote Armee bis zum Sommer 1943
- 4. Kapitel Der erzwungene Übergang zur Defensivstrategie im Herbst 1943
- 5. Kapitel »Ganz Ostdeutschland muss unverzüglich eine tiefgegliederte Festung werden«
- 6. Kapitel Der kompromisslose Kampf führt schließlich in die endgültige Katastrophe. Frühjahr 1945
- Schlussbemerkungen
- Anmerkungen