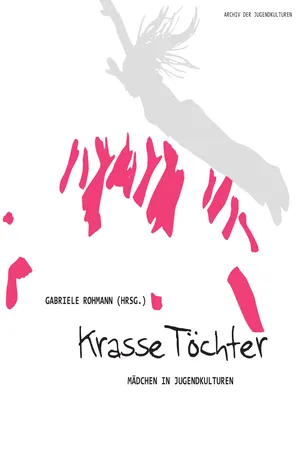![]()
![]()
Marion Schulze
Mädchen im Hardcore: Not Just Boys’ Fun?
„I was just ‚fuck yeah, this is what I want to be about‘ and I fell in love“ (Kucsulain 2000)
![]()
Verse, London 2006
Foto: Jan Urant
![]()
Hardcore ist eine musikbasierte Jugendsubkultur1, die als radikale Reinterpretation des Punks definiert werden kann und sehr männlich dominiert ist. Hauptakteure sind auf den ersten Blick Jungen. Die Konzerte werden in der Mehrzahl von männlichen Jugendlichen besucht, organisiert und in Internet-Foren diskutiert. Auch die Bands bestehen zum Großteil aus jungen Männern. Neben den Konzerten sind es so unterschiedliche Aspekte wie eigene Produktions- und Distributionsnetze, Internetseiten- und Foren sowie die Musik auf Tonträgern, Freundschaften und vor allem Hardcore als ‚Lebensstil‘, die diese Jugendsubkultur ausmachen. Das Altersspektrum der Konzertbesucher rangiert zwischen 16 und 35 Jahren; das Durchschnittsalter liegt zwischen 20 und 25 Jahren. Häufig kann zur Geschichte des Hardcore gelesen werden, dass mit dem Entstehen von Hardcore aus dem ‚geschlechter-egalitären‘ Punk eine männlich geprägte Jugendsubkultur entstand, in der die Mädchen2 vor allem durch das aggressive Tanzen zunächst an den Rand und dann regelrecht aus dem Hardcore herausdrängt wurden (ausführlich dazu Leblanc 2001, S. 51). Trotz allem oder gerade deswegen kommt es in Interviews immer wieder vor, dass Mädchen sagen, dass sie sich beim ersten Besuch eines Hardcore-Konzerts in Hardcore verliebt haben. Doch was passiert, wenn Mädchen sich in diese männlich dominierte Jugendsubkultur verlieben und teilhaben wollen? Hier soll ein wenig näher auf diese ‚Liebesgeschichte‘ eingegangen werden.
Auf wissenschaftliche Erkenntnisse ist dabei kaum zurückzugreifen. Wissenschaftlich ist im Vergleich zu anderen Jugendsubkulturen sehr wenig zu Hardcore (Goldthorpe 1992, Willis 1993, Ward 1996, Inhetveen 1997, Budde 1997, Tsitsos 1999, Hitzler et al. 2001, S. 55–68, Müller 2001) gearbeitet worden. Hauptsächlich stehen dem wissenschaftlichen Lesepublikum vereinzelte Artikel oder Buchkapitel zur Verfügung, die sich vor allem auf Hardcore Mitte der 1980er-Jahre bis Mitte der 1990er-Jahre beziehen. Ein großer Anteil der Literatur besteht aus semi-wissenschaftlichen Büchern und Artikeln von ‚Insidern‘ (Belsito & Davis 1983, Cheslow et al. 1992, Büsser 1996, Lahickey 1997, O’Hara 1999, Blush 2001). Allein der mit Hardcore verbundene Lebensstil „straight edge“ – die Ablehnung von Alkohol, Zigaretten und jeglicher anderer Drogen sowie von Promiskuität – hat immer wieder das Interesse der Medien und seit wenigen Jahren vermehrt auch das der Wissenschaft auf sich gezogen, vor allem in Form von Dissertationen und darauf basierenden Artikeln und neuerdings Büchern (Wood 1999, Irwin 1999, Staudenmeier & Helton 2002, Haenfler 2004, Williams & Copes 2005, Atkinson & Wilson 2005, Atkinson 2006, Haenfler 2006, Wood 2006). Im interkontinentalen Vergleich fällt auf, dass fast alle Arbeiten aus Nordamerika stammen, obwohl Hardcore in Europa, Südamerika und Asien (hier vor allem in Japan) schon sehr früh Fuß gefasst hat. Ist das Schreiben über Hardcore schon eine akademische Randerscheinung, so ist noch weniger zu den Erfahrungen der Mädchen im Hardcore in der wissenschaftlichen Literatur zu finden. Zu diesem Thema ist mir nur eine veröffentlichte Arbeit bekannt (Roman 1988), Haenfler (2006) widmet jungen Frauen im „straight edge“ ein Kapitel. Es sind dementsprechend noch enorme Forschungslücken zu schließen.
Im Folgenden soll nach einer kurzen Beschreibung des Hardcore gezeigt werden, wie Prozesse und Praktiken innerhalb des Hardcore die Beteiligung und Laufbahn der Mädchen im Hardcore mitbestimmen, aber auch im Gegenzug, wie Mädchen an diesen Prozessen und Praktiken mitwirken, das heißt welche Strategien des Umgangs mit ihnen die jungen Frauen entwickeln.3
Hardcore – More than Music
Hardcore hat seine Wurzeln in den von Ronald Reagan regierten Vereinigten Staaten Anfang der 1980er-Jahre und ist heute weltweit verbreitet. Entstanden aus dem Punk, wurde im Hardcore zum Beispiel das Prinzip des Do-It-Yourself übernommen, der Nihilismus des Punk jedoch vehement abgelehnt. Die Musik ist für radio-geprägte Ohren gewöhnungsbedürftig. Sie ist gezeichnet von aggressiv klingenden Gitarren und einer schreienden Stimme. Die Konzerte sind belebter als ‚Standard-Rockkonzerte‘. Sie sind es, die diese Jugendsubkultur zusammen halten. Hier wird Hardcore sichtbar, zum Leben erweckt und am Leben erhalten. Während eines Konzerts entsteht vor der Bühne ein kreisförmiger Raum – der „pit“ –, in dem getanzt wird: Es wird von rechts nach links gelaufen oder es werden auf der Stelle von Kampfsportarten beeinflusste Bewegungen vollzogen. Diese Bewegungen sind oft sehr ausgreifend und werden sehr kraftvoll ausgeführt. Während die einen tanzen, singen andere in das vom Sänger – sehr selten von einer Sängerin – hingehaltene Mikrophon die Liedtexte mit oder springen auf die Leute, die mitsingen, um auch noch ein paar Zeilen mitzuschreien. Am Rand, um den „pit“ herum, steht der Rest der Besucher, schaut der Band zu, bewegt sich eher wenig. Andere reden außerhalb des Konzertraumes miteinander oder schauen die T-Shirts, Platten und CDs oder selbstproduzierten Magazine an, die von den Bands oder Privatpersonen auf Tischen angeboten werden. Auffallend ist jedoch immer wieder, dass nur wenige Mädchen auf den Konzerten sichtbar präsent sind. Die meisten Mädchen stehen im Hintergrund und schauen vom Ende des Raumes aus der Band zu. Einige stehen auf der Bühne und fotografieren oder sitzen hinter den Verkaufstischen der Band. Auf und direkt vor der Bühne sind Mädchen rar – kurz: Rund dreiviertel der Konzertbesucher können als männlich und jung beschrieben werden.
Es ist jedoch vor allem Hardcore als Lebenseinstellung, als ‚Lebensstil‘, was diese Jugendsubkultur ausmacht. Hardcore ist „more than music“ und dies wird in Fanzines, Gesprächen, Internetseiten und besonders in den Texten der Bands deutlich. Auch wenn die Musik aggressiv erscheint, handeln die Texte davon, sich trotz aller Missstände nicht unterkriegen zu lassen, stark sein zu wollen, ja, aktiv positiven Einfluss auf sich selbst und auf die Gesellschaft ausüben zu wollen: „To wake up and live“ und sein Leben in die Hand zu nehmen. Dies kann sich in den mit Hardcore verbundenen ‚Lebensstilen‘ wie Vegetarismus und Veganismus oder „straight edge“ äußern.4 Auch das Ausgrenzen von Mädchen, Sexismus und Rassismus wird kritisiert und diskutiert. Aber ebenso wird von Hass und Unmut über gesellschaftliche Zustände gesungen. Der Zusammenhalt, die unity, ist ein weiteres wichtiges Thema sowie die Relevanz von Freundschaften.
Mosh it up ! – Vergeschlechtlichte und vergeschlechtlichende Prozesse und Praktiken
Beginnen Mädchen – wie auch Jungen – auf Hardcore-Konzerte zu gehen, werden sie mit einer Kultur konfrontiert, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert existiert und in der es bestimmte, oft männlich geprägte Verhaltensnormen, Prozesse und Praktiken, aber auch bestimmte Geschlechterbilder gibt, die erlernt oder mit denen sich auseinandergesetzt werden muss. Auch die Bilder, die Mädchen von sich als Mädchen entwerfen, sind stark mit ihrer Laufbahn im Hardcore verzahnt. Dies wird anhand ihrer Erzählungen deutlich:
Auf einem Konzert Ende 2006 spreche ich mit einer Sängerin, die vor kurzem aus ihrer ansonsten nur aus männlichen Mitgliedern bestehenden Band ausgestiegen ist. Sie erzählt mir, das, was sie am meisten geärgert habe, die Nicht-Akzeptanz ihres Talentes gewesen sei. Sie sei beim Singen auf gleicher Höhe mit den Jungen, sei aber immer in erster Linie als Mädchen und nicht als Sängerin gesehen worden. Vor allem die anderen Sänger, die sie traf, hätten eher mit Erstaunen und Entsetzen auf ihre Stimme reagiert. Meistens hätten sie Erstaunen darüber geäußert, dass aus einer so zierlichen Person solch eine Stimme kommen könne. Was sie auch gestört habe, seien die Blicke der Mädchen im Publikum gewesen, wenn sie auf der Bühne war. Entweder hätten diese sie mit neidvollen Blicken angeschaut oder mit der Sorge, dass ihre Freunde sich für sie interessieren könnten. Auf der anderen Seite vermisse sie es sehr mit der Band herum zu fahren und neue Leute kennen zu lernen und auch die Art des Umgangs unter den Jungen liege ihr mehr als der unter den meisten Mädchen. Die Jungen seien direkter miteinander, man könne ruhig „Arsch“ sagen und müsse nicht auf Wörter wie „Hintern“ oder „Po“ zurückgreifen. Damit komme sie besser zurecht. Sie wolle auf jeden Fall wieder in einer Band sein, aber nicht sofort.
Death is not glamorous, London 2006
Foto: Jan Urant
Eine ganz normale Stimme für das Mädchen – „ich schreie und so kommt es eben heraus“ – versetzt die Jungen in Erstaunen. Auf der Bühne geben ihr viele der zuschauenden Mädchen ein unangenehmes Gefühl, hinter der Bühne, beispielsweise im Tourbus, gefällt ihr hingegen der Umgang unter den Jungen. Hier zeichnet sich auch schon ein bestimmtes Geschlechterbild des Mädchens ab: Sie will gar nicht als Mädchen hervorgehoben werden, sondern einfach teilhaben, ohne dass dies an ihrem Geschlecht festgemacht wird.
In einem ersten Schritt möchte ich zeigen, wie Prozesse und Praktiken innerhalb des Hardcore die Beteiligung und Laufbahn von Mädchen in dieser Subkultur mitbestimmen. So beschreibt die Sängerin beispielsweise nur Mechanismen innerhalb des Hardcore, die sie aus der Band haben aussteigen lassen. Mein theoretischer Ausgangspunkt ist, dass die Art und Weise der Beteiligung von Mädchen nicht nur durch gesamtgesellschaftliche Geschlechterordnungen und Sozialisationsbedingungen zu erklären ist, sondern vor allem durch die Analyse von Prozessen und Praktiken innerhalb des Hardcore verstanden werden kann. Eine Anknüpfung an Theorien und Konzepte, die außerhalb der Jugendsubkulturforschung entstanden sind, kann sich hier als produktiv erweisen. Acker (1990, 1992), Goffman (1987) sowie Maihofer (2001) zeigen in ihren Arbeiten in unterschiedlicher Art und Weise die Bedeutung und Wirkmächtigkeit von Prozessen und Strukturen für Geschlechterverhältnisse in Institutionen auf. Acker betrachtet Organisationen von innen und zeigt in ihrem Konzept der „gendered substructure“, dass Organisationen nicht gender-neutral, sondern auf eine tief eingebundende Substruktur von Geschlechterunterschiede aufgebaut sind. Dies bedeutet, „gender is not an addition to ongoing processes […], it is an integral part of those processes“ (Acker 1990, S. 146). Goffman vollzieht eine ähnliche Denkbewegung und beschreibt, dass soziale Situationen Mechanismen und Strukturen enthalten, die die Individuen wiederholt und ritualisiert geschlechtsspezifisch handeln und damit Geschlechterdifferenzen entstehen lassen (Goffman 1987, S. 67). „Bedeutsam sind – neben den situationsspezifischen – vor allem die Mechanismen und Strukturen, die mit bestimmten ritualisierten Interaktionsabläufen oder sozialen Institutionen konstitutiv verbunden und damit gleichsam institutionalisierte ‚Handlungsanrufungen‘ sind“ (Maihofer 2004, S. 37). Nach Maihofer evozieren diese bei den Individuen ein „hochkomplexes und vielschichtiges Repertoire an vergeschlechtlichten Signalen, Handlungsweisen, Anrufungen und Wertungen, das […] geschlechtspezifisches Doing gender in Gang setzt, einübt, reproduziert und dauerhaft als körperliche, intellektuelle und emotionale geschlechtliche Habitusformen verfestigt“ (Maihofer 2004, S. 38, Hervorhebung im Original). Was hier anhand von Institutionen aufgezeigt wurde, könnte auch in der Jugendsubkulturforschung eine interessante Herangehensweise für die Analyse von Geschlechterverhältnissen sein. Das würde bedeuten, so Geschlechterverhältnisse in ihrer Komplexität verstanden werden wollen, eine Blickverschiebung hin zu vor allem diesen Mechanismen und Strukturen, zu Prozessen und Praktiken innerhalb der jeweiligen Jugendsubkultur vorzunehmen ist. Dies würde nicht nur eine analytische, sondern auch eine theoretische Blickverschiebung darstellen, und zwar weg von der Annahme, dass allein gesamtgesellschaftliche Geschlechterordnungen von außen in die Jugendsubkultur hineingetragen und dort reproduziert werden, wie es in der bisherigen Forschung oft gemacht wurde. Macdonald (2001) hat einen solchen Blickwechsel in ihrer Forschung zu Männlichkeit im Graffiti exemplarisch vorgeführt. Im Folgenden möchte ich dies anhand von Beispielen aus dem Hardcore verdeutlichen.
This is a fucking hardcore show. I want to see some blood on the floor!
Das Tanzen und Mitsingen hat auf Hardcore-Konzerten eine zentrale Bedeutung. Je nachdem wie stark dieser Zuspruch der ZuschauerInnen ausfällt, ist ein Konzert ein Erfolg oder nicht. In allen Beschreibungen dieses Tanzstils wird deutlich gemacht, dass er für Außenstehende wie ein Kampf aussieht: Haenfler (2006, S. 90) schildert das Tanzen als „full-contact sport“, Inhetveen beschreibt die Außenansicht mit dem Wort „Gewalt“ (Inhetveen 1997, S. 241). Vor allem das Adjektiv „aggressiv“ wird häufig in den Beschreibungen verwendet. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch klar, dass das, was wie ein Kampf aussieht, „reglementiert ist und subkulturellen Normen folgt, die erlernt werden müssen. […] Die verschiedenen Arten zu tanzen, Stagediving und Mitsingen sind weitgehend standardisiert und ritualisiert“ (Inhetveen 1997, S. 242). Dazu zwei Beschreibungen:
Bulldoze, London 2006
Foto: Jan Urant
Auf einem zweitägigen Hardcore Festival in London, organisiert von drei Mädchen, spielt Bulldoze, eine Band aus New York, die für ihre „Tough Guy Attitude“ – ein ultramaskulines Verhalten – und aggressive Musik bekannt ist. Wie zu erwarten, ist das Tanzen sehr aggressiv. Die Musik dieser Band ist so geschrieben, dass sie sich besonders für „violent dancing“ eignet, einen Tanzstil, der geprägt ist von mit voller Kraft schwingenden Armen, mit Tänzern, die in die Menge laufen und kurz vor Ankommen ein Bein bis in Brusthöhe hochwerfen und es seitlings in die Oberkörper der ste...