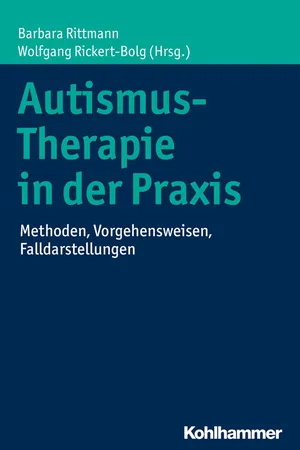![]()
Teil II
Methodenvielfalt in der Autismus-Therapie
![]()
Multimodale Autismus-Therapie in verschiedenen Lebensphasen – ein Fallbeispiel
Christina Müller
In Autismus-Therapiezentren erhalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) individuell zugeschnittene ambulante Therapien, die eine verbesserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen sollen (sog. Eingliederungshilfemaßnahmen). Die therapeutischen Maßnahmen folgen in der Regel keinem allgemeingültigen Standardprogramm, sondern werden für jeden Klienten individuell entwickelt. Hierfür nutzen Autismustherapeutinnen ein breites Spektrum an wissenschaftlich fundierten und/oder bewährten (»Best Practice«) Methoden, wie es z. B. bei Rittmann (2011, 2014) als »Multimodales Therapiemodell« beschrieben wird. Dabei werden nicht nur unterschiedliche Methoden für verschiedene Subgruppen im Autismus-Spektrum benötigt; auch bei einem Menschen mit ASS können sich die therapeutischen Vorgehensweisen im Verlauf der Entwicklung verändern.
Dies soll im Folgenden exemplarisch anhand eines Fallbeispiels aufgezeigt werden: Julian ist vom Vorschulalter bis ins junge Erwachsenenalter hinein – unterbrochen durch eine etwa 4-jährige Therapiepause – im Westfälischen Institut für Entwicklungsförderung (WIE) in Bielefeld gefördert worden. Das WIE bietet ambulante Einzel- und Gruppentherapien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit ASS an und arbeitet – auf der Grundlage der Leitlinien von autismus Deutschland (2011) zur Sicherstellung autismusspezifischer therapeutischer Förderung – analog zu den Autismus-Therapiezentren. Julians Unterstützungsbedarfe haben sich im Verlauf der Therapie immer wieder verändert, sodass die Angebote laufend angepasst wurden. Die hier vorgestellte Zusammenfassung der therapeutischen Arbeit mit Julian soll verdeutlichen, dass eine starke Individualisierung der therapeutischen Interventionen notwendig war, damit die Therapie entwicklungsförderlich sein konnte. Ferner soll aufgezeigt werden, dass dabei eine Vielzahl an Methoden benötigt wurde und dass der »Methoden-Mix« immer wieder verändert werden musste.
Die Fallbeschreibung ist selbstverständlich nicht vollständig; es können hier nur Ausschnitte aus dem komplexen Therapieangebot dargestellt werden.
Ausgangslage
Julian wird kurz nach seinem 4. Geburtstag von seinen Eltern im WIE vorgestellt. Er lebt zusammen mit zwei älteren Geschwistern (Bruder und Schwester) und einem jüngeren Bruder bei seinen Eltern und besucht eine Integrative Kindertagesstätte. Bei Julian sind eine allgemeine Entwicklungsverzögerung sowie ein Frühkindlicher Autismus in einem Sozialpädiatrischen Zentrum diagnostiziert worden.
Zur Vorgeschichte des Jungen berichten Julians Eltern, dass der Junge ein ruhiges, »pflegeleichtes« Baby gewesen sei. Mit etwa einem Jahr habe er begonnen, erste Wörter zu sprechen, und er sei mit 16 Monaten frei gelaufen. Die Eltern hätten um den 2. Geburtstag des Jungen herum begonnen, sich Sorgen zu machen, da der Junge keine Fortschritte in der sprachlichen Entwicklung gemacht und kaum gespielt habe; er sei überwiegend hin- und hergelaufen oder habe aus dem Fenster geschaut. Ab 3 Jahren habe er eine Kindertagesstätte besucht. Die Erzieherinnen hätten die Eltern bald auf Auffälligkeiten bei Julian angesprochen und empfohlen, dass der Junge in einem Sozialpädiatrischen Zentrum vorgestellt werde. Ferner sei ein Integrationsplatz für Julian eingerichtet worden.
Aktuell beschäftige sich Julian – so die Eltern – besonders gerne mit Spielzeugautos, er reihe diese auf und schiebe sie über Fensterbänke. Gerne blättere Julian auch in Auto-Zeitschriften. Ferner habe er ein großes Interesse an visuellen Effekten: Er betätige immer wieder die Lichtschalter und betrachte gerne die sich bewegenden Blätter der Bäume. Julian verfüge inzwischen über einen recht großen Wortschatz, er nutze die Wörter aber wenig zur Kommunikation. Wünsche signalisiere er meistens, indem er den Erwachsenen an der Hand führe. Insgesamt sei Julian ein ernstes Kind, das wenig Kontakt suche.
Der Familienalltag sei sehr anstrengend: Julian trage noch Windeln und helfe beim An- und Ausziehen noch nicht mit. Er bestehe darauf, gefüttert zu werden, und sei beim Essen sehr wählerisch. Auf Frustrationen oder Grenzsetzungen reagiere er oft mit Wutanfällen. Hinzu komme, dass auch die anderen beiden Kinder Entwicklungsprobleme hätten: Bei dem älteren Sohn sei eine Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert worden, und der jüngere Sohn bekomme Frühförderung. Die Tochter entwickele sich bislang unauffällig, leide jedoch unter einer starken Hausstauballergie.
Zu ihrer persönlichen Situation berichten die Eltern, dass sie keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Der Vater suche Arbeit, seine Möglichkeiten seien jedoch aufgrund einer chronischen Erkrankung begrenzt.
Nach dem Erstgespräch im Therapiezentrum stellen die Eltern einen Therapieantrag, und 4 Monate später kann die autismusspezifische Therapie im Umfang von 2 Stunden in der Woche bei Julian aufgenommen werden.
Therapiebeginn: Förderung sozialer und kommunikativer Schlüsselkompetenzen
Julian wird anfangs von seiner Mutter zur Therapie begleitet, er kann sich aber schon bald von ihr lösen. Im Vordergrund der Therapie stehen zunächst der Aufbau einer therapeutischen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin und die Gestaltung von entwicklungsförderlichen Therapieaktivitäten. Um Julian zum (gemeinsamen) Spiel zu motivieren, nutzt die Therapeutin sein Interesse an Autos und bietet ihm das Spielen auf dem Straßenteppich an. Anfänglich agiert der Junge hier sehr stereotyp, er schiebt die Autos, inszeniert Unfälle, hat aber darüber hinaus keine weiteren Ideen. Auch spielt er ausschließlich für sich und lässt eine Beteiligung der Therapeutin nicht zu. Allmählich gelingt es der Therapeutin, sich am Spiel des Jungen zu beteiligen und neue Spielideen in das Spiel zu integrieren. Der Fokus der Intervention liegt dabei darauf, soziale Schlüsselkompetenzen, die bei Kindern mit einer ASS besonders beeinträchtigt sind, zu fördern. Hierfür nutzt die Therapeutin insbesondere sozial-pragmatische bzw. beziehungsorientierte Fördermethoden (z. B. Greenspan & Wieder 2009; Gutstein & Sheely 2002), indem sie häufige gemeinsame Aufmerksamkeitsbezüge, geteilte Freude und wechselseitig aufeinander bezogene Interaktionen forciert. Momente, in denen die wechselseitige Bezugnahme im Verlauf des Spiels gelingt, werden von der Therapeutin mimisch, gestisch und verbal besonders hervorgehoben (sog. Spotlighting; González, Grütter & Mc Tigue 2009). Ferner wird das Spiel sprachlich begleitet, und es werden Kommunikationsanlässe geschaffen, in denen Julian motiviert wird, Sprache kommunikativ zu nutzen. Dabei kommen auch verhaltenstherapeutische Elemente (z. B. Bernard-Opitz 2007; Feineis-Matthews & Schlitt 2009), v. a. Prompts und natürliche Verstärker, zum Einsatz.
Die Therapeutin strukturiert die Therapiestunden zeitlich und räumlich und visualisiert den Verlauf der Therapiestunden mit einem Ablaufplan (Treatment and Education of Autistic and related communication-handicapped CHildren – TEACCH, z. B. Mesibov, Shea & Schopler 2004; Symalla & Feilbach 2009).
Parallel dazu führt die Therapeutin Gespräche mit Julians Eltern und mit seinen Erzieherinnen. Sie informiert hier über das Störungsbild und wichtige Aspekte einer autismusspezifischen Förderung (Psychoedukation). Es werden Absprachen zur Gestaltung der Essenssituation und zum Toilettentraining getroffen. Ferner werden die Bezugspersonen in der Entwicklungsförderung des Kindes angeleitet. U. a. wird thematisiert, wie eine gelungene Kommunikationsförderung im Alltag aussehen kann (Verwendung von lautsprachbegleitenden Gebärden, Sprachlehrstrategien, verbale Rituale, Sprachspiele etc.).
Erweiterung des Förderangebotes und Aufbau einer umfassenden Entwicklungsförderung
Allmählich führt die Therapeutin weitere Therapieaktivitäten ein, die eine breit angelegte heilpädagogische Entwicklungsförderung ermöglichen, denn neben sozialen und kommunikativen Schlüsselkompetenzen sollen zunehmend auch kognitive Fähigkeiten bei Julian, Konzentration und Ausdauer, die Körperwahrnehmung, fein- und grobmotorische Fähigkeiten sowie lebenspraktische Fertigkeiten gefördert werden. Dies geschieht im Rahmen von Angeboten zur Exploration von Materialien (Malen, Matschen, Schütten etc.), kleinen Regelspielen, Konstruktionsspielen (z. B. Bauen mit Lego), Bewegungsangeboten (Bewegungsparcours, Rollbrett-Fahren, Hüpfspiele etc.) und lebenspraktischen Anforderungen (z. B. An- und Ausziehen, Tisch decken).
Um Julian das Zugehen auf bisher unvertraute Aktivitäten zu erleichtern, werden seine Interessen in die neuen Aktivitäten einbezogen und weitere visuelle Strukturierungshilfen nach dem TEACCH- Ansatz eingeführt (Time-Timer, feste räumliche Zuordnung von Aktivitäten, bebilderte Ablaufpläne etc.). Über die Erweiterung der Therapieaktivitäten eröffnen sich Julian neue Erfahrungsräume, die er sich aus eigenem Antrieb bislang nicht erschlossen hatte. Die Therapeutin reichert diese Erfahrungsräume mit Förderimpulsen an, die fein auf den aktuellen Entwicklungsstand abgestimmt sind.
Soziale und kommunikative Fähigkeiten bleiben ein zentrales Thema in den Therapiestunden, und die Therapeutin fordert gemeinsame Aufmerksamkeitsbezüge, wechselseitige Bezugnahme, kooperatives Spiel und den kommunikativen Gebrauch von Sprache in vielen unterschiedlichen Situationen ein (in einer Kombination aus sozial-pragmatischen und verhaltenstherapeutischen Techniken).
Eltern und Erzieherinnen werden in den Beratungsgesprächen über Julians Entwicklungsfortschritte informiert und darin angeleitet, ihm ähnliche Aktivitäten wie in der Therapie zu ermöglichen (Anleitung zur Entwicklungsförderung). Julians Eltern nehmen die Gespräche sehr zuverlässig wahr. Es fällt ihnen jedoch schwer, die besprochenen Förderstrategien im alltäglichen Umgang mit Julian umzusetzen. In der Kindertagesstätte wird ein visualisierter Tagesplan mit Symbolen eingeführt, der es Julian erleichtert, sich an den Gruppenaktivitäten zu beteiligen. Ferner werden die Eltern dabei unterstützt, eine logopädische Behandlung für Julian einzuleiten (Schwerpunkt: Grammatikerwerb).
Julian kann die vielfältigen Entwicklungsimpulse, die er erhält, gut nutzen, er baut grundlegende sozial-kommunikative Fähigkeiten auf und erweitert sein Interessens- und Handlungsspektrum in Elternhaus, Kindertagesstätte und Therapie deutlich. So beteiligt er sich in der Kindertagesstätte an allen angeleiteten Gruppenspielen; in Freispielsituationen zieht er sich noch zurück und spielt alleine. Julian kommuniziert inzwischen in allen Kontexten verbal und spricht zunehmend in Sätzen. Auch ist er trocken und sauber geworden.
Ein häufiges Thema in den Elterngesprächen ist die familiäre Belastung. Erziehungsfragen wie die Strukturierung der Wochenenden, Beschäftigungsmöglichkeiten für Julian zuhause sowie der Umgang mit Konflikten zwischen den Geschwistern werden daher mit den Eltern besprochen (Erziehungsberatung). Ihnen wird von der Therapeutin auch empfohlen, Pflegegeld für Julian zu beantragen und einen Familien entlastenden Dienst in Anspruch zu nehmen (Sozialberatung).
Begleitung des Übergangs in die Schule
In weiteren Verlauf der Therapie wird Julian auch auf die bevorstehende Einschulung vorbereitet: Im Rahmen von Arbeitssituationen am Tisch übt Julian, vorgegebene Aufgaben zu bearbeiten (Kategorisierungsaufgaben, Fortsetzung logischer Reihen etc.). Diese Arbeitssituationen werden nach TEACCH- Prinzipien strukturiert (Arbeiten von links nach rechts, Fertig-Kiste etc.) und Erfolge verhaltenstherapeutisch nach einem Token-System verstärkt. Nach wie vor fällt es Julian schwer, sich über eine längere Zeit zu konzentrieren und Störreize auszublenden. Konzentration und Ausdauer werden daher sowohl in den Arbeitssituationen als auch im Rahmen von psychomotorischen Angeboten gefördert.
Um Julians Entwicklungsstand genauer einschätzen und die Eltern in der Wahl einer angemessenen Schulform besser beraten zu können, wird Julian mit 5½ Jahren im Therapiezentrum von der Fall begleitenden Psychologin testpsychologisch mit einem Intelligenztest sowie einem Sprachentwicklungstest untersucht. Julian kooperiert bei den Test-Terminen gut, aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne sind jedoch mehrere Pausen notwendig. Im Intelligenztest erreicht Julian einen Gesamtintelligenzquotienten, der im Bereich einer Lernbehinderung liegt; der kognitive Entwicklungsrückstand beträgt zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 1 Jahr. Der sprachliche Entwicklungsrückstand (rezeptiv und produktiv) beträgt etwa 1½ Jahre.
In Elterngesprächen wird mit den Eltern erarbeitet, dass Julian offenbar nicht nur von einer ASS, sondern auch von einer Lernbeeinträchtigung betroffen ist (beratende Begleitung bei der Diagnoseverarbeitung). Die Eltern setzen sich damit auseinander, dass Julian sonderpädagogische Unterstützung in der Schule benötigen wird, und beantragen ein Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs. In enger Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der Sonderpädagogin, die das Verfahren durchführt, sowie der Therapeutin und der Psychologin im Therapiezentrum fällt schließlich die Entscheidung, dass Julian an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt »Körperliche und motorische Entwicklung« eingeschult wird; diese Schule lässt un...