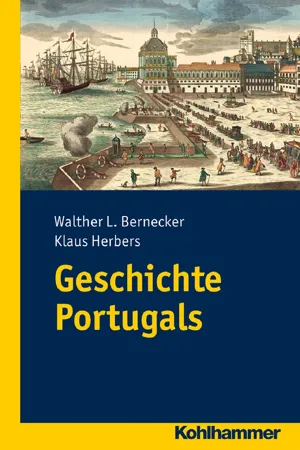![]()
Teil 1 Von der Antike bis ins ausgehende Mittelalter
Von Klaus Herbers
I Antike Prägungen, westgotischsuebische Reiche und christlichmuslimische Konkurrenz im frühmittelalterlichen Portugal
Die Geschichte eines Landes ist immer durch die geographischen Voraussetzungen mitbestimmt. Portugal besteht zu einem großen Teil aus bergigen Gebieten. Nur am Meer findet sich ausgedehntes Flachland. Das Hinterland von Lissabon ist ebenso durch breite Flusstäler wie durch fruchtbare Ebenen gekennzeichnet. Flüsse wie der Minho, Douro/Duero, Tejo (und Guadiana) durchziehen Portugal von Ost nach West und strukturieren damit neben Bergland und Ebene den geographischen Raum. Insbesondere Douro/Duero und Tejo trennen das Land in drei größere Teile. Die über lange Zeit wichtigen Orte liegen fast ausschließlich in Küstennähe und in den großen Flusstälern. Daraus wird klar, dass einige Völker der Antike – Phönizier, Griechen, Römer – wohl vor allem den Seeweg benutzten, um von der Küste aus Handel zu treiben oder Kolonisationsvorhaben zu beginnen.
1 Anfänge und römische Prägungen
Schon vor etwa 1,2 Millionen Jahren gab es die ersten Menschen auf der Iberischen Halbinsel. Die Gruppe des Pithecanthropus stammt wohl aus der Äquatorgegend und kam von dort nach Spanien. Abgesehen vom kantabrisch-asturischen Norden, dem Zentrum der Iberischen Halbinsel, der Gegend von Cádiz sowie der Levante sind auch im nordportugiesischen Raum einschlägige archäologische Funde nachgewiesen. In der neolithischen Epoche (ca. 5000–3000 vor Chr.) bestanden Kontakte mit dem Nahen Osten, denn dort war es zu großen handwerklichen und materiellen Neuerungen gekommen – vor allem im Bereich des Ackerbaus und der Metallverarbeitung. Auch die großen Religionen erreichten teilweise den Westen. Neben Kontakten mit den Phöniziern, die von Gadir (Cádiz) bis in das heutige Portugal ausgestrahlt haben könnten, beeinflussten weitere Völker die Entwicklung auf der Iberischen Halbinsel: Von den Karthagern, Griechen, Iberern, Basken und Kelten waren im portugiesischen Raum nur Iberer und Kelten von größerer Bedeutung.
Die Iberer gaben der gesamten Halbinsel sogar ihren Namen. Sie sollen mit den Berbern verwandt gewesen und aus Afrika gekommen sein, weshalb ihr Einfluss im Süden stärker ausfiel. Wann dies geschah, ist umstritten. Die frühesten sprachlichen Zeugnisse (Inschriften) stammen aus der Anfangszeit römischer Besatzung. Schriftliche Quellen des vorchristlichen Jahrtausends erwähnen weitere Völker auf der Iberischen Halbinsel, jedoch meist nicht das indo-europäische Volk der Kelten, das fast ausschließlich archäologisch nachweisbar ist. Die Kelten überquerten wohl um 800 bis 600 vor Christus die Pyrenäen und siedelten eher im Norden und Westen der Halbinsel.
Griechen, Karthager und Basken spielten für Portugal keine größere Rolle, dafür jedoch die Römer. Sie prägten die von ihnen Hispania genannte Provinz entscheidend. Es dauerte allerdings lange, bis sich der römische Einfluss ausbreiten konnte. Dieser ging seit dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert vom Mittelmeerraum, später auch vom Atlantik aus. Teilweise sind Widerstände erkennbar: Auf der Meseta stellten sich Lusitanier, später die Numantier, den Römern entgegen. Erst in der Zeit des Augustus (27 vor Chr. –14 nach Chr.) konnten der Norden und Westen wenigstens teilweise in die römische Herrschaft einbezogen werden. Ortsnamen wie Asturica Augusta (Astorga), Bracara Augusta (Braga), Emerita Augusta (Mérida) und Lucus Augusti (Lugo) verweisen auf diese Zeit.
Die Gründe für die römische Eroberung werden in jüngerer Zeit verstärkt im ökonomischen Bereich gesucht. Es war vor allem der Abbau von Bodenschätzen (Eisen, Kupfer, Zinn, Gold und Silber), den das römische Reich auf der Iberischen Halbinsel betrieb und an dem Portugal in Maßen teilhatte. Die in der Folge einsetzende Romanisierung verlief ungleichmäßig; die größeren Anfangserfolge lagen im Süden und Osten der Iberischen Halbinsel, besonders in den Städten. Eingeteilt war die gesamte Iberische Halbinsel unter römischer Herrschaft in eine Hispania Citerior (Osten, Norden und Zentrum) und eine Hispania Ulterior (Süden und Westen). Die Verwaltungsreform Diokletians (284 – 305) blieb bis ins Mittelalter hinein bestimmend: Innerhalb der gallischen Präfektur bildete die Hispania eine Diözese mit fünf Provinzen: Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Carthaginensis, Gallaecia; die Lusitania und die Gallaecia betrafen im Wesentlichen das spätere Portugal. Die in römischer Zeit angelegten Straßen durchzogen auch später noch das Land.
Grundlegend für die anschließende mittelalterliche Geschichte und damit auch für die Staatswerdung Portugals war die geistig-geistliche Einigung durch eine recht frühe Christianisierung, die – soweit erkennbar – wohl von den Städten ausging. Die langfristige Bedeutung lässt sich daran ablesen, dass sich später verschiedene Theorien über die Missionierung entwickelten. Dazu gehört zunächst die wirkmächtige Tradition, dass der Apostel Jakobus der Ältere in der Hispania (was Portugal einschloss) zum Glauben geführt habe; sein Leichnam soll nach dem Jahr 44 auf wunderbare Weise nach Galicien gekommen und in Santiago de Compostela bestattet worden sein. Erste Hinweise hierauf stammen erst aus dem 7./8. Jahrhundert. Weiterhin gibt es Quellen (frühestens ab dem 6. Jahrhundert) zu sieben apostolischen Boten, beziehungsweise Bischöfen, die von Petrus und Paulus geweiht worden sein sollen, um in Spanien zu missionieren. Damit zusammen hängt eine dritte Theorie, wonach der Apostel Paulus zwischen 63 und 67 in Spanien die Frohe Botschaft gepredigt habe (Gams 1862: 1 – 227; Herbers 2011 e: 10).
Diese Traditionen wurden später bedeutend, weil sie die apostolischen Anfänge der eigenen christlichen Geschichte betonten. Trotzdem ist eher zu vermuten, dass das Christentum durch Soldaten und Kaufleute in die Städte getragen wurde, von denen einzelne schon in der Unterschriftsliste des Konzils von Elvira (bei Granada) (295 – 314) zu Beginn des 4. Jahrhunderts erscheinen (Reichert 1990: 24 f.). Fest steht letztlich nur, dass zu Beginn des 3. Jahrhunderts große Teile der Bevölkerung auf der Iberischen Halbinsel zum Christentum bekehrt waren. So sprach Tertullian († um 220) im Jahre 202 davon, dass Spanien christlich sei. Die Christianisierung ging in der Spätantike mit der Romanisierung Hand in Hand.
Verschiedene Theologen dieser frühen Zeit lassen sich der Iberischen Halbinsel zuordnen, besonders im Norden machten sich aber auch abweichende christliche Glaubensvorstellungen bemerkbar. Ein auch für Portugal wichtiges Beispiel ist der aus der Oberschicht stammende Priszillian († 385), der in den 370er Jahren eine radikal asketische Bewegung begründete. Die Synode von Zaragoza verurteilte im Jahre 380 seine Lehren. Dennoch wurde er 380/381 Bischof von Ávila, aber gleichzeitig der Häresie beschuldigt. Obwohl Priszillian die Rücknahme dieser Vorwürfe erreichte, wurde er schließlich 384 – 385 in Trier gegen den Protest Martins von Tours († 397) und des Ambrosius von Mailand († 397) verurteilt und wenig später hingerichtet. Sein Kult verbreitete sich anschließend vor allem in Galicien und in Nordportugal und spielte dort bis zum Ende des 6. Jahrhunderts eine Rolle (Sulpicius Severus: Cronicorum Libri: 46 ff.; Gregor der Große: Dialogi III: 11 – 13; Prinz 1996: 5 – 8); er führte sogar zu einer Polarisierung innerhalb der spanischen Kirche.
2 Gentile Herrschaftsbildungen der Sueben und Westgoten (bis 711)
Mit diesen politischen und kirchlichen Voraussetzungen im politischen und kirchlichen Bereich wurden im 5. Jahrhundert die germanischen gentes (Völker) konfrontiert. Als im Jahre 476 der letzte weströmische Kaiser abgesetzt wurde, gab es auf der Iberischen Halbinsel nur einen größeren Herrschaftsraum, von dem die Quellen Zeugnis ablegen: das Reich der Sueben im Nordwesten der Iberischen Halbinsel, das fast zwei Jahrhunderte (409 – 585) bestand. Die übrigen Gebiete waren in dieser Zeit herrschaftlich weniger durchdrungen. Dieses Vakuum sollen die Westgoten ausgefüllt haben, deren iberische Herrschaft meist auf die Jahre 507 – 711 datiert wird. Das Anfangsdatum 507 wird aber weniger durch die innere Geschichte der Iberischen Halbinsel bestimmt, sondern eher durch die westgotische Geschichte. Denn in diesem Jahr unterlagen westgotische Truppen dem fränkischen Heer Chlodwigs († 511) in der Nähe von Poitiers (Vouillé). Damit wurde das schon seit 418 in Südwestfrankreich bestehende Westgotenreich mit seinem Mittelpunkt in Toulouse weitgehend zerschlagen, und die westgotische Herrschaft verlagerte sich nach und nach auf die Iberische Halbinsel (Giese 2004: 105 und 140 f.).
Vor den Westgoten waren einige weitere gentes wenigstens für eine gewisse Zeit im nordportugiesischen Raum bedeutend. Im ausgehenden 4. Jahrhundert hatten Alanen und Wandalen mit Burgundern und Sueben 405/406 den Rhein bei Mainz überschritten (Castritius 2007: 58–76; Berndt 2007: 104 – 120). Wandalen und Sueben drangen weiter bis nach Spanien vor, wo vor allem die Sueben im Nordwesten (Galicien-Nordportugal) ein Reich begründen konnten. Dort wurden sie von Westgoten immer wieder angegriffen. Wie bei vielen sogenannten Germanenvölkern bleibt die Herkunft der Sueben umstritten, archäologisch wollte man die Ursprungsgegend einem Fundgebiet an der holsteinischen und mecklenburgischen Ostseeküste bis hin zum mittleren Donauraum zuordnen. Bestattungen in Urnenfriedhöfen sind belegt, an der Donau scheinen sogar römische Bauformen rezipiert worden zu sein. Nach der Überschreitung des Rheins und der Durchquerung Galliens kam es zur Ansiedlung der Sueben im westlichen Bereich der Iberischen Halbinsel, in den Provinzen der Lusitania und der Gallaecia. Durch Loswurf erhielten die Sueben 411 den Conventus von Braga.
Als wichtigster Historiograph der Suebenzeit gilt Hydatius († 470), der ein negatives Bild dieses Reiches zeichnete (Hydatius: Continuatio Chronicorum Hieronymianorum). Diese Darstellung wurde lange unhinterfragt übernommen und ist erst unlängst differenzierten Beurteilungen gewichen. Neben Braga wurden Astorga, Lugo und Mérida (439), 441 sogar Sevilla wichtige Zentren; diese zeitweise große Ausdehnung des Suebenreiches war möglich, weil die Wandalen aus dem Süden weiter nach Afrika zogen.
Staatliche Aufgaben des bis 476 noch bestehenden weströmischen Reiches konnten die Sueben auch deshalb weitgehend übernehmen, weil die letzten römischen Garnisonen keine starke Herrschaft mehr ausübten. Als Begründer des Reiches gilt Hermericus (409–438/441); seine Nachfolger Rechica (438–448) und Recharius (448 – 456) betrieben eine erkennbare Expansionspolitik, die sogar die Baetica betraf (441 Eroberung von Sevilla). Die Möglichkeit dazu bot sich aber nur kurz, weil der Druck der Westgoten, die von Südwestfrankreich aus schon seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nach Spanien vorstießen, zunahm. Die Sueben traten den Westgoten zwar 455 bei Astorga entgegen, waren aber unterlegen. Nach diesem ersten Sieg konnten die Westgoten das Suebenreich jedoch noch nicht bezwingen, vielmehr gewannen die Sueben große Herrschaftsbereiche zurück und errichteten ein »zweites« suebisches Königreich. Diese Ära ist in den Quellen nicht mehr gut dokumentiert, weil der Hauptgewährsmann, Hydatius, 470 starb und weitere Nachrichten ausgesprochen verstreut sind. Trotz einiger bedeutender Herrscherpersönlichkeiten wie Chararich (550–559) und Miro (572 – 582) blieb das zweite Suebenreich in einer prekären Situation und erlag schließlich in den Jahren 576–586 den Angriffen des Westgotenkönigs Leovigild (571/572–585/586).
Die verheerenden Kriege führten zu Anarchie, die zeitgenössischen Quellen sprechen von bedauernswerten Zeiten (lacrimabile tempus) und ungezügelten Wirrnissen (indisciplinata perturbatio) (Thompson 1978: 15–22, »dark age«). Anschließend scheinen die Sueben sich relativ schnell mit der Niederlage abgefunden zu haben, zumal die Strukturen des täglichen Lebens kaum angetastet wurden. In der Chronik Alfons’ III. (866–910), die an dieser Stelle auf einer westgotischen Quelle des 7. Jahrhunderts basiert, wird vermerkt, dass der westgotische König Egica seinem Sohn Witiza das Reich der Sueben übergeben habe (Crónicas asturianas: 118 f. [Version Rotense u. ad Sebastianum]). Somit scheint ein gewisses Bewusstsein oder die Erinnerung an dieses Reich zumindest bis ins 7. Jahrhundert fortbestanden zu haben.
Schaut man auf die innere Struktur des Reiches, so führten die Sueben wie viele gentile Völkerschaften dieser Zeit Traditionen der römischen Epoche weiter: Sie unterbrachen den Aufbau der kirchlichen Institutionen nicht, sicherten den Fortbestand agrarischer Tätigkeiten im Rahmen der alten königlichen Fiskalgüter (fisci) und unterhielten ein Netz an Beziehungen, vor allem nach Byzanz (Claude 1970: 126 – 128; Collins 1983: 21 – 23).
An der Spitze des Reiches stand ein König. Ob ein Erb- oder Wahlprinzip bei der Thronfolge bestimmend war, bleibt unklar; die Erblichkeit scheint in der Familie Hermerichs († 441) stärker ausgeprägt gewesen zu sein, allerdings ist eine Königswahl einmal explizit belegt (Hydatius: Continuatio Chronicorum Hieronymianorum: 29, c. 181). Die Könige residierten in einem Palast und verfügten über einen Schatz, denn die Westgoten behaupteten nach 568, diesen erbeutet zu haben. Als Residenzorte sind Braga, Porto und Mérida belegt; von diesen sticht Braga besonders hervor. Die Könige betrieben außerdem Münzstätten. Ein näher gekennzeichneter Adel tritt in den Quellen nicht in Erscheinung, suebische Amtsträger werden nicht genannt, so dass am ehesten starke Kontinuitäten zur römischen Tradition angenommen werden können. Vielleicht machte aber auch die relative Kleinräumigkeit des Reiches eine zu starke Parzellierung und Organisation der Herrschaft überflüssig.
Die ersten suebischen Könige hatten den christlichen Glauben noch nicht angenommen. König Rechila starb 448 ohne getauft worden zu sein. Wie sehr die arianische Form des Christentums ab etwa 466 an Einfluss gewinnen konnte, ist unsicher. Mit dem beginnenden Übertritt der Sueben zum katholischen Glauben (etwa ab der Mitte des 6. Jahrhunderts) müssen sich auch die Kontakte zwischen Sueben und Romanen verstärkt haben (Schäferdiek 1967: 105–136). Wie es zum endgültigen Umschwung kam, ist nicht ganz klar. Das Klosterbistum San Martín de Dumio/Dume gründete Bischof Martin von Braga († 580). Sein Lebensweg zeigt, welchen Aktions- und Austauschraum das Mittelmeergebiet damals noch bot. Martin stammte aus Pannonien, unternahm eine Pilgerreise nach Palästina und wurde dort Mönch. 550 kam er in die iberische Provinz Gallaecia. In Dumio bei Braga stand Martin dem dortigen Klosterbistum als Abt und Bischof vor. Entscheidende Schritte auf dem Weg zum Katholizismus bedeuteten die beiden Konzilien von Braga 561 und 572. Am ersten nahm Martin teil, das zweite leitete er sogar selbst (Orlandis/Ramos-Lissón 1981: 77 – 92).
Mit seinem Werk De correctione rusticorum (»über die Verbesserung der Bauern«) wollte Martin Handreichungen geben, um Heidentum und Irrlehren zu bekämpfen. Gerichtet war das Buch an den Bischof Polemius von Astorga († ca. 589); es orientierte sich unter anderem an den Predigten und Sermones des Caesarius von Arles († 542) und bot in vielen Aspekten ein Grundgerüst katholischer Glaubenssätze.
Aus der Spätzeit Martins stammt das sogenannte Parochiale Suevum von 572, ein einzigartiges Dokument, das mit seiner Auflistung die bestehenden Bistümer und Pfarreien dokumentiert (Parochiale Suevum: 413 – 420). Jedoch ist die Echtheit der Quelle – deren früheste Aufzeichnung aus dem 11. Jahrhundert stammt – umstritten, u. a. weil aus dieser Liste die Rechte einzelner Bistümer und kirchlicher Besitzrechte nach der Reconquista abgeleitet wurden. Insbesondere machte man seit Ende des 11. Jahrhunderts geltend, dass hier die Rechte Lugos, die dieser Ort zu dieser Zeit beanspruchte, in ganz besonderer Art und Weise unterstrichen wurden. Trotzdem dürften manche Listen der Situation des 6. Jahrhunderts nahekommen und deutlich machen, in welch starkem Maße die Christianisierung auch organisatorisch vorangeschritten war.
Neben der entstehenden Parochialstruktur nahmen Mönchtum und Klosterwesen seit dem 6. Jahrhundert einen breiten Aufschwung, vor allem im Gebiet des alten Suebenreiches. Von dem bereits genannten Kloster Dumio erfolgten zahlreiche Tochtergründungen. Abtbischof von Dumio wurde Martin selbst, als monasterii Dumiensis episcopus bezeichnen ihn die Quellen. Die Akten des ersten Konzils von Braga (561) unterzeichnete er mit Martinus episcopus (Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos: 65–77, hier 77; vgl. Orlandis/Ramos-Lissón 1981: 78). Auf der Iberischen Halbinsel ist die im inselkeltisch-britischen Bereich des Frühmittelalters verbreitete Institution eines Klosterbistums ansonsten eher selten. Vermutlich ist sie mit bretonischen Wanderern im 5. und 6. Jahrhundert nach Galicien, Asturien und Nordportugal gekommen. Die Vorsteher der Klöster nahmen auch Aufgaben pastoraler Art wahr. Einer der wichtigsten Nachfolger des Martin war Fructuosus, der ebenso wie Martin gemeinsam mit dem Metropolitenamt von Braga – das ihm auf dem zehnten Konzil von Toledo 656 übertragen wurde (Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos: 322 – 324; vgl. O...