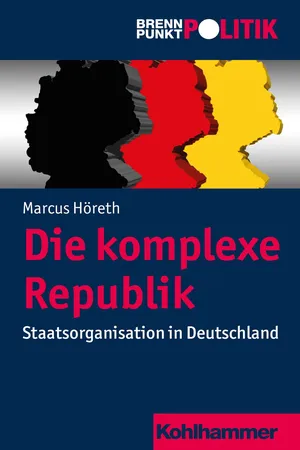
- 170 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Die komplexe Republik
Staatsorganisation in Deutschland
About this book
Aus dem Grundgesetz geht hervor, dass Deutschland republikanisch, demokratisch, rechtsstaatlich, bundesstaatlich und sozialstaatlich organisiert sein muss. Doch welche dieser Prinzipien sind gleichgerichtet, welche sind einander entgegengesetzt, welche bedingen einander und welche balancieren sich wechselseitig aus? Ziel dieses Buches ist es, dem Leser kompakt zu vermitteln, wie die Staatsorganisation (polity) auf politische Entscheidungsprozesse und politischen Wettbewerb (politics) und schließlich auf die Inhalte der Politik (policies) Einfluss nimmt. Dabei ergibt sich das spannungsreiche Bild einer komplexen Republik, die eine Politik des "mittleren Wegs" begünstigt.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Die komplexe Republik by Marcus Höreth, Hans-Georg Wehling, Reinhold Weber, Gisela Riescher, Martin Große Hüttmann in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Politics. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
1 Einleitung: Die komplexe Republik
Stellt man sich die Frage nach den zentralen Eigenschaften des deutschen Staates, so ist zunächst ein Blick in das Grundgesetz angeraten. Die Organisation der Staatlichkeit hängt in Deutschland von den fünf Strukturprinzipien ab, wie sie in den Artikeln 20 und 28 niedergelegt sind. Aus ihnen geht hervor, dass die Staatsorganisation in Deutschland republikanischen, demokratischen, rechtsstaatlichen, bundesstaatlichen und schließlich sozialstaatlichen Charakter haben muss. Doch der Blick in das Grundgesetz und sein „Paragraphengespinst“ alleine reicht nicht aus, um zu verstehen, was den Staat der Bundesrepublik wirklich ausmacht. Das Grundgesetz ist ohnehin „keine Staatsbibel, aus der man eine widerspruchsfreie Botschaft entnehmen könnte“ (Anter 2015: 490). Vielmehr ist es entscheidend, wie sich diese fünf „Formprinzipien der Verfassungsordnung“ (Böckenförde 2004: 485) in der politischen Praxis der Bundesrepublik entwickelt haben und – noch wichtiger – in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
Von den Prinzipien der Staatsorganisation gehen jeweils spezifische Handlungsimperative für Politik und Verwaltung aus, die in der Regel um ein kohärentes Staatshandeln bemüht sind. In einer Perspektive, nach der diese verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen als „Optimierungsgebote“ an die Politik aufgefasst werden (Alexy 1985: 75 f.), zeigt sich jedoch schnell, dass die Beziehungen zwischen den Prinzipen der Staatsorganisation und den von ihnen ausgehenden Imperativen für politisches Handeln von vielfältigen Wechselwirkungen gekennzeichnet sind und schon deshalb nicht völlig spannungsfrei sein können. Um ein genaueres Bild der deutschen Staatlichkeit zu gewinnen, ist es daher unerlässlich, diese Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse zwischen den Prinzipien der Staatsorganisation – so wie sie bereits im Grundgesetz angelegt sind und so wie sie sich historisch in der politischen Praxis herausgebildet haben – zu identifizieren und zu analysieren. Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum: Welche Prinzipien der Staatsorganisation und der ihnen zu entnehmenden politischen Handlungsimperative sind gleichgerichtet, welche sind einander entgegengesetzt, welche Prinzipien bedingen einander und welche der Prinzipien balancieren sich wechselseitig aus?
In manchen begrifflichen Einordnungen der Bundesrepublik Deutschland, wie sie in der politikwissenschaftlichen und staatsrechtlichen Literatur zu finden sind, werden mehrere dieser Prinzipien zusammengefasst und auf einen Begriff gebracht. Wenn etwa von Deutschland als typischem demokratischen Verfassungsstaat die Rede ist, so wird damit ausgedrückt, dass die Demokratie in diesem Land von einem Verfassungsrahmen eingehegt wird. Der Begriff des demokratischen Bundesstaats stellt hingegen darauf ab, dass die zwei Prinzipien der Demokratie und des Föderalismus im deutschen Modell der Staatlichkeit miteinander verwoben sind. Der soziale Rechtsstaat verweist darauf, dass sich der Rechtsstaat darauf verpflichten will, Mindeststandards sozialer Gerechtigkeit zu erfüllen, wie sie nur mit den Mitteln sozialstaatlicher Programme gewährleistet werden können. Obwohl diese – und einige weitere hier diskutierte – zusammengesetzte Begriffe maßgebliche Eigenschaften deutscher Staatlichkeit gut einfangen können, kranken sie alle daran, dass in ihnen wiederum andere Dimensionen der Organisation des Staates in Deutschland ausgeblendet bleiben. Ich möchte hier einen alternativen symbiotischen, weil verschiedene Dimensionen der Organisation von Staatlichkeit zusammenfassenden Begriff vorschlagen, nämlich den der „komplexen Republik“. Weil die Republik für sich alleinstehend nach dem hier zugrunde liegenden Verständnis bereits ein äußerst komplexes Staatsorganisationsprinzip beschreibt, ist die Bezeichnung „komplexe Republik“ ein Pleonasmus wie „kaltes Eis“ oder „runde Kugel“. Dennoch hoffe ich, dass die Bezeichnung „komplexe Republik“ insofern Sinn ergibt, als ich mich dadurch von einem rein formalistischen Republikbegriff abgrenzen kann, der – wie zu zeigen sein wird – weder normativ noch analytisch gehaltvoll ist1.
Republikprinzip
Während in den oben genannten Beispielen Spannungsverhältnisse zwischen verschiedenen Staatsorganisationsprinzipien angelegt sind, erscheint die Entscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes, Westdeutschland einen republikanischen Charakter zu verleihen, zunächst unproblematisch. Mit dem Bekenntnis zur Republik – so könnte man intuitiv vermuten – ist ja lediglich gemeint, dass das Staatsoberhaupt Deutschlands nicht aus einer Erbmonarchie hervorgehen soll wie noch im Kaiserreich, sondern gewählt werden muss. Diese Grundentscheidung für die republikanische Staatsform hat, obwohl natürlich auch sie mit ganz spezifischen Handlungsimperativen an die Politik verbunden ist, rein formal betrachtet keine nennenswerten Implikationen für die anderen Prinzipien der Staatsorganisation. Sowohl die demokratische Regierungsform, der Rechtsstaat, die bundesstaatliche territoriale Ordnung und schließlich auch das Bekenntnis zum Sozialstaat können theoretisch völlig unabhängig von der Staatsform der Republik betrachtet werden. Rein formal betrachtet, ist dem Republikprinzip verfassungsrechtlich nur wenig zu entnehmen, was nicht schon durch die anderen Prinzipien und ihre nähere Ausgestaltung in einzelnen Regelungen des Grundgesetzes enthalten ist. Allerdings verbirgt sich ideengeschichtlich und auch verfassungstheoretisch hinter dem Bekenntnis zur Republik weit mehr als der erste Blick vermuten lässt. Im Keim war im Republikkonzept, vor allem nachdem dieses auch durch liberale Sätze angereichert wurde, die spätere Ausprägung der Organisation des deutschen Staates als Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat und Sozialstaat bereits angelegt.
Demokratieprinzip
Hinsichtlich der Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse mit anderen Strukturprinzipien geläufiger und insofern auch bedeutender ist die verfassungsrechtliche Entscheidung für das Demokratieprinzip und seine konkrete politisch-institutionelle „Übersetzung“. Schon wenn das Demokratieprinzip isoliert betrachtet wird, werden gravierende Auslegungsprobleme deutlich. Das in einer Verfassungsurkunde niedergelegte Bekenntnis zur Demokratie sagt noch wenig über den tatsächlichen demokratischen Charakter eines Regierungssystems aus. Auch autoritäre Regime verzichten in der Regel nicht darauf, sich zur „Demokratie“ zu bekennen. Von ganz entscheidender Bedeutung für die gesamte Staatsorganisation ist jedoch die Regierungsform, durch die die normativen Anforderungen erfüllt werden sollen, welche durch das Bekenntnis zur Demokratie gestellt sind. Wenn von echten Demokratien die Rede ist, kommen nur zwei Regierungsformen in Frage: die parlamentarische und die präsidentielle Regierungsform (Steffani 1979). Während jedoch das parlamentarische Regierungssystem sowohl mit der Staatsform der Republik als auch mit der Staatsform der Monarchie kompatibel ist, verhält es sich bei der präsidentiellen Regierungsform mit ihrer geschlossenen Exekutive anders – sie kann nur republikanisch organisiert werden. Der direkt gewählte Präsident ist Regierungschef und zugleich Staatsoberhaupt, neben dem dann naturgemäß kein Platz (mehr) für einen Monarchen existiert.
Rechtsstaatsprinzip
Nach westlichem Demokratieverständnis wird als Demokratie nur anerkannt, wenn diese auch rechtsstaatlichen Charakter hat. Das demokratische Mehrheitsprinzip, das sowohl aus dem Prinzip der Freiheit und Selbstbestimmung als auch aus dem Prinzip der demokratischen Gleichheit folgt, steht indessen mit dem Rechtsstaat und den mit ihm verbundenen Anforderungen an die Politik in einem besonders komplizierten Spannungsverhältnis. Für gewöhnlich wird dieses Spannungsverhältnis dadurch aufgelöst, dass der Rechtsstaat gegenüber den demokratischen Prozessen und den Ergebnissen demokratischer Willensbildung einen Riegel bildet, der nicht verletzt werden darf. Demokratische Mehrheiten dürfen aus rechtsstaatlichen Gründen bestimmte rechtlich definierte Grenzen nicht überschreiten – so bleiben Minderheitenrechte und individuelle Grundrechte der Disposition des mehrheitsbestimmten demokratischen Gesetzgebers entzogen. So einleuchtend diese Erklärung für das Prinzip auf Anhieb ist, so schwierig ist dessen Übersetzung dort, wo es um konkrete Politik geht. Hier muss letztlich immer wieder abgewogen werden, ob die Interessen der Mehrheit, die zu vertreten die in einer Demokratie amtierende Regierung beauftragt ist, mit einer am Gemeinwohl orientierten Staatstätigkeit zu vereinbaren sind.
Das Gemeinwohl ist im demokratischen Verfassungsstaat jedoch keine „fixe und vorgegebene Größe, sondern Produkt des pluralen, nicht interessefreien Prozesses politischer Willensbildung“ (Dreier 2015: Art. 20). Da die Demokratie somit keine Instanz kennt, die wüsste, was dieses Gemeinwohl genau beinhaltet, versucht sie mittels prozeduraler Vorkehrungen wenigstens die Gefahr zu verringern, dass dieses abstrakte Gemeinwohl – aber eben auch das Wohl des einzelnen Individuums – durch demokratische Mehrheiten oder aber durch andere Instanzen verletzt werden könnte. Sie leistet dies schon dadurch, dass die staatlichen Gewalten der Exekutive, Legislative und Judikative sich wechselseitig auszubalancieren vermögen. In parlamentarischen Regierungssystemen, in denen die Regierung mit der parlamentarischen Mehrheit eine Gewaltenfusion bewirkt, kann die dadurch bedingte eingeschränkte Rolle des Parlaments bei der Ausbalancierung der mehrheitsbestimmten Exekutive vor allem durch die Judikative geleistet werden. Deshalb ist die Entscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes für einen besonders anspruchsvollen Rechts- und Verfassungsstaat auch aus diesem Grund sicher richtig gewesen. Doch die Entscheidung für eine ausgebaute Höchstgerichtsbarkeit, die die exekutiven und legislativen Akte auf ihre Verfassungs- und meist auch Verhältnismäßigkeit hin überprüft, führt selbst wieder zu weiteren tiefgreifenden Problemen, die als counter-majoritarian difficulty (Bickel 1962) typisch sind in demokratischen Verfassungsstaaten. Schon diese wenigen Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, wie wenig gewonnen ist, wenn man das Verhältnis von Rechtsstaat und Demokratie rein statisch betrachtet und dabei die dynamischen Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Staatsorganisationsprinzipien ignoriert.
Bundesstaatsprinzip
Ähnlich dynamisch ist das Verhältnis von Demokratie und Bundesstaat angelegt. Zwar werden dem Föderalismus zuweilen demokratieförderliche Eigenschaften zugeschrieben, weil dem Bürger grundsätzlich mehr Partizipationsmöglichkeiten eröffnet werden. Doch die von einem Bundesstaat ausgehenden normativen Anforderungen an die demokratisch gewählten politischen Entscheidungsträger schränken deren Entscheidungsspielraum in vielerlei Hinsicht ein und durchbrechen bzw. relativieren auf diese Weise das Demokratieprinzip. Ganz offensichtlich wird dies dort, wo die Mehrheitsentscheidungen des parlamentarischen Gesetzgebers der mehrheitlichen Zustimmung der Gliedstaaten bedürfen. In Deutschland muss fast jedes wichtige Gesetz eine Zustimmung durch den Bundesrat erfahren, damit es in Kraft treten kann. Im demokratischen Bundesstaat wird auf diese Weise das Gleichheitsprinzip der Demokratie – one man one vote – gekoppelt mit dem föderalen Prinzip der Staatengleichheit, wenngleich letzteres in der Bundesrepublik nicht absolut eingehalten wird, weil die gemessen an der Bevölkerungsgröße größeren Bundesländer über mehr Stimmen im Bundesrat verfügen als die kleineren Bundesländer.
Sozialstaat
Isoliert betrachtet ist schließlich auch das Sozialstaatsprinzip in der Bundesrepublik Deutschland normativ unanfechtbar. Doch auch dieses Prinzip ist kontrovers, wenn es im Zusammenhang mit Demokratie oder dem Rechtsstaat betrachtet wird. Wieviel Sozialstaat braucht die Demokratie, um erfolgreich zu sein? Und umgekehrt: Wie demokratisch – im Sinne der Orientierung am demokratischen Mehrheitsprinzip – muss der Sozialstaat sein, um auch für all jene Bürgerinnen und Bürger der Mehrheit anerkennungswürdig zu bleiben, deren Steuern den Sozialstaat maßgeblich finanzieren, von dem nur Minderheiten profitieren? Oder: Wie stark darf der Sozialstaat, beispielsweise durch die Erhebung von Steuern zur Finanzierung einer umfassenden Sozialpolitik, in die Privatautonomie seiner Bürger und die Eigentumsverhältnisse in der Gesellschaft intervenieren, ohne rechts- und verfassungsstaatliche Grenzen zu verletzen? Auch diese schwierigen Fragen lassen sich nicht statisch beantworten, sondern verlangen nach einer permanenten Abwägung der Mehrheits- mit den Minderheitsinteressen, die je nach den gegebenen politischen, ökonomischen und kulturellen Kontextbedingungen ganz unterschiedlich ausfallen kann.
Spannungsfelder und Wechselwirkungen
Im Folgenden möchte ich die wichtigsten Spannungsverhältnisse und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Prinzipien der Organisation des Staates in Deutschland aufzeigen und diskutieren. Im Zentrum steht die Frage, wie sich diese Prinzipien in der politischen Praxis der Bundesrepublik entwickelt haben und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Hierfür werden im ersten Teil des Buches die Strukturprinzipien zunächst im Einzelporträt vorgestellt, indem ihrer Ideengeschichte, ihrer inhaltlichen Konturierung im Grundgesetz und schließlich ihrer Entwicklung in der Staatspraxis nachgegangen wird. Im zweiten Teil des Buches werden die Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse innerhalb des Gesamtensembles der Strukturprinzipien erörtert. Ziel ist es, dem Leser in Grundzügen zu vermitteln, wie die Staatsorganisation der Bundesrepublik (polity) auf politische Entscheidungsprozesse und politischen Wettbewerb (politics) und schließlich auf die Inhalte der Politik (policies) Einfluss nimmt. Bei der Darstellung und Diskussion der Staatsorganisationsprinzipien wähle ich bewusst eine andere Vorgehensweise als die meisten staatsrechtlichen und politikwissenschaftlichen Überblicksdarstellungen. Zwar wird die normative Verankerung der Staatsorganisationsprinzipien im Grundgesetz hier ebenfalls möglichst knapp und konzise aufgezeigt, doch es bleibt nicht bei rein normativ-dogmatischen und deskriptiven Überlegungen. Vielmehr geht es mir darum, Verfassungsrecht und Verfassungspraxis dieser Prinzipien – und die in diesem Verhältnis festzustellende Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, normativer Vorgabe und Verfassungsrealität – gleichermaßen in den Blick zu nehmen, wodurch sowohl staatstheoretische als auch politikwissenschaftlich-empirische Überlegungen eine prominente Rolle spielen müssen. Dabei geht es mir keineswegs darum, die hehre Verfassung gegen eine als problematisch oder als defizitär empfundene Verfassungsrealität auszuspielen, um anschließend einen umfassenden Reformbedarf der Staatsorganisation zu konstatieren (Hennis 1959). Vielmehr will ich die gerade in Deutschland nicht zuletzt aus der Spannung zwischen „Normativität“ und „Normalität“ der Verfassung resultierende politische Praxis einfangen (Hesse 1959), die sich im Rahmen miteinander konvergierender und zuweilen auch divergierender demokratischer, rechtsstaatlicher, bundesstaatlicher und sozialstaatlicher Handlungsimperative abspielt. Auch die vergleichende Perspektive wird an einzelnen Stellen genutzt, um das Zusammenspiel der Staatsorganisationsprinzipien in Deutschland besser zu konturieren und zu verstehen. Das genauere Studium der von den Staatsorganisationsprinzipien ausgehenden politischen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsrestriktionen bietet zudem einen alternativen bzw. ergänzenden Erklärungsansatz bezüglich der Frage, warum in der Bundesrepublik Deutschland nur eine „Politik des mittleren Weges“ (Schmidt 1990) möglich zu sein scheint.
Die Idee zu diesem Buch basiert auf Erfahrungen, die ich bei meinen Einführungsvorlesungen an der TU in Kaiserslautern zum Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland gemacht habe2. Es erschien mir als Politikwissenschaftler immer ungenügend, mich im staatsorganisatorischen Teil vorrangig auf verfassungsrechtliche Literatur stützen zu müssen. In den meisten bekannten Lehrbüchern der Politikwissenschaft zum Thema wird zwar – zu Recht – dem parlamentarischen Regierungssystem, dem Parteiensystem und schließlich einigen zentralen Politikfeldern besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Staatsorganisationsprinzipien hingegen werden dort jedoch eher stiefmütterlich und knapp abgehandelt – zu Unrecht. Gerade in der Bundesrepublik wirken diese verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen massiv auf die Formen und Inhalte politischer Willensbildung und die Staatstätigkeit allgemein ein. Sie stellen den Rahmen dar, in dem sich politische Akteure in der deutschen Politik auf ihrem „mittleren Weg“ bewegen. Das Studium der entsprechenden staatsrechtlichen Literatur hilft für das Verständnis dieses Sachverhalts indessen nur bedingt weiter, werden dort doch die „Staatsfundamentalnormen“ vor allem dogmatisch auf ihre verfassungsrechtlichen Implikationen hin überprüft, während der Blick auf die Realität des Regierens in der „komplexen Republik“ kaum gewagt wird. Häufig wird in der verfassungsrechtlichen Literatur das „Regieren“ in der Bundesrepublik Deutschland tendenziell so dargestellt, als sei es bloßer Verfassungsvollzug. Insofern ist diese kleine Abhandlung ein Versuch der Vermittlung zwischen normativer und ideengeschichtlicher Analyse der fundamentalen verfassungsrechtlichen Prinzipien des Staatswesens einerseits und politikwissenschaftlicher Beschreibung ihrer konkreten Umsetzung in der Verfassungs- und Regierungspraxis andererseits. Ein solches Vorgehen verlangt jedoch nach thematischer Eingrenzung und inhaltlichen Kompromissen. Dieses doppelte Problem versuche ich dadurch zu lösen, dass ic...
Table of contents
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- 1 Einleitung: Die komplexe Republik
- 2 Die Strukturprinzipien in der Einzelbetrachtung
- 3 Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse im Gesamtensemble: Die sechs Rahmenordnungen deutscher Politik
- 4 Schluss: Regieren in der komplexen Republik
- 5 Literaturhinweise