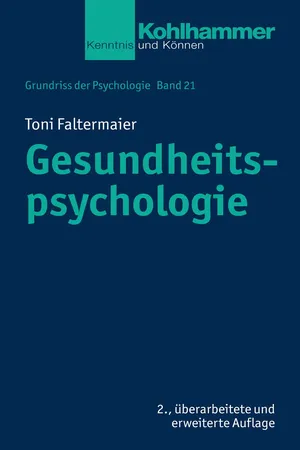![]()
1 Einleitung: Warum Gesundheitspsychologie?
Gesundheit ist heute ein öffentliches Thema, über das sich nicht nur Experten und Politiker öffentlich auseinandersetzen, sondern das auch viele Menschen in ihrem Alltag beschäftigt und wozu sie Informationen und Meinungen austauschen. Vielfach diskutiert werden Fragen wie beispielsweise das Rauchen im öffentlichen Raum, das eigene Übergewicht im Vergleich zur vorgestellten Idealfigur, die richtigen Wege zum Erreichen von mehr körperlicher Fitness, die Krankheit eines Nachbarn und ihre Ursachen, die Erfahrungen mit Ärzten und verschiedenen Heilverfahren und – natürlich – die Kosten unseres Gesundheitssystems. Das Thema Gesundheit betrifft alle! Über Gesundheit kann jede und jeder mitreden, weil alle Erfahrungen damit gemacht haben; in gewisser Weise ist es ein Allerweltsthema. Die Gesundheit scheint auch fast allen Menschen wichtig zu sein und steht auf der Wertehierarchie der Bevölkerung ganz oben. Aber es besteht auch eine große Diskrepanz zwischen dem abstrakten Wert Gesundheit und seiner Handlungsrelevanz: Im Alltag wird Gesundheit oft weit nach hinten geschoben, weil vieles andere wichtiger scheint. Wenn die Gesundheit aber durch eine Krankheit verloren geht, dann löst das Angst aus, erlangt schnell eine fast existentielle Bedeutung für die Betroffenen und zwingt zum Handeln. Gesundheit ist also eine universelle Erfahrung und ein alltägliches Thema; ihr wird heute subjektiv eine große Bedeutung zugeschrieben, und über sie werden manchmal heftige Kontroversen ausgetragen, in der Bevölkerung, in der Politik und unter Experten. Darin liegen – wie sich zeigen wird – große Chancen, aber auch einige Risiken.
Die öffentlichen Diskurse über Gesundheit waren nicht immer so verbreitet wie heute. Es liegt erst wenige Jahrzehnte zurück, dass Gesundheit noch weitgehend als eine Angelegenheit von Ärzten und anderer Experten gesehen wurde. Bei gesundheitlichen Problemen wurden sie vertrauensvoll aufgesucht, und man hat ihnen oft eine nahezu grenzenlose Macht und Kompetenz im Heilen von Leiden zugeschrieben. Der Arzt galt lange Zeit als »Halbgott in Weiß«. Heute scheint dieser Mythos des Heilers ziemlich entzaubert. Das gesellschaftliche Prestige eines Arztes ist zwar immer noch hoch, aber die öffentliche Kritik an »den Ärzten« und an »der Schulmedizin« wird häufiger und auch heftiger zum Ausdruck gebracht; viele Menschen suchen heute nach alternativen Heilverfahren. Zudem ist das Bewusstsein in der Bevölkerung, selbst etwas zur eigenen Gesunderhaltung beitragen zu können und zu wollen, deutlich angestiegen. Die starke Nachfrage nach dem Gut »Gesundheit« hat einen expansiven Markt für Gesundheitsprodukte entstehen lassen, mit manchmal fragwürdigen Angeboten. Und auch die Frage, wer für die Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich ist, wird heute sehr kontrovers diskutiert: Für die einen ist es der einzelne Mensch, für andere ist es immer noch der Arzt, und für wieder andere ist es die Gesellschaft und Politik.
In unserem medizinisch geprägten Gesundheitssystem zeigen sich heute eine Vielzahl von Problemen: Nahezu gebetsmühlenartig wird die Frage, wie es sich bei ständig steigenden Kosten noch finanzieren lässt, zwischen Gesundheitspolitikern, Standesvertretern und Krankenkassen hin und her geschoben, scheinbar ohne Aussicht auf eine Lösung. Seit Jahrzehnten werden aber auch immer wieder heftige fachliche Kontroversen über die angemessene gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung, über das Für und Wider einer somatisch, naturwissenschaftlich und kurativ orientierten Medizin ausgetragen. Aus diesen Debatten haben sich bis heute keine größeren Veränderungen in der Ausrichtung des Gesundheitssystems ergeben; trotz deutlicher Kritik an der »Schulmedizin« ist die medizinisch-organisch geprägte Gesundheitsversorgung über die letzten Jahrzehnte erstaunlich stabil geblieben. In den diversen »Gesundheitsreformgesetzen« der letzten Jahre standen fast ausschließlich die Probleme der weiteren Finanzierung der medizinischen Versorgung im Mittelpunkt, ohne ihre Grundprinzipien in Frage zu stellen und ohne die Strukturen des Systems anzutasten. Aber ist die kurative Ausrichtung des Gesundheitssystems angesichts einer Dominanz von chronisch-degenerativen Erkrankungen noch angemessen? Die Arbeitsteilung zwischen den traditionellen Gesundheitsberufen des Arztes und der Krankenpflege – entstanden bereits im 19. Jahrhundert – ist zwar in Bewegung geraten, sie ist in ihren Grundzügen aber trotz deutlicher Emanzipationsbemühungen der Krankenpflege erhalten geblieben. Die medizinisch-naturwissenschaftliche Sicht von Krankheit und die darauf aufbauende Praxis blendet aber oft aus, dass Gesundheit und Krankheit auch eine subjektive Seite haben und sehr individuell erfahren werden: Krankheiten werden von Menschen erlebt und erlitten, sie müssen psychisch verarbeitet werden; kranke Menschen und ihre Angehörigen müssen lernen, in ihrem Alltag mit einer Krankheit und ihren Folgen umzugehen. In diesen psychischen und sozialen Problemen werden kranke Menschen vom professionellen Versorgungssystem oft allein gelassen. Das medizinische Gesundheitssystem konzentriert sich auf Krankheit und behandelt kranke Menschen als Patienten; die noch gesunden Menschen und die nicht (mehr) behandelten chronisch kranken Menschen werden in diesem System ausgeblendet. Aus dieser historisch gewachsenen gesellschaftlichen Aufgabe ergibt sich eine Vernachlässigung der Prävention und des alltäglichen Umgangs mit Gesundheit und Krankheit.
Im historischen Rückblick zeigt sich ein deutlicher Wandel im in der Bevölkerung vorherrschenden Krankheitsspektrum: Vom 19. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte eine drastische Abnahme der früher epidemischen Infektionskrankheiten (Tuberkulose, Cholera, Typhus, Ruhr) und darauf war eine allmähliche Zunahme von chronisch-degenerativen Erkrankungen zu beobachten, die Zivilisationskrankheiten genannt werden, weil sie mit den Lebensverhältnissen in den modernen Industriegesellschaften zusammenhängen. Die Ursachen für den drastischen Rückgang der Infektionskrankheiten sind aber nicht allein in den Fortschritten der Medizin begründet, vielmehr haben sie ganz wesentlich mit der Verbesserung der Lebensverhältnisse zu tun: Der englische Medizinhistoriker McKeown (1982) kam aufgrund einer Sichtung umfangreichen historischen Datenmaterials zu dem Ergebnis, dass die für den Rückgang der Sterblichkeit entscheidende Abnahme der Infektionskrankheiten im 19. Jahrhundert überwiegend auf Verbesserungen in den Lebensverhältnissen zurückzuführen ist und nicht primär auf die Fortschritte der Medizin. Effektive Therapien für Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose, Bronchitis und Ruhr wurden nämlich erst relativ spät gefunden (bei der Tuberkulose etwa 1950), nachdem die Mortalitätszahlen schon lange deutlich zurückgegangen waren. Diese Befunde schmälern nicht die unbestreitbaren Erfolge der Medizin gerade in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, aber sie relativieren den Beitrag der Medizin zur Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung. Sie lenken den Blick auch auf andere Determinanten von Gesundheit, auf die materiellen Lebensverhältnisse und auf die Lebensweise der Bevölkerung. Diese haben sich im Zeitalter der Industrialisierung allmählich verbessert, insbesondere die Ernährungssituation, die Wohnverhältnisse in den Städten, Bekleidung und Körperhygiene auf der einen Seite sowie die Arbeitsbedingungen, die politischen und sozialen Verhältnisse auf der anderen Seite.
In allen modernen Industriegesellschaften herrschen heute chronische und degenerative Erkrankungen vor, die mit den Mitteln einer kurativen Medizin allein nicht mehr zu beheben sind. Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Allergien, chronische Bronchitis, Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes sowie Suchtkrankheiten und psychische Störungen machen heute einen Großteil des Krankheitsgeschehens aus. Sie sind alle dadurch gekennzeichnet, dass – wenn die Krankheit einmal voll ausgebrochen ist – eine vollständige Heilung auch mit den Mitteln der modernen Medizin nur selten erreicht werden kann. Sie verlaufen daher oft chronisch und teilweise degenerativ, d. h. sie verschlechtern sich zunehmend und führen zu immer stärkeren Einschränkungen. Von den meisten dieser Krankheiten wissen wir, dass sie zumindest teilweise durch das Verhalten, den Lebensstil und die Lebensbedingungen des modernen Menschen beeinflusst werden. Damit werden mögliche Krankheitsursachen im psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich angesprochen, die potentiell veränderbar sind. Ein besseres Verständnis dieser Einflüsse macht präventive Ansätze möglich, die viele schwere Krankheiten verhindern könnten. Der Ruf nach Prävention ist alt und wird immer wieder erneuert. Die Prävention wird in ihrer Notwendigkeit heute kaum noch bestritten, aber bis dato hat sie in der Praxis und in den Strukturen des Gesundheitswesens wenig Resonanz erhalten; allerdings könnte das am 18.06.2015 in Deutschland verabschiedete Präventionsgesetz eine neue Entwicklung einleiten.
Die Medizin und das medizinische Versorgungssystem konzentrieren sich auf Krankheiten in allen ihren Facetten, Gesundheit ist nicht ihr Thema. In der Öffentlichkeit hat sich jedoch ein Gesundheitsdiskurs entwickelt, der inzwischen breite Kreise zieht. Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) bemüht sich seit langem um eine stärkere Orientierung an Gesundheit. Sie formulierte bereits 1948 eine positive Definition von Gesundheit und versuchte in der Folge immer wieder, Gesundheitsziele zu definieren, die als Orientierung für die Gesundheitspolitik in unterschiedlichen Gesellschaften dienen können. Aus diesen Wurzeln entstand schließlich auch die Perspektive einer Gesundheitsförderung, die 1986 als Ottawa-Charta der WHO formuliert große Resonanz erzielte. Der dadurch angestoßene Gesundheitsdiskurs war sehr bedeutsam für die Entwicklung der Gesundheitswissenschaften (Public Health), deren Ziel die Gesundheit in der Bevölkerung ist, und für neue Initiativen in der Praxis, die mehr Prävention und Gesundheitsförderung anstreben.
In den skizzierten Themen werden wichtige psychologische Fragen angesprochen, die neben dem somatisch-medizinischen auch einen wissenschaftlichen Zugang der Psychologie zu Gesundheit und Krankheit erforderlich machen. Die Fülle an heute bereits verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und die damit wachsende Einsicht, dass psychische und soziale Prozesse eng mit der Entstehung, dem Verlauf und der Behandlung von organischen Krankheiten verbunden sind, stellen den Hintergrund für das Entstehen der Disziplin einer Gesundheitspsychologie dar.
Aber warum genau brauchen wir eine Gesundheitspsychologie und was sind ihre Themen? Zunächst baut die Gesundheitspsychologie auf der grundlegenden Erkenntnis auf, dass körperliche und psychische Prozesse eng und untrennbar miteinander zusammenhängen. Es waren und sind die Grundfragen der langen Tradition einer Psychosomatik, wie psychische Erlebnisse zu körperlichen Veränderungen bis hin zu pathologischen Prozessen führen können und wie körperliche Vorgänge subjektiv wahrgenommen und psychisch erlebt werden. Erkenntnisse der psychophysiologischen Forschung zeigen uns heute erstens wesentliche psychosomatische Prozesse und Zusammenhänge: Die körperlichen Auswirkungen beispielsweise des psychischen Erlebens von Stress sind inzwischen sehr gut und in vielen Einzelheiten untersucht worden. Die physiologischen Folgen von Stress im Kreislaufsystem sowie im Hormon- und Immunsystem zeigen Verbindungen auf, die für die Genese von Herz-/Kreislauferkrankungen, Infektionskrankheiten und Krebserkrankungen wichtige Ergebnisse liefern. Ein zweiter naheliegender Weg geht über den Zusammenhang zwischen Verhalten und Gesundheit: Mit dem gut belegten Nachweis von verhaltensbedingten Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum oder Bewegungsmangel entstand die psychologische Fragestellung, warum und unter welchen Bedingungen Menschen diese für ihre Gesundheit riskanten Verhaltensweisen zeigen und wie sie zu einer Änderung ihres Verhaltens motiviert werden können. Das führt drittens unmittelbar zu der Frage, wie Formen psychischen Erlebens und die Gesundheit zusammenspielen: Ob Menschen etwa ein gesundheitsbezogenes Verhalten zeigen oder verändern, das hängt stark mit ihren zugrundeliegenden Gefühlen und Gedanken zusammen, etwa mit ihren Ängsten vor einer Krankheit oder mit ihren Erwartungen von positiven Auswirkungen auf Gesundheit. Damit sind die emotionalen und kognitiven Bedingungen eines Gesundheitsverhaltens angesprochen. Ein altes Thema der Psychosomatik, das von der Gesundheitspsychologie neu aufgegriffen wurde, ist viertens der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Krankheit bzw. Gesundheit. Können bestimmte Persönlichkeitseigenschaften das Risiko erhöhen, eine spezifische Krankheit zu entwickeln? Gibt es auch Merkmale der Persönlichkeit oder personale Kompetenzen, die vor Krankheiten schützen? Wenn Menschen an einer Krankheit leiden, dann stellen sich fünftens psychologische Fragen nach der Art ihrer Bewältigung, wie die Betroffenen diese emotional erleben, kognitiv verarbeiten und wie sie in ihrem Alltag damit umgehen. Schließlich stellen sich sechstens eine Reihe von psychologischen Fragen, wenn kranke Menschen als Patienten behandelt werden: Wie muss die Arzt-Patienten-Beziehung gestaltet sein, um zum Behandlungserfolg beizutragen? Welche Bedingungen tragen zur Mitarbeit des Patienten im Behandlungsprozess bei, welche behindern sie? Welche Prozesse der Kommunikation und der sozialen Interaktionen in Institutionen des Gesundheitssystems wirken sich in welcher Weise auf den Krankheitsverlauf und die Genesung aus?
Insgesamt besteht in den Gesundheitswissenschaften – zumindest theoretisch – ein Konsens, dass ein angemessenes Modell von Gesundheit und Krankheit mindestens drei Ebenen enthalten muss: eine biologisch-medizinische, eine psychologische und eine soziale. Entsprechend wird heute das klassische biomedizinische Krankheitsmodell als zu eng abgelehnt und ein biopsychosoziales Modell von Krankheit favorisiert. Die empirisch belegten psychologischen Zusammenhänge bei Gesundheit und Krankheit, das daraus entstandene biopsychosoziale Krankheitsmodell und die neue Orientierung an einem Gesundheitsbegriff haben dazu beigetragen, dass eigenständige psychologische Beiträge für dringend notwendig und Gesundheitspsychologie als neues Fach als sinnvolle wissenschaftliche Perspektive betrachtet wurden.
Die Gesundheitspsychologie ist eine neue und immer noch relativ junge Disziplin. Ihre Entstehung im internationalen Rahmen in den 1970er Jahren reflektiert den zunehmenden Bedarf an psychologischem Wissen und an psychologischen Praxisansätzen in den Feldern von Krankheit und Gesundheit. Sie ist aber auch Teil einer interdisziplinären Entwicklung, die im Umfeld der Medizin eine Reihe von Gesundheitsdisziplinen hervorgebracht hat wie zum Beispiel die Verhaltensmedizin, Gesundheitssoziologie und Gesundheitspädagogik; und diese Aufbruchbewegung von Gesundheitsthemen in vielen wissenschaftlichen Gebieten demonstriert auch, dass dieses komplexe Gebiet nicht durch eine Disziplin allein zu bewältigen ist. Die Vorreiterrolle spielten, wie so oft in der Psychologie, die USA, in denen sich bereits 1978 die »Health Psychology « offiziell etablierte. In der Folge entwickelte sich eine sehr rege und produktive Forschungstätigkeit, es entstanden neue Studiengänge sowie erste eig...