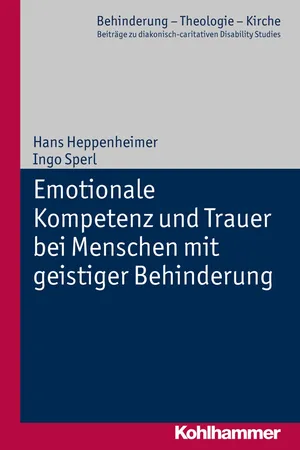
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Emotionale Kompetenz und Trauer bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 170 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Emotionale Kompetenz und Trauer bei Menschen mit geistiger Behinderung
About this book
Die Geschichte der Menschen mit geistiger Behinderung ist geprägt von Ausgrenzungen und Diskriminierungen. Auch die Fähigkeit zu trauern wurde diesem Personenkreis lange Zeit abgesprochen. Ihre Trauergefühle wurden oft nicht ernst genommen oder negiert. Dabei sind sie durch ihre emotionale Kompetenz ganz besonders befähigt, Trauer wahrzunehmen und zu leben. Die emotionale Wahrnehmung der Trauer hat neben der kognitiven einen entscheidenden Stellenwert bei der Bewältigung von Verlust- und Krisensituationen. Gerade deshalb geht es um den Ausdruck und die Gestaltung von Emotionen, wenn Menschen Abschied nehmen und trauern. Die Voraussetzungen dafür bringen geistig behinderte Menschen in einem oft beachtenswerten Maße mit.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Emotionale Kompetenz und Trauer bei Menschen mit geistiger Behinderung by Hans Heppenheimer, Ingo Sperl, Johannes Eurich, Andreas Lob-Hüdepohl in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Theology. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Geleitwort
„Weinet mit den Weinenden“1 – dieser Auftrag des Römerbriefes an die christlichen Gemeinden wurde lange Zeit in der Diakonie im Umgang und der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung vergessen. Ihre von vielfacher Trauer bestimmte Lebenssituation wurde oft nur marginal wahrgenommen. In der Bibel werden jedoch ausnahmslos alle Menschen als Geschöpfe Gottes gesehen und behinderte Menschen genießen in den Evangelien darum auch eine bemerkenswerte Wertschätzung, weil sie Geschöpfe Gottes sind.2 Gleichwohl wurden sie in der Diakonie lange Zeit nur von ihren behinderungsbedingten Defiziten her gesehen. Das kam insbesondere in Trauersituationen zum Ausdruck. Allzu häufig wurden HeimbewohnerInnen nicht zu Beerdigungen in ihren Familien geholt, traurige Nachrichten wurden ihnen vorenthalten, ihre Trauergefühle und -bedürfnisse wurden oft übergangen. Das geschah meist aus einer falsch verstandenen Fürsorge. Auch dass die Trauer in der modernen Gesellschaft lange tabuisiert wurde, hatte negative Auswirkungen auf das Leben der Menschen mit geistiger Behinderung. Die Hospizbewegung hat in den letzten dreißig Jahren Sterben und Trauer wieder zu einem gesellschaftlichen Thema gemacht. Der Umgang mit behinderten Menschen war davon jedoch weitgehend unberührt geblieben.
Hans Heppenheimer hat in seiner Arbeit als Pfarrer in Mariaberg sehr schnell das Defizit im Umgang mit Trauersituationen erkannt und daraus Konsequenzen gezogen. Er nahm die Trauer der HeimbewohnerInnen ernst, Trauer wurde ein wichtiges Thema in seinen Gottesdiensten und seiner Seelsorge. Seine Trauerpredigten thematisierten die Würde von Menschen mit geistiger Behinderung. Er initiierte in Mariaberg bisher nicht bekannte Gottesdienstformen, wie Osternacht, Salbungsgottesdienst und Goldene Konfirmation. Die HeimbewohnerInnen erlebten dadurch eine neue Wertschätzung.
In unterschiedlichen Bereichen entdeckte er die Begabung der emotionalen Kompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung. Emotionale Kompetenz ist elementar für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Der wichtige Beitrag, den behinderte Menschen dabei erbringen, wurde bisher kaum beachtet. Emotionale Kompetenz ist insbesondere ein Zeichen der Trauerfähigkeit. Lange Zeit wurde den Menschen mit geistiger Behinderung die Fähigkeit der emotionalen Bindung und der Trauer grundsätzlich abgesprochen. Aber behinderte Menschen haben ein Recht auf Trauer. Sie ist ein Teil ihrer Würde. Diese Trauer bezieht sich nicht nur auf den Tod, sondern auch auf die Abschiede im Leben von behinderten Menschen. Wenn die Trauer mit ihren verschiedenen Anlässen ernst genommen wird, erleichtert das das Zusammenleben.
Das Bemühen von Hans Heppenheimer mündete in das Projekt „Entwicklung einer Trauerkultur in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung am Beispiel Mariaberg“, das von der Robert Bosch Stiftung dankenswerterweise gefördert wurde. Dadurch erfuhr es eine erhebliche Beachtung in der Behindertenhilfe und der interessierten Öffentlichkeit. Das Projekt trug dazu bei, in vielen anderen Einrichtungen die Dringlichkeit der Trauerarbeit für HeimbewohnerInnen, MitarbeiterInnen und Angehörige zu erkennen.
Für den Erfolg des Projekts war es notwendig, dass es sowohl von MitarbeiterInnen und Angehörigen, als auch von den verschiedenen Leitungsebenen der Einrichtung getragen wurde. Sich auf die Tabuthemen „Trauer“ und „Trauerarbeit“ einzulassen, war für alle Beteiligten ein beachtlicher Schritt.
Im Rahmen des Projekts „Entwicklung einer Trauerkultur“ wurden Unterrichtsmaterialien zum Thema „Trauer“ für die Ausbildung von HeilerziehungspflegerInnen entworfen und erprobt.3 Studientage für MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Altenhilfe, für LehrerInnen von Sonderschulen und für HospizhelferInnen öffneten neue Zugänge zu eigener und fremder Trauer.4 Für HeimbewohnerInnen und MitarbeiterInnen wurden Gesprächskreise zu Trauerthemen unter fachlicher Leitung durchgeführt. Jahreszeitenfeiern halfen, Trauer nicht nur in Verbindung mit dem Sterben, sondern als Lebensprozess wahrzunehmen und in den Zusammenhang des Glaubens zu stellen.
Hans Heppenheimer hat das Projekt sehr engagiert geleitet. In allen Aktivitäten war seine Handschrift als evangelischer Geistlicher spürbar. In der Verbindung seiner christlichen Überzeugung mit den Erkenntnissen der Trauerforschung hat er die „Entwicklung einer Trauerkultur“ als grundlegend diakonisches Anliegen aufgenommen. Denn insbesondere in der Trauer und Trauerarbeit begegnen sich behinderte und nicht behinderte Menschen auf Augenhöhe. Jeder Einzelne wird dabei in seiner Trauer wahrgenommen und begleitet. Und das entspricht in besonderer Weise auch dem evangelischen Profil und der damit verbundenen Sensibilität für den Einzelnen aus der Überzeugung heraus, dass Gott sich unmittelbar jedem einzelnen Menschen zuwendet, ihn bei seinem Namen ruft5, begleitet, zu Recht bringt und ihn aus freier Gnade und Barmherzigkeit in seine ewige Herrlichkeit aufnimmt.
Das vorliegende Buch beschreibt die Entdeckung der emotionalen Kompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung als entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung einer Trauerkultur und die daraus erwachsenden Konsequenzen.
Es entstand in der Zusammenarbeit von Pfarrer Hans Heppenheimer und Pfarrer Ingo Sperl. Beide waren sowohl als Projektleiter als auch als -berater für den Erfolg des Projekts maßgebend. Dieses Buch ist ein wichtiger Impuls, um dem Thema Trauer im Bereich der Menschen mit Behinderung eine weitere Verbreitung zukommen zu lassen. Möge es allen zum Segen dienen.
Herrenberg, den 26. Mai 2011
Dekan Klaus Homann
Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzender von Mariaberg e. V.
Über das Buch und die Autoren
Dieser Band entstand im Dialog zwischen zwei Praktikern. Er beschreibt ein neues Modell einer Trauerkultur und ist für die Praxis gedacht. Wir wollen aber auch WissenschaftlerInnen ausdrücklich einladen und ermuntern, sich unseres Themas anzunehmen.
Hans Heppenheimer ist evangelischer Pfarrer in Mariaberg, einer Einrichtung der Behinderten- und Jugendhilfe. Zuvor war er lange Jahre als Geistlicher in „normalen“ Kirchengemeinden tätig. Auch Ingo Sperl ist evangelischer Pfarrer und war lange als Altenheimseelsorger maßgeblich in der Hospizarbeit in Süddeutschland aktiv.
Dass das Thema Trauer für Menschen mit geistiger Behinderung bisher vernachlässigt war, hat Hans Heppenheimer in seiner Arbeit entdeckt. Vielleicht war er der richtige Mann zur richtigen Zeit in der Einrichtung Mariaberg, vielleicht war aber überhaupt die Zeit reif für einen anderen Umgang mit der Trauer in diesen Einrichtungen.
Das Projekt „Entwicklung einer Trauerkultur in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung“ war durch die seelsorgerliche Arbeit Hans Heppenheimers gut vorbereitet. Die Robert Bosch Stiftung hat das Projekt finanziell großzügig gefördert und ermöglicht.
Im Dialog der Verfasser wurde das vorliegende Buch entwickelt. Für die LeserInnen soll der Entstehungsprozess von Anfang an transparent sein, deshalb sind große Teile dieses Buches bewusst in der narrativen Ich-Form verfasst worden, hinter der, soweit nicht anders vermerkt, Hans Heppenheimer steht.
Das Verdienst der Hospizbewegung besteht im Wesentlichen darin, dass Sterbebegleitung nicht nur theoretisch behandelt wurde, sondern dass sie von praktischen Erfahrungen ausging. Diese Erfahrungen an der Basis haben schließlich Ergebnisse hervorgebracht, die dann von der Wissenschaft aufgegriffen und reflektiert wurden. Auch Elisabeth Kübler-Ross brauchte zuerst die Gespräche mit Sterbenden6, bevor sie die Sterbephasen ableiten und beschreiben konnte.
Die Zugänge zum Thema „Trauerkultur bei Menschen mit geistiger Behinderung“ sind ebenso aus der alltäglichen Erfahrung heraus gewonnen. Der persönliche Weg nach Mariaberg als Geistlicher einer Einrichtung wird deshalb genauso beschrieben wie die Stationen der praktisch-theologischen Arbeit vor Ort. Es wird gezeigt, wie aufgrund eines weit gefassten Trauerbegriffs das Thema schon in verschiedenen Projekten (z. B. „Tiere in der Bibel“, Kinderbibelwochen u. a.) seine Vorläufer hat. Es werden auch Schicksale von behinderten Menschen exemplarisch beschrieben.
Der Titel des Projekts „Entwicklung einer Trauerkultur“ beinhaltet von Anfang an einen hohen Anspruch an die jeweilige Einrichtung, sich auf einen neuen, bisher unbekannten Weg zu begeben. Und es ist bemerkenswert, wie die Einrichtung Mariaberg sich auf dieses Experiment eingelassen hat. Denn viele Menschen in unterschiedlichen Funktionen haben sich von diesem Weg inspirieren und überzeugen lassen: Viele Mitarbeitende, die Leitung der Institution, Angehörige und schließlich die HeimbewohnerInnen7 selbst. Auf diesem gemeinsamen Weg wurde deutlich, dass eine „Trauerkultur“ keineswegs ein zu hoher Anspruch ist, sondern den umfassenden Bedürfnissen einer Einrichtung entspricht. Schließlich geht es vor allem um die Wahrnehmung der emotionalen Situationen im Zusammenleben der BewohnerInnen und Mitarbeitenden. Die Vorbereitung und Entwicklung des Projekts, seine Ziele und seine Erfolge, werden im Folgenden dargestellt. Es wäre schön, wenn viele Einrichtungen diesen Impuls aufnehmen würden und das Buch auf diese Weise einen kleinen Beitrag dazu leisten könnte, dass die Trauer von Menschen mit geistiger Behinderung neu gesehen, ernst genommen und begleitet wird. Es beschreibt aber auch die „emotionale Kompetenz“, d. h. die unerwartet großen Fähigkeiten geistig behinderter Menschen, die Abschiede ihres Lebens und ihr Leben insgesamt zu betrauern.
Emotionale Kompetenz8 ist nicht messbar wie ein Intelligenzquotient, sondern sie ist nur wahrnehmbar durch Beobachtungen und Erzählungen. Auch die vorliegende Veröffentlichung verdankt ihre Entstehung Beobachtungen und Erzählungen. Ohne die Erzählungen von HeimbewohnerInnen und Mitarbeitenden wäre sie nicht möglich gewesen. Die Namen in den erzählten Geschichten und Begebenheiten wurden durchgehend geändert. Am Ende des Buches werden jedoch alle beteiligten Personen namentlich genannt.
Unser besonderer Dank für die Ermöglichung und wohlwollende Begleitung des Projekts gilt Dr. Almut Satrapa-Schill und Bettina Tef von der Robert Bosch Stiftung, Dekan Dr. Jürgen Mohr, Reutlingen, Mitglied im Projektbeirat, Dekan Klaus Homann, Herrenberg, ebenfalls Mitglied im Projektbeirat, den Mariaberger Vorständen Thilo Rentschler (Vorstandssprecher), Rüdiger Böhm und Michael Sachs sowie dem ehemaligen Vorstand Martin Henke. Ebenso bedanken wir uns bei Dr. Heidrun Metzler von der Forschungsstelle „Lebenswelten behinderter Menschen“ der Eberhard Karls Universität Tübingen für die wissenschaftliche Begleitung. Dank bekunden wir auch der Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt, vertreten durch Lore Gutmann und Pamela Brecht, dem Mariaberger Angehörigenbeirat, vertreten durch Josef Kienle, und dem Mariaberger Heimbeirat, vertreten durch Heinz Kaufmann, für die gute Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts.
Schließlich bedanken wir uns auch bei den Herausgebern der Reihe „Behinderung – Theologie – Kirche“, Prof. Dr. Johannes Eurich, Direktor des Diakoniewissenschaftlichen Instituts der Universität Heidelberg, und Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, sowie dem Kohlhammer-Verlag für die Veröffentlichung des vorliegenden Buches in dieser Reihe.
Mariaberg im Juni 2011
Hans Heppenheimer und Ingo Sperl
1. Mariaberg – eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung und Benachteiligungen
Mariaberg – ein ehemaliges Benediktinerinnen-Kloster – liegt auf der Schwäbischen Alb zwischen Reutlingen und Sigmaringen über dem Lauchert-Tal. 1847 durch den Arzt Dr. Carl Rösch gegründet, war Mariaberg die erste so genannte Komplexeinrichtung für Menschen mit Behinderungen in Deutschland mit einem Schul-, Wohn- und Arbeitsangebot. Mariaberg ist ein Stadtteil von Gammertingen mit ca. 500 Einwohnern. Hier wohnen HeimbewohnerInnen und Mitarbeitende der Einrichtung.
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde Mariaberg durch die Vorreiterrolle in der Frühförderung von behinderten Kindern bundesweit bekannt. Bis heute hat sich Mariaberg zu einem überregionalen Zentrum für ambulante, teilstationäre und stationäre Dienstleistungen in der Jugend- und Behindertenhilfe entwickelt. Seit 2005 befindet sich die Einrichtung in einem Wandlungsprozess weg von der Komplexeinrichtung auf dem Berg, hin zu regionalisierten Wohnangeboten inmitten von Kommunen im nahen und weiteren Umkreis. Zudem ist Mariaberg mit seinem Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie führend in der Betreuung von Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung.
In der Mariaberger Klosterkirche werden sonntäglich Gottesdienste gefeiert. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in Mariaberg einen eigenen Friedhof, sodass die meisten BewohnerInnen auch hier bestattet werden können. Viele der älteren HeimbewohnerInnen kamen im Schulalter nach Mariaberg und leben hier bis zu ihrem Lebensende.
1940 wurden im Rahmen der so genannten „Euthanasie“ 61 HeimbewohnerInnen nach Grafeneck bei Münsingen verbracht und dort ermordet. Seit 1990 erinnert ein Denkmal neben der Mariaberger Klosterkirche an dieses Verbrechen.
2. Emotionale Kompetenz und geistige Behinderung
Unter „emotionaler Kompetenz“ versteht man die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen und zu spüren und diese Wahrnehmung in Handlungsoptionen umzusetzen. Claude Steiner verwendet auch den Begriff der emotionalen Bewusstheit. Darunter versteht er die Fähigkeit oder Gabe, erstens, zu wissen, was man fühlt, zweitens, zu wissen, was andere fühlen, drittens, den Grund dieser Gefühle herauszufinden und schließlich viertens, den Effekt dieser Gefühle auf andere vorherzusehen.9 Der Begriff „Emotionale Kompetenz“ wird synonym mit „Emotionaler Intelligenz“, die von Golemann ausführlich beschrieben wurde, verwendet.10 Beiden Darstellungen ist gemeinsam, dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht erwähnt werden.
Ausgangspunkt der Beschreibung der emotionalen Intelligenz oder der emotionalen Kompetenz ist die Beobachtung, dass der Intelligenzquotient (IQ), mit dem lange Zeit die menschlichen Fähigkeiten gemessen wurden, keine verlässliche Größe für den beruflichen und sozialen Erfolg einer Person darstellt. Für den sozialen Erfolg spielt vielmehr die emotionale Kompetenz, die Fähigkeit zur Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle, eine wesentliche Rolle. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Intelligenz der Gefühle.
Menschen mit einem hohen IQ, deren emotionale Fähigkeiten jedoch unterentwickelt sind, sind hochgefährdet, in sozialen Beziehungen zu scheitern. Die emotionale Kompetenz ist nicht messbar wie der Intelligenzquotient.
Menschen mit geistiger Behinderung haben zumeist keinen hohen IQ. Sie haben große Probleme mit Abstraktionen. Das betrifft sowohl die Sprache als auch das räumliche und zeitliche Vorstellungsvermögen. Gleichzeitig haben sie häufig eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung von eigenen und fremden Gefühlen und die Fähigkeit der Empathie.
Sie verfügen j...
Table of contents
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort
- 4. Das Projekt „Tiere der Bibel“
- 6. Die Trauer im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung
- 10. Wie sich eine Trauerkultur entwickeln kann
- Literatur