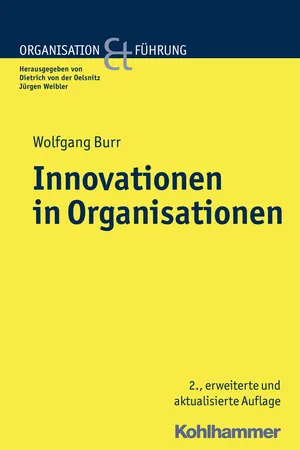![]()
1 Einleitung
Das vorliegende Buch gliedert sich in drei große Hauptkapitel. Das erste Hauptkapitel befasst sich mit der Darstellung von Grundlagen der Forschung und Entwicklung und der Innovationsforschung. Es werden vor allem notwendige Begriffe definiert, Klassifikationen eingeführt und Grundkonzepte der Innovationsforschung dargestellt. Das zweite Hauptkapitel stellt die Rahmenbedingungen dar, die Einfluss darauf nehmen, ob Unternehmen überhaupt Innovationen tätigen und mit welchem Erfolg. Will man verstehen, warum Innovationsprojekte von Unternehmen gelingen bzw. scheitern, so ist die Kenntnis der Rahmenbedingungen, unter denen der Innovationsprozess abläuft, unverzichtbar. Nachdem die wichtigsten Rahmenbedingungen vorgestellt sind, nimmt das dritte Hauptkapitel die unternehmensinterne Perspektive ein. Es werden ausgewählte Theorien, Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements von Unternehmen vorgestellt.
Das vorliegende Buch nimmt eine ökonomisch-theoretische Perspektive ein. Die Bezugnahme auf Innovationstheorien und Konzepte aus anderen Wissenschaftsdisziplinen wie der Soziologie, der Psychologie und der Technikgeschichte kann nur sehr vereinzelt erfolgen. Ebenfalls ist das vorliegende Lehrbuch theoretisch-konzeptionell angelegt. Es bezweckt keine Einführung in statisch-ökonometrische Methoden, obwohl diese in der empirischen Innovationsforschung immer wichtiger werden. Dabei wird die Darstellung immer um Herausforderungen und aktuelle Fragestellungen der Innovationsforschung und des Innovationsmanagements herum gruppiert. Die Darstellung ist also primär problem- und themenorientiert und nur sekundär methodenorientiert.
Das vorliegende Buch ist ein Lehrbuch für den Einsatz in der Hochschullehre, es soll Interesse am Innovationsthema wecken, Konzepte vorstellen, mit Theorien vertraut machen und Methoden darstellen. Es ist kein Handbuch für Praktiker, auch wenn diese durch die Lektüre vielleicht Anregungen erhalten könnten.
![]()
2 Grundlagen der Forschung und Entwicklung sowie der Innovationsforschung
2.1 Zentrale Begriffe
Nachfolgend werden vier zentrale Begriffe erläutert, die in der Innovationsforschung und für das Verständnis des vorliegenden Buches zentrale Bedeutung haben.
2.1.1 Theorie, Technologie und Technik
Theorien sind der Versuch, mit Hilfe eines geordneten Aussagensystems die Realität zu erklären. Sie umfassen Ursache-Wirkungs-Aussagen. Für die Lösung praktischer Probleme sind jedoch Ziel-Mittel-Aussagen erforderlich. Solche Ziel-Mittel-Aussagen benennen Mittel bzw. Instrumente, die für die Realisierung bestimmter Ziele prinzipiell geeignet sind (vgl. Specht/Beckmann 1996, S. 14). Wir erhalten solche Aussagen durch Transformation von Ursache-Wirkungs-Aussagen in final-technologische Ziel-Mittel-Aussagen. Theorien sind also das Fundament für Technologien.
»Unter der Technologie ist allgemein ein Wissen zu verstehen, das zur Lösung praktischer Probleme geeignet ist.« (Specht/Beckmann 1996, S. 14). So verstandene Technologie umfasst Verfahrensregeln und Handlungsanleitungen, die zur Erreichung bestimmter Ziele empfohlen werden. Es handelt sich somit um ein »System von anwendungsbezogenen, aber allgemeingültigen Ziel-Mittel-Aussagen« (Chmielewicz 1979, S. 14, zit. nach Brockhoff 1999, S. 27).
Folgende Arten von Technologien sind zu unterscheiden: Schrittmacher-Technologien, Schlüsseltechnologien und Basis-Technologien (vgl. Brockhoff 1999, S. 33 f.):
• Schrittmacher-Technologien werden sich (voraussichtlich) erst zukünftig im Markt durchsetzen. Sie stellen den beteiligten Firmen hohe (latente) Wettbewerbsvorteile in Aussicht.
• Demgegenüber konnten sich Schlüssel-Technologien bereits im Markt etablieren. Sie ermöglichen den Unternehmen, die sie beherrschen, die Realisierung starker Wettbewerbsvorteile im gegenwärtigen Zeitpunkt.
• Basis-Technologien haben sich bereits seit längerem im Markt etabliert. Sie müssen von den relevanten Wettbewerbern als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am marktlichen Wettbewerb beherrscht werden. Auf Basistechnologien kann aber kein Unternehmen explizite Differenzierungs- und Wettbewerbsvorteile aufbauen (vgl. Gerybadze 2002, S. 67).
Diese Sichtweise drückt einen Technologie-Lebenszyklus aus, zu dessen Beginn eine Technologie Schrittmacherfunktion für den technischen Fortschritt besitzt sowie zukünftige Wettbewerbsvorteile verspricht und an dessen Ende sie zur Basistechnologie gereift ist. »Allerdings stellen sich solche Abläufe nicht gesetzmäßig ein. Sie sind vielmehr das Ergebnis handelnder Personen, die durch Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen, Nachfrage nach Produkten, staatliche Auflagen usw. den Ablauf beeinflussen.« (Brockhoff 1999, S. 33).
Die konkrete Anwendung einer Technologie, z. B. in Produkten oder Produktionsprozessen, wird als Technik bezeichnet. Eine Technologie kann somit eine Menge potenzieller Techniken umfassen, Technologie ist die Lehre von den Techniken (vgl. Brockhoff 1999, S. 27).
Bei Techniken kann unterschieden werden zwischen Spitzentechnik und höherwertiger Technik. Für diese Begriffe sind vielfältige Abgrenzungsmöglichkeiten denkbar. Eine häufige Definition orientiert sich am Input, der für die Technikentwicklung erforderlich ist:
• Von Spitzentechnik wird gesprochen, wenn in der entsprechenden Branche ein Forschungs- und Entwicklungsanteil am Umsatz von mehr als 9% üblich und erforderlich ist.
• Höherwertige Technik (auch hochwertige oder gehobene Technik genannt) wird demgegenüber Branchen mit einem Forschungs- und Entwicklungsanteil am Umsatz zwischen 3,0% und bis zu 9% zugeschrieben (vgl. EFI 2014, S. 218, 223).
Diese Definition hat eine Schwäche, denn Spitzentechnik bzw. höherwertige Technik wird nur anhand einer einzigen Kennzahl charakterisiert. Deshalb verwendet z. B. das U.S. Bureau of Labor Statistics eine Kombination von zwei Messgrößen, um Techniken zu charakterisieren und zu klassifizieren. Hierzu werden die beiden Indikatoren Forschungsintensität (Anteil der FuE-Ausgaben am Branchenumsatz) und Anteil des technisch-wissenschaftlichen Personals am gesamten Personalbestand einer Branche kombiniert. Spitzentechnik liegt gemäß dieser Klassifikation vor, wenn beide Messgrößen in einer Branche das Doppelte der Durchschnittswerte in der Volkswirtschaft als Ganzes übersteigen. Von höherwertiger Technik wird gesprochen, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist (vgl. Brockhoff 1999, S. 32).
Technik findet Einsatz in neuen Produkten und bei der Umsetzung neuer Produktionsprozesse, ist also Fundament für die Realisierung von Sachgütern und Dienstleistungen in entsprechenden Produktionsprozessen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: »Ein Produkt basiert in der Regel auf mehreren Techniken, die jeweils die praktische Anwendung von Technologien darstellen, die ihrerseits wiederum auf Theorien basieren.« (Specht/Beckmann 1996, S. 15). Eine zentrale Stellung hat die Technologie als Verbindungsglied zwischen Theorie und Praxis (Specht/Beckmann 1996, S. 14).
2.1.2 Invention versus Innovation
Innovation ist ein alltagssprachlich sehr häufig, fast schon inflationär verwendeter Begriff. Bei Innovationen geht es um etwas »Neuartiges«: Neue Produkte und Dienstleistungen, neue Produktionsverfahren, neue Vertrags- und Organisationsformen, neue Vertriebswege. Bereits diese Aufzählung zeigt, dass Innovation mehr ist als nur eine technische Neuerung. Der Innovationsbegriff darf nicht auf technische Lösungen verengt werden. Hauschildt ist nicht zu folgen, wenn er ausführt, dass Innovation »aus dem Zusammenwirken von Technik und Anwendung« erwächst (Hauschildt 1997, S. 13). Erschwerend kommt hinzu, dass Individuen Innovationen sehr unterschiedlich wahrnehmen und beurteilen. Einige Individuen sehen ein Produkt als sehr innovativ an, dem andere Individuen den Neuigkeitscharakter absprechen. Innovation ist somit kein objektiv messbarer, sondern auch ein subjektiv gefärbter Begriff (vgl. Voßkamp 2002, S. 64).
Im wissenschaftlichen Bereich ist der Innovationsbegriff mit definitorischen Problemen behaftet. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen. Hauschildt stellt einen Überblick über die Begriffsverwendung in der betriebswirtschaftlichen Literatur dar. Er nennt 18 verschiedene betriebswirtschaftliche Definitionen und zeigt die teilweise erheblichen Unterschiede zwischen ihnen auf (vgl. Hauschildt 1997, S. 4-6).
Joseph A. Schumpeter nimmt in seinem 1912 erstmalig erschienenen Buch »Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung« eine pragmatische Definition vor. Schumpeter spricht in seinem Buch noch nicht von Innovation, sondern von der »Durchsetzung neuer Kombinationen«, die nicht regelmäßig und in kleinen Verbesserungsschritten des Bestehenden erfolgt, sondern diskontinuierlich auftritt (vgl. Voßkamp 2002, S. 64). Diskontinuität bedeutet: Sprunghafte Veränderung, Zerstörung alter Gleichgewichte, Ersetzung des Bestehenden durch das Neue. Für Schumpeter gibt es fünf Klassen von neuen Kombinationen:
»1. Herstellung eines neuen, d. h. dem Konsumentenkreise noch nicht vertrauten Gutes oder einer neuen Qualität eines Gutes.
2. Einführung einer neuen, d. h. dem betreffenden Industriezweig noch nicht praktisch bekannten Produktionsmethode, die keineswegs auf einer wissenschaftlich neuen Entdeckung zu beruhen braucht und auch in einer neuartigen Weise bestehen kann mit einer Ware kommerziell zu verfahren.
3. Erschließung eines neuen Absatzmarktes, d. h. eines Marktes, auf dem der betreffende Industriezweig des betreffenden Landes bisher noch nicht eingeführt war, mag dieser Markt schon vorher existiert haben oder nicht.
4. Eroberung einer neuen Bezugsquelle von Rohstoffen oder Halbfabrikaten, wiederum: gleichgültig, ob diese Bezugsquelle schon vorher existierte – und bloß sei es nicht beachtet wurde sei es für unzugänglich galt – oder ob sie erst geschaffen werden muss.
5. Durchführung einer Neuorganisation, wie Schaffung einer Monopolstellung (z. B. durch Vertrustung) oder Durchbrechen eines Monopols« (Schumpeter 1931, S. 100 f.).
Den Begriff der Innovation verwendet Schumpeter erst 1939 (vgl. Hauschildt 1997, S. 7). In der neueren innovationsökonomischen Literatur finden sich noch viele weitere Klassifikationen des Innovationsbegriffs.
Nach dem Inhalt der Innovation
Prozessinnovationen sind »neuartige Faktorkombinationen, durch die die Produktion eines bestimmten Gutes kostengünstiger, qualitativ hochwertiger, sicherer oder schneller erfolgen kann. Ziel dieser Innovation ist die Steigerung der Effizienz« (Hauschildt 1997, S. 9). Beispiele für Prozessinnovationen sind die Einführung von Computer Integrated Manufacturing (CIM) in der herstellenden Industrie in den 1980er Jahren (gesteigerte Flexibilität bei der Bewältigung kleiner Fertigungslose) oder der Übergang von der Verwendung von 200 mm-Wafern auf 300mm-Wafer in der Herstellung von Halbleitern (Kostensenkung in der Halbleiterherstellung) bei Infineon.
Von Prozessinnovationen sind Produktinnovation zu unterscheiden: »Die Produktinnovation offeriert eine Leistung, die dem Benutzer erlaubt, neue Zwecke zu erfüllen oder vorhandene Zwecke in einer völlig neuartigen Weise zu erfüllen.« (Hauschildt 1997, S. 9) Eine erfolgreiche Produktinnovation war in den 1980er Jahren die Markteinführung der ersten Mobiltelefone, die erstmalig Telekommunikation mit der Mobilität der Nutzer verbanden oder vor einigen Jahren die Einführung von Blu-Ray-Abspielgeräten. Um eine erfolgversprechende technische Erfindung in ein marktgängiges Produkt umzusetzen, sind vielfältige Schritte erforderlich. Es müssen Investitionen für die Fertigungsvorbereitung und die Markterschließung getätigt werden, nachfolgend müssen Produktion und Marketing gestartet und Vertriebskanäle aufgebaut werden. Hieran wird ersichtlich, dass Innovationen nicht nur eine technische, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Seite haben.
Eine weitere Unterscheidung bei Produktinnovationen ist die zwischen Sachgut- und Dienstleistungsinnovationen, wobei letztere oftmals durch Besonderheiten im Vergleich zu Sachgutinnovationen gekennzeichnet sind. Häufig führt die Kombination von einem Sachgut mit innovativen Dienstleistungen zu neuartigen Problemlösungen und damit zu Innovation. Ein Beispiel für letzteres ist die Bündelung einer verkauften Werkzeugmaschine mit einem darauf abgestimmten Dienstleistungskonzept für Finanzierung, Beratung und After Sales Service als umfassende Problemlösung aus der Hand eines Anbieters (vgl. Burr/Stephan 2006).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Produkt- und Prozessinnovationen ist in folgendem Punkt zu sehen: Produktinnovationen werden im Markt durchgesetzt. Prozessinnovationen werden in der Regel innerbetrieblich durchgesetzt, wenn man den Fall, dass das Unternehmen seine erfolgreich realisierten Prozessinnovationen anderen Unternehmen am Markt anbietet, aus der Betrachtung ausblendet. Charakteristisch für Produktinnovationen ist, dass sie größere Durchsetzungsprobleme aufweisen als Prozessinnovationen: Für Produktinnovationen müssen Märkte geschaffen und zahlungsbereite Käufer gewonnen werden, während Prozessinnovationen von der Unternehmensleitung im Unternehmen durch Anordnung durchgesetzt werden können (vgl. Hauschildt 1997, S. 11).
Die Unterscheidung zwischen Produkt- und Prozessinnovationen ist allerdings nicht trennscharf: Oft braucht es für Produktinnovationen die Einführung neuer Fertigungsprozesse im Unternehmen, also die Einführung von Prozessinnovationen zur Ermöglichung von Produktinnovationen. Und bei Dienstleistungsinnovationen sind Produkt- und Prozessinnovationen nicht trennbar, sondern vielmehr identisch (vgl. Hauschildt 1997, S. 11).
Nach dem Grad der Neuartigkeit, d. h. dem Innovationsgrad
Hier wird in der Literatur unterschieden z. B. zwischen revolutionären und evolutionären Innovationen oder zwischen radikalen und inkreme...