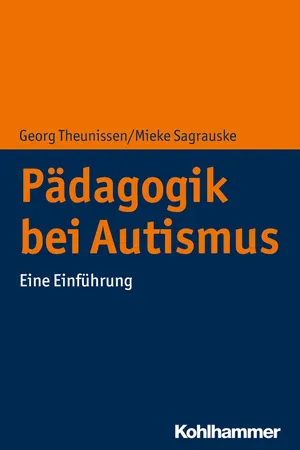![]()
Teil II: Pädagogische Praxisfelder, Konzepte und Methoden
![]()
4 Frühe Hilfen und vorschulische Erziehung und Bildung
Das Beispiel Jeff14
Die Geburt ihres Sohnes Jeff sei wie bei seiner älteren Schwester normal gewesen. Allerdings habe er sich schon als Säugling anders als seine Schwester verhalten, zum Beispiel häufig die Nahrung verweigert oder nur passierte Bananenkost gegessen, Liebkosungen und Körperkontakt abgelehnt oder sich durch Zurücklehnen und Schreien geweigert, auf den Arm genommen zu werden, Arme steifgehalten, weggestreckt und weggeschaut, selten auf Ansprachen der Eltern oder seiner Schwester reagiert, sich nicht für andere (z. B. Schwester) interessiert, keinen Kontakt zu anderen Menschen aufgesucht, sich abgekapselt und zurückgezogen, erst spät mit etwa zwei Jahren laufen gelernt, sich nicht für »normales« Babyspielzeug (Rasseln, Kuscheltiere, Bilderbücher o. ä.) interessiert, aber glitzernde Dinge, Armreif, Halsketten, Alufolien oder Silberpapier geliebt, Lampen gerne an- und ausgeschaltet und später immer mit Lichtschaltern durch An- und Ausknipsen von Licht gespielt; dabei wollte er nie völlig im Dunklen schlafen, sondern es musste immer eine Nachtbeleuchtung an sein.
Als er mit zwei Jahren immer noch kein Wort sprach, machten sich seine Eltern über seine Entwicklung Sorgen. Daher suchten sie einen Kinderarzt auf, der eine Entwicklungsverzögerung annahm und ihnen Hoffnung machte, dass sich Jeff noch »normal« entwickeln würde. Da aber kaum Entwicklungsfortschritte zu beobachten waren, folgten sie dem Rat einer Tante, sich an ein Regional Center15 zu wenden, welches für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Autismus (developmental disabilities) spezialisiert sei und Unterstützung bei Entwicklungsverzögerungen anbieten könne.
Da Jeff bis zu dem Zeitpunkt noch nicht »richtig« – so seine Mutter – untersucht worden war, veranlasste die Psychologin des zuständigen Regional Centers zunächst ein diagnostisches Assessment. Hierzu wurden in einem diagnostischen Zentrum eine Anamnese erstellt, die Eltern befragt, gemeinsam mit Jeff gespielt und Spielbeobachtungen durchgeführt, die alles in allem zu dem Befund führten, dass Jeff autistisch sei. Mit der Diagnose »Behinderung« (developmental disability) in Form eines Autismus war nunmehr die Voraussetzung gegeben, durch das Regional Center Unterstützungsleistungen zu bekommen.
Im Rahmen eines Elterngesprächs, an dem neben Experten verschiedener Disziplinen (z. B. Psychologin, Sprachtherapeutin) auch die Tante teilgenommen hatte, wurde gemeinsam mit einer Dienstleistungskoordinatorin des Regional Centers sowie mit einer Vertreterin der zuständigen Schulbehörde16 ein Unterstützungsplan für frühe kind- und familienzentrierte Hilfen erstellt, der wenige Monate später, als Jeff drei Jahre alt geworden war, in ein IEP (individualisierter Erziehungs- und Bildungsplan) überführt und in der Folgezeit jährlich fortgeschrieben wurde. In Kürze wurde ein Unterstützerkreis einberufen, um einen ITP (individualisierten Übergangsplan) als Nachfolgeprogramm zu vereinbaren. Der kind- und familienzentrierte Plan sah zunächst das Ziel einer Sprachförderung und eine Familienunterstützung (Beratung in Bezug auf häusliche Erziehung) durch ein spezialisiertes Förderzentrum vor. Hierzu hatte der für die Familie zuständige Unterstützungsmanager einen entsprechenden Dienstleister aufgesucht und diesen den Eltern vermittelt. Zudem wurde ihnen die Teilnahme an einer über das Regional Center organisierten Elternselbsthilfe-Gruppe empfohlen. Aus rein zeitlichen Gründen konnten sie sich leider bis heute – so die Mutter – nur selten mit anderen Eltern treffen und austauschen.
Des Weiteren wurde Jeff die Teilnahme an einem Intensivangebot in einem allgemeinen Kindergarten ermöglicht. Dort erhielt er bis zu Beginn der Schulzeit täglich zwei Stunden außerhalb der regulären Kindergartengruppe17 eine intensive Förderung in einer speziellen Gruppe mit insgesamt acht behinderten und/oder verhaltensauffälligen Kindern. Die Leitung solcher Gruppen obliegt üblicherweise einer Sonderpädagogin, die in der Regel durch mindestens drei Hilfskräfte unterstützt wird. Zumeist geht es bei einem Intensivangebot, das in einem durchstrukturierten Raum häufig als Stationslernen aufbereitet wird, um Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration, um Anbahnung und Förderung von exekutiven Funktionen, Sprache, Spiel- und Sozialverhalten (Kooperation, Joint Attention). So soll zum Beispiel jedes Kind entsprechend seines IEP täglich vier Stationen durchlaufen, die jeweils von einer pädagogischen Mitarbeiterin organisiert werden. Diese Stationen können zum Beispiel so aufgebaut sein: Station 1: kreatives Basteln, Station 2: freie Wahlangebote, Station 3: bauen, Station 4: zählen, sortieren, zuordnen, Begriffe bilden. Bei dieser Stationsarbeit sollen verschiedene Methoden angewendet werden (z. B. das discrete trial training [dazu später], Positive Verstärkung, Hilfestellungen, Regeln befolgen, Entscheidungen unterstützen oder »beiläufiges« Lernen). Zur Verhaltensbeobachtung und Lernzielüberprüfung gibt es personenbezogene Dokumentationsbögen, die wöchentlich im Team ausgewertet und für weitere IEP-Zielplanungen genutzt werden.
Zeitgleich wurde vonseiten des Regional Centers aufgrund der Berufstätigkeit beider Elternteile die Fortführung der Familienunterstützung in Form einer Nachmittagsbetreuung für Jeff bewilligt. Diese Leistung wird bis heute durch einen für familienunterstützende Arbeit spezialisierten Dienstleister erbracht. Dieser hat Scott, einen Studenten (zuvor waren es drei andere Student*innen) beschäftigt, der eigens für diese Tätigkeit durch die Dienstleistungsorganisation vorbereitet wurde und prozessbegleitend beraten und unterstützt wird; Scotts Aufgabe ist es, nach Beendigung der täglichen Schulzeit (zuvor war es die Kindergartenzeit) Jeff aufzusuchen und ihn in eine kommunale Freizeiteinrichtung zu begleiten, wo er seine Hausaufgaben machen und Freizeitaktivitäten (v. a. im sportlichen Bereich) nachgehen kann. Dieses Angebot ist nicht etwa »beliebig« im Sinne eines »Laisser-faire«, sondern als individualisiertes Programm aufbereitet. Dadurch sollen im Rahmen interessenorientierter Tätigkeiten (v. a. Schmuckstücke wie Ringe oder Ketten aus Draht, glitzernden Perlen oder bunten, leuchtfarbigen Schnüren herstellen; Mosaikarbeiten aus Bruchmaterial, Emaillierungen, Baseball) quasi nebenbei (»beiläufiges Lernen«) IEP-Ziele verfolgt werden, zum Beispiel Aufbau und Förderung von Sozialverhalten (z. B. durch Einbeziehung nichtbehinderter Kinder) oder Unterstützung eines planvollen Handelns und konzentrierten Tätigseins sowie einer Benennung von Gegenständen. Auf diese Weise sei es gelungen, dass Jeff inzwischen für kurze Zeit mit anderen Kindern spielen, sich mit Zwei-Wort-Sätzen oder auch mit Bildkarten verständigen würde. Außerdem habe er im Freizeitzentrum einen nichtbehinderten Freund namens Juan gefunden. Juan sei in seiner Schule zugleich sein »Buddy«18 und würde ihn an Tagen, an denen Scott nicht kommen kann, zum Freizeitzentrum begleiten. Da der Weg einfach und recht kurz sei (5 bis 10 Minuten) und sich Jeff verkehrsgerecht und zielstrebig verhalten würde, sei die Begleitung durch Juan möglich und vertretbar. Wie bei den anderen Studenten zuvor sei das Verhältnis zwischen Jeff und seinem Unterstützer »ausgezeichnet« (»Jeff und Juan lieben es. Es ist wunderbar!«).
Dieses Beispiel ist real und zugleich idealtypisch. Es führt uns einen wegweisenden Prozess und zentrale Aspekte bezüglich einer kind- und familienorientierten Unterstützung im Früh- und vorschulischen Bereich vor Augen, die dort zutage treten, wo:
1. ein Regional Center aufgesucht wird, welches ein sorgfältiges Assessment zur Einschätzung der Behinderung veranlasst,
2. bei einer nachgewiesenen Behinderung (in unserem Fall Autismus) Rechtsanspruch auf frühe Hilfen besteht,
3. ein Unterstützerkreis gebildet wird, um kind- und familienbezogene Hilfen feststellen zu können,
4. eine kind- und familienzentrierte Planung fokussiert und gemeinsam von Fachkräften und Eltern erarbeitet wird,
5. dabei von alltäglichen Erfahrungen, den Lebensbedingungen und der Stimme betroffener Eltern ausgegangen wird,
6. zudem Stärken und Interessen des Kindes beachtet werden,
7. umfassende Unterstützungsangebote (durch regionale Dienstleister) offeriert und organisiert werden,
8. professionelle und informelle Hilfen miteinander vernetzt werden,
9. eine inklusive Pädagogik fokussiert wird und
10. die Funktion eines Regional Centers als Instanz zur Beratung, Koordination und Sicherstellung von Unterstützungsmaßnahmen sichtbar wird.
Hierzulande gibt es zwar keine Regional Center, jedoch könnten ähnliche Anlaufstellen geschaffen werden, die für die Teilhabe- und Gesamtplanung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) zuständig sein und die aufgezeigten Koordinationsaufgaben übernehmen könnten (vgl. Theunissen 2014).
Behandeln oder unterstützen?
Wie unserem Beispiel zu entnehmen ist, können wir davon ausgehen, dass die Frage früher Hilfen oftmals an der Stelle beginnt, wo Eltern sich an ihren Kinderarzt oder ihre Kinderärztin wenden, weil sie den Eindruck haben, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Drängt sich ärztlicherseits der Verdacht einer Entwicklungsverzögerung auf, werden je nach Auffälligkeiten spezielle Untersuchungen empfohlen, die zum Beispiel durch ein sozialpädiatrisches Zentrum durchgeführt werden können. Neben Auffälligkeiten oder Verzögerungen in der Entwicklung können zugleich auch erzieherische Probleme auftreten. Manche Eltern neigen dazu, Schwierigkeiten in der Erziehung ihres auffälligen Kindes zunächst einmal herunterzuspielen oder zu verheimlichen. Damit möchten sie vermeiden, als mögliche »Versager« wahrgenommen zu werden. Andere fühlen sich hingegen in Bezug auf Erziehungsfragen weithin allein gelassen, indem sie keine adäquate Unterstützung (Beratung) im Hinblick auf den Umgang mit Verhaltensproblemen erfahren. Wie dem auch sei, heute wissen wir, dass insbesondere durch das Fehlen früher Hilfen in der Erziehung Prozesse befördert werden, die nicht selten mit einer Zunahme und Eskalation an Verhaltensauffälligkeiten einhergehen und in eine »klinische« Institutionskarriere des betreffenden Kindes münden (vgl. Theunissen u. a. 2018). Eine solche »Sackgasse« könnte vermieden werden, wenn frühzeitig Unterstützungssysteme wie beispielsweise ein Konsulentendienst19, »offene, niedrigschwellige Beratungsangebote« (BTHG 2016, 3337, Artikel 23 Änderung der Frühförderungsverordnung) oder vorhandene Angebote aus der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Triple P®)20 in Anspruch genommen und mit anderen Interventionen im Hinblick auf diagnostizierte Entwicklungsbeeinträchtigungen verzahnt würden.
Die bloße Fokussierung auf Entwicklungsbeeinträchtigungen im Rahmen der frühen Untersuchungen (Diagnostik) ist somit unzureichend. Davon abgesehen interessiert uns im Folgenden natürlich die Frage, was getan werden soll, wenn aus klinischer Sicht eine »tiefgreifende Entwicklungsstörung«, zum Beispiel Autismus, angenommen wird. Hierzu stoßen wir heute auf zwei zentrale Positionen, die sich kontrapunktisch gegenüber stehen. Zum einen haben wir es mit einer sogenannten Behandlungsperspektive zu tun, die bislang den Umgang mit Autismus maßgeblich bestimmt. Zum anderen findet eine sogenannte Unterstützungsperspektive immer mehr Zuspruch, die aus der Kritik an dem traditionellen Autismus-Modell hervorgeht und sich im Lichte einer stetigen Weiterentwicklung bewegt.
Zur Behandlungsperspektive
Unter dem Begriff der Behandlungsperspektive werden alle Auffassungen, Intentionen und handlungspraktischen Ansätze gefasst, die auf der Grundlage des traditionellen klinischen Modells Autismus als eine therapiebedürftige, »tiefgreifende Entwicklungsstörung« ausweisen und dabei keine funktionale Betrachtung autistischer Verhaltensmerkmale vornehmen.
Im Lichte der Behandlungsperspektive stehen Ziele wie »Heilung«, größtmögliche »Genesung«, »optimales Ergebnis« oder »optimaler Fortschritt« im Vordergrund, um eine möglichst »normale« (unauffällige) Entwicklung einer autistischen Person zu erreichen. Hierzu sollen so früh wie möglich bei Anzeichen oder bereits bestehenden Symptomen autistischen Verhaltens intensive therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden (vgl. Fein, Barton & Dumont-Mathieu 2017).
Tatsächlich scheint es zu einer »Genesung« zu kommen, indem 3 % bis 25 % aller als autistisch klassifizierten Kinder im Laufe ihrer Schulzeit keine Autismus-Diagnose mehr erhalten. Dieser Befund wird jedoch nicht nur auf eine intensive Frühbehandlung zurückgeführt, sondern gleichfalls damit begründet, dass einige dieser Kinder gar nicht autistisch waren (Fehldiagnose). Ferner wird bei manchen ein alleiniges »Auswachsen« autistischer Merkmale vermutet (vgl. Helt et al. 2008; auch Feinstein 2010, 283).
Zur intensiven Verhaltenstherapie (ABA)
Die Effekte durch frühe Interventionen werden insbesondere einer intensiven Verhaltenstherapie bei autistischen Kindern zugeschrieben. Diese Verhaltenstherapie wird häufig mit operanter Konditionierung, dem sogenannten diskreten Lernformat (discrete trial training (DTT))21 oder mit anderen anweisenden und einschränkenden Interventionstechniken unter ABA gefasst. Dabei handelt es sich jedoch um ein enges Verständnis von ABA, welches von der Bezeichnung »applied behavior analysis« (angewandte Verhaltensanalyse) abgeleitet wurde. Üblicherweise steht ABA als angewandte Verhaltensanalyse für einen Oberbegriff, der alle verhaltensorientierten Interventionen kennzeichnet. Dabei kommen passgenaue Techniken zur Veränderung oder Beeinflussung von Verhalten zur Anwendung, nachdem eine systematische Erfassung von Verhalten, den auslösenden Bedingungen und den Konsequenzen durchgeführt wurde. Folglich ist die Intensivtherapie mit ihrer prominenten Methodik des diskreten Lernformats (DTT) nur eine Form von ABA und nicht mit ihr gleichbedeutend.
»Fälschlicherweise wird in der Öffentlichkeit die Definition von ›angewandter Verhaltensanalyse‹ mit der spezifischen Methode von ABA, dem DTT, gleichgesetzt, anstatt den Begriff als einen Schirm von empirisch basierten Praktiken zu verstehen, die auf operante Lernprozeduren aufbauen« (Schreibman et al. 2015, 243).
Konzipiert und erforscht wurde die intensive Frühtherapie (mit der Priorisierung des DTT) von I. Lovaas, der, wie in unserem Geschichtskapitel erwähnt, zunächst aversive (bestrafende) Interventionen (z. B. Schläge auf das Gesäß) als geeignete Mittel betrachtete, um unerwünschtes Verhalten zu »eliminieren« (vgl. Chance 1974).
Wenngleich heute aversive Methoden vermieden werden, hat sich an der Zielsetzung und am einschränkenden Charakter der eng gestrickten ABA-Praxis durch das DTT kaum etwas verändert.
Als besonders wirksam gilt eine intensive Frühtherapie, wenn sie mindestens zwei Jahre dauert, 25 bis 40 Wochenstunden umfasst und unter einem 1:1 Verhältnis erfolgt. 75 Prozent der Stunden sollten dabei durch eine verhaltenstherapeutische Fachkraft und 25 Prozent der Stunden durch ein Elternteil abgedeckt werden.
Inhaltlich ist die Therapie so angelegt, dass vonseiten der Fachkräfte in Orientierung an der »normalen« menschlichen Entwicklung bestimmte Lernziele festgelegt werden (z. B. Anbahnung von Blickkontakt, von Lautäußerungen beziehungsweise Sprache, von sozialer Aufmerksamkeit und Zugewandtheit; Förderung von Imitation; Abbau repetitiven, stereotypen Verhaltens). Diese Ziele werden beim DTT kleinschrittig in erwünschte Verhaltensweisen zerlegt, die im Rahmen eine...