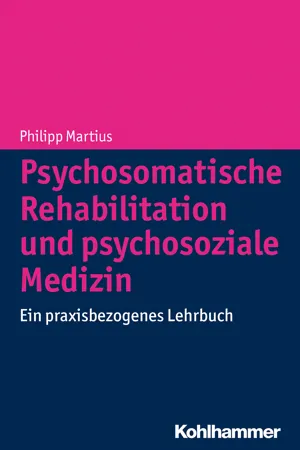![]()
1 Grundlagen
1.1 Psychosoziale Perspektiven: das biopsychosoziale Modell und chronische Krankheit
Die Rentenversicherung als Träger der medizinischen Rehabilitation verpflichtet sich in ihrem Ansatz einer biopsychosozialen Medizin in Anlehnung an die ICF-Klassifikation (DIMDI 2010, Schuntermann 2008). Dieser Ansatz leitet sich aus dem bekannten umfassenden Gesundheitsbegriff der WHO (1948) ab, der Gesundheit mit »vollkommenem körperlichem, seelisch-geistigem und sozialem Wohlbefinden« gleich setzt. Es ist kritisch anzumerken, dass dieses Konzept gewissermaßen wohlfeil und damit wieder unverbindlich ist. Unter diesen Rettungsschirm passt jeder! Das heißt aber noch lange nicht, dass dadurch eine bessere Medizin oder Rehabilitation geschieht.
Was ist also dann das Machbare und was das Wünschenswerte an diesem Modell?
Bio: Der Anspruch auf eine biologische Begründung der Medizin bezieht sich auf die medizinisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen. Durch die strikte medizinische Ausrichtung der Rehabilitation ist dieser Bereich hinreichend abgedeckt. Die Strukturvorgaben der Rentenversicherung (Bernhard 2008) sehen z. B. fachärztliche Standards in der Leitung und Bemessungsgrundlagen für Ärzte (wie für Psychologen, künstlerische und Bewegungstherapeuten sowie Pflege) vor. Außerdem muss bald nach Aufnahme eine frühzeitige Sicht der Versicherten durch einen Facharzt erfolgen. Die medizinische Versorgung soll auf hohem Niveau gesichert werden. Gleichzeitig haben Rehabilitations-Einrichtungen enge Grenzen bezüglich einer umfassenden Diagnostik oder medizinischen Therapie. Insofern wird die biologisch-medizinische Kompetenz auch dafür benötigt, die Grenzen des Reha-Settings für eine medizinische Behandlungsbedürftigkeit von klinischen Störungen rechtzeitig festzustellen.
Psycho: Der Einsatz psychologischer Behandlungsmethoden definiert die Psychosomatik und rechtfertigt damit die Wortwahl. Im Rahmen dieses Buches kann die aktuelle Psychotherapie-Debatte über die Wirkung allgemeiner und/oder spezifischer Faktoren nicht nachgezeichnet werden. Auf entsprechende Literatur wie Wampolds spannende »Great Psychotherapy Debate« (2001) wird verwiesen. Definitiv hat sich in den Reha-Kliniken eine hoch kompetente und auf den eigenen Arbeitsbereich spezialisierte psychotherapeutische Kompetenz entwickelt. Kritisch ist anzumerken, dass die eingesetzten Psychotherapie-Verfahren unter Reha-Bedingungen bisher nur rudimentär evaluiert worden sind (z. B. Arbeitskonflikt-bezogene Psychotherapie: Hillert, Koch und Edlund 2007). Vergleichsstudien oder randomisierte klinische Studien als methodischer Goldstandard fehlen. So sind zwar die großen Psychotherapieschulen in der Rehabilitation vertreten, aber ihre kontextbezogene Wirksamkeit müssen wir erst noch nachweisen. Die qualitätssichernden Maßnahmen der Rentenversicherung helfen dabei nicht, weil sie nur die Erfüllung der Strukturen, nicht aber die Umsetzung der Inhalte belegen. Hier wäre zu wünschen, dass die Rentenversicherung als Träger und Motor der Rehabilitationswissenschaften mehr steuernde Funktionen übernimmt. Als Charakteristika der Reha-spezifischen Konzepte könnte man ohne Anspruch auf Vollständigkeit nennen:
• Kompetenz im Einsatz psychotherapeutischer Techniken bei bildungs- und psychotherapiefernen Schichten und im Umgang mit primär nicht introspektions- und verbalisierungsfähigen oder -willigen Patienten: Menschen, die mit ihren persönlichen Voraussetzungen und Herausforderungen in keiner psychosomatischen Akutklinik aufgenommen würden;
• die Ausrichtung auf die Arbeitswelt und die Integration der sozialmedizinischen Perspektive in den psychotherapeutischen Prozess;
• indikative Gruppenkonzepte, die sowohl störungsspezifisch als auch bezogen auf berufliche Herausforderungen entwickelt wurden;
• Patientenschulung durch den umfangreichen Einsatz psychoedukativer Maßnahmen in sog. »Vorträgen«;
• die Fokussierung auf Ressourcen und Resilienz auch bei erheblichen psychischen Defiziten; die Ausarbeitung von Reha-Therapiestandards in Anlehnung an Leitlinien der Fachgesellschaften (DRV 2011) sowie – bei aller gebotenen Kritik – die umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen der Rentenversicherungsträger.
Alle diese Aspekte begründen die Feststellung, dass in der psychosomatischen Rehabilitation besondere, herausfordernde, reizvolle Arbeitsbedingungen vorzufinden sind.
Sozial: Es ist eine Kernaussage dieses Buches, auch als Ausdruck der eigenen Erfahrungen in der psychosomatischen Rehabilitation, dass der Bezug auf die Arbeitswelt und die berufliche Leistungsfähigkeit des Patienten, der in diesem sozialen Kontext als »Versicherter« angesprochen wird, ein Spezifikum dieses Fachbereiches darstellt. Während psychosomatische Akutkliniken praktisch ganz auf die psychische Gesundheit abheben, stehen in der Rehabilitation Aspekte der Teilhabe und Aktivität, der Anpassung an die Lebensverhältnisse bzw. deren Modifikation, der Arbeitsfähigkeit bzw. der Abwendung längerfristiger beruflicher Leistungseinschränkungen im Vordergrund. Der Fokus auf den sozialen Bereich prägt in besonderer Weise die Rehabilitation psychischer Störungen. Die Orientierung an der ICF statt der ICD verweist in besonderer Weise auf die Berücksichtigung von funktionellen, aktivitätsbezogenen und partizipativen Dimensionen des Krankseins. Zwangsläufig werden dadurch auch Aspekte der Kontext- und Personfaktoren zum Gegenstand der professionellen Arbeit.
Daraus ergibt sich, dass die psychosomatische Rehabilitation als eigener Bereich im Sinne einer Psychosozialen Medizin innerhalb der medizinischen Psycho-Fächer beschrieben und neben die »großen Schwestern« psychosomatische Medizin bzw. Psychiatrie und Psychotherapie gestellt werden kann. Das bisherige Selbstverständnis als »Wurmfortsatz der Psychiatrie« oder als »Hinterstube der Psychosomatik« wird weder der aktuellen und zukünftigen Bedeutung noch den spezifischen Herausforderungen der Rehabilitation psychischer Störungen gerecht. Es ist paradox, dass ca. achtmal so viele Rehabilitations-Behandlungsplätze vorgehalten werden wie in der Akutpsychosomatik, aber die Rehabilitation im Mainstream der sog. Psycho-Fächer kaum wahrgenommen wird – und wenn doch, dann allenfalls um sich über die Fehlallokation von Versichertengeldern zu beklagen zuungunsten psychiatrisch behandlungsbedürftiger Patienten. Dieser Vorwurf ist auch deshalb nicht berechtigt, als es ja glücklicherweise eine reichhaltige, hoch differenzierte und seit Jahrzehnten gewachsene psychiatrische Rehabilitation mit erheblicher Durchlässigkeit des Systems gibt (Rössler 2004) – wovon der Psychosomatiker nur träumen kann. Denn auch in der Psychosomatik gibt es Menschen, für die längerfristige schützende und stützende Lebensräume wünschenswert wären. Die akut psychosomatischen Kliniken sind darauf im Sinne der Lebens- und Alltagsorientierung oft nicht zureichend ausgerichtet und fokussieren tendenziell auf die Symptomatik und die intrapsychischen Konflikte. Die psychiatrischen Reha-Einrichtungen sind aber häufig emotional wie kognitiv unterfordernd, weil sie ein anderes, deutlich mehr bzw. anders leistungsgewandeltes Publikum haben. So bleiben der psychosomatischen Reha oft nur Maßnahmen, die aus der beruflichen Rehabilitation oder der fachspezifischen Nachsorge abgeleitet werden können, eine Tatsache, deren Veränderung eine der zukünftigen Herausforderungen der psychosomatischen Rehabilitation darstellt.
Als eigenes Gebiet im Bereich der Psycho-Fächer definiert eine als Psychosoziale Medizin verstandene psychosomatische Rehabilitation jedenfalls spezifische Perspektiven, die dieses Arbeitsgebiet durchaus »sexy« machten (s. Vorwort).
An dieser Stelle soll auch kurz die Debatte um Konzepte zum Verständnis chronischer Erkrankungen dargestellt werden, wie sie z. B. von Schaeffer (2009) zusammengefasst wird. Danach wurden in einer sehr fruchtbaren Diskussionsphase in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Erweiterung eines medizinischen Bezugs einige wichtige Theorien entwickelt, die im Prinzip bis heute fortwirken, ohne dass es zu einer relevanten Annäherung oder gar Integration kam: Es handelt sich um eine interaktionstheoretische, eine stresstheoretische und eine gesellschaftstheoretische Position.
Die interaktionsspezifische Perspektive stellt das Krankheitserleben und die Bewältigung der Krankheitssituation in den Mittelpunkt und ist mit den Namen z. B. von Erving Goffman und Anselm Strauss verbunden. Fokus ist hier, wie eine als soziales Konstrukt verstandene Krankheit im gesellschaftlichen Kontext ausgehandelt und bewältigt wird. Dabei wurde den Kranken als Akteuren des Geschehens (und nicht nur als Kranken und Leistungsempfängern) erstmals Aufmerksamkeit geschenkt. Deren subjektive Realität und Handeln sei von der Besonderheit geprägt, dass »chronic illness is here to stay« (Schaeffer 2009, S. 19). Damit sind Probleme der Bewältigung, der Phasen der Krise und Rekonvaleszenz, und ständig wechselnder Anpassungsleistungen verknüpft. Diese müssen zwangsläufig zu Störungen der Biographie, der Identität und des Alltags- und Familienlebens führen. Die Autoren betonen, dass von diesen Herausforderungen nicht nur die Kranken, sondern auch die Angehörigen und professionellen Helfer betroffen sind und zwar in Form von Rückkopplungs-Prozessen, die derselben Instabilität unterliegen und eine hohe Flexibilität erfordern. Im weiteren Verlauf der Theorieentwicklung traten die Berücksichtigung biographischer Gesichtspunkte als Variablen im Krankheitsprozess – »chronic illness as biographical disruption« (Bury in Schaeffer 2009) – hinzu. Auch die Gegebenheiten der jeweiligen Lebensphasen und ihrer Übergänge (Transitionen) wurden diskutiert. Auf der Handlungsebene schließlich wurden die Patienten als »Ko-Produzenten« verstanden und untersucht bezüglich ihrer Ressourcen, den Selbststeuerungserfordernissen und dem verfügbaren sozialen Netz. Zuletzt wurden zunehmend Resilienzaspekte in die Debatte eingeführt.
Die stresstheoretische Debatte fokussiert auf das Bewältigungsgeschehen und ist im Wesentlichen mit dem Copingkonzept von Lazarus verbunden. Danach ist die Frage des Stresses durch Krankheit v. a. eine Frage der individuellen und subjektiven Bewertung der Situation, und die Zielrichtung des Copings besteht in der Belastungsreduktion. In Anwendung auf die chronischen Krankheiten wird die Bedeutung der »Ereignisaufschichtungen« durch den komplexen und variablen Krankheitsprozess betont (Schaeffer 2009, S. 29 f.). Es muss danach zwischen verschiedenen negativen Stressoren durch die chronische Störung unterschieden werden, den alltäglichen, den chronischen und den kritischen Ereignissen. Auch für sie gilt, dass sie sich in subjektiven Krankheitsvorstellungen niederschlagen, denen als kognitiven Repräsentationen insbesondere für die Art möglicher Interventionen von innen und außen zentrale Bedeutung zukommt.
Der gesellschaftstheoretische Ansatz schließlich betrachtet chronische Krankheit unter dem Aspekt sozialer Veränderungen. Im Rahmen der modernen Risikogesellschaft hat der Einzelne demnach erheblich an Freiheit, aber eben auch an Verantwortung gewonnen. Das »frei gesetzte Individuum« muss sich seine eigene Normalität schaffen. Der chronisch Kranke muss sich analog selbst »managen«. Das »persönliche Budget« der Sozialgesetzgebung findet sich z. B. hier wieder. Kritischen Widerspruch findet dieser Standpunkt in der sozialepidemiologischen Ungleichheitstheorie, auf die an anderer Stelle im Buch ausführlicher eingegangen wird (
Kap. 1.7). Diese betont die sozial-strukturellen Determinanten, zu denen z. B. gehört, dass untere soziale Schichten durch eine höhere Krankheitslast und eine reduzierte Lebenserwartung, durch einen relativen Ressourcenmangel und vermehrte gesundheitliche Risikoverkettungen gekennzeichnet sind, sodass nicht von einer vollkommen zufälligen Verteilung von Potenzialen und Ressourcen ausgegangen werden kann. Deshalb, so lautet die Konsequenz, muss auch die Bewältigung chronischer Krankheit immer individuumsorientiert und gleichzeitig strukturorientiert sein.
In einer aktuellen Bewertung der Situation kommt Schaeffer zu der Einschätzung, dass die vergangenen 30 Jahre für diese Debatte verlorene Jahre waren. Trotz intensiver Forschungen sei es bei einem theoretischen »Flickenteppich« geblieben: Aspekten wie der Patientenperspektive oder dem Langzeitverlauf chronischer Krankheit werde kaum Beachtung geschenkt, generalisierende Meta-Studien fehlen ebenso wie Vorschläge zur Integration der sich ja z. T. ohnehin überschneidenden Theorien. Auch bilde die Diskussion kaum ab, dass es in den letzten Jahrzehnten zu einem massiven Wandel im Bereich chronischer Krankheiten gekommen sei. Viele früher tödlich verlaufende Erkrankungen wie Mukoviszidose, HIV-Infektion oder Karzinomerkrankungen verlaufen heute chronisch progredient oder lassen sich mit bleibenden Einschränkungen heilen, was zu neuen Formen der »sick role« führe. Dadurch ergeben sich Notwendigkeiten, Lebenslauf- und Krankheitsbewältigungs-Theorien miteinander zu verknüpfen. Und auch im Spektrum der Interventionen und Unterstützungsbedarfe und -möglichkeiten ergeben sich daraus neue Fragen und Antworten.
1.2 Menschenbilder
Wer in der Rehabilitation arbeitet, muss sich im Zusammenhang mit dem Fachgebiet Gedanken über das eigene Menschenbild, über das die Reha tragende Menschenbild und über sein Rollenverständnis machen. Diese Thematik der medizinischen oder ärztlichen Anthropologie beschreibt Hahn (1988, S. XIII) folgendermaßen:
»Die Frage nach […] den Eigenarten, Möglichkeiten und Grenzen des Menschen in einem weiteren Sinne schließt auch für den Arzt die Reflexion der genannten und ungenannten Voraussetzungen ein, die den sozialen Stellenwert des ärztlichen Denkens und Handelns ausmachen.«
Kaum ein Lehrbuch bezieht solche Inhalte heute noch in Betracht. Unsere Leitbilder sind heute weitgehend auf die Begriffe Patienten- (gleich Kunden-...