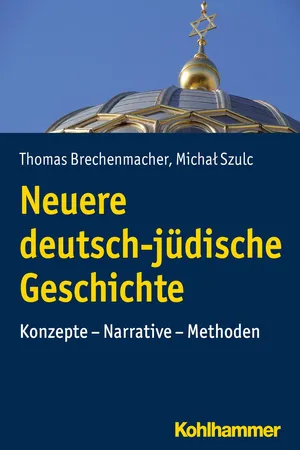
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Neuere deutsch-jüdische Geschichte
Konzepte - Narrative - Methoden
- 277 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
About this book
This volume provides an introduction to modern German&Jewish history, from the late Middle Ages to the twentieth century, using analytical categories such as?migration=, ?inclusion/exclusion=, ?assimilation/acculturation=. The emphasis is less on offering a chronological narrative than on issues that are currently being examined in current research on German&Jewish history. Two chapters on historiographic narratives and methods of research round off the volume, along with a comprehensive bibliography on modern German&Jewish history. The book is intended for everyone wishing to familiarize themselves with the topic alongside academic courses, or in independent study.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Neuere deutsch-jüdische Geschichte by Thomas Brechenmacher, Michal Szulc in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & Modern History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1
Die Räume und Themen der deutsch-jüdischen Geschichte
Epochen und Grenzen
Forschung und Lehre zur deutsch-jüdischen Geschichte1 überschreiten die etablierten Disziplinengrenzen des historischen Fachs: Mittelalter, Frühe Neuzeit, Neuere Geschichte, Neueste Geschichte und Zeitgeschichte, Osteuropäische Geschichte. Diese Einteilung ist zweifellos sinnvoll unter Aspekten der Methoden und spezifischer Kompetenzen, etwa paläographischer oder sprachlicher Kenntnisse. Allerdings verstellt eine zu kleinteilige fachliche Segmentierung den Blick auf die langen Zeiträume, auf die größeren Zusammenhänge und tieferliegenden Strukturen. Auf keinen Fall kann deutsch-jüdische Geschichte in den engen Grenzen einer Nationalgeschichte abgehandelt werden, wenngleich das Kaiserreich von 1871 oder die Weimarer Republik ohne Zweifel Phasen eines verdichteten und besonders intensiven jüdischen Lebens in Deutschland definieren. Doch ebensosehr müssen (mindestens) die deutschsprachigen Teile des Habsburgerstaates miteinbezogen werden, aber auch böhmische, mährische und ungarische Länder und diejenigen Teile Polens, die 1772 und 1795 an Österreich fielen. Gleiches gilt für Preußen: einige jüdische Familien wurden 1671 durch Kurfürst Friedrich Wilhelm in der Mark Brandenburg zugelassen. Für den quantitativen Zuwachs der jüdischen Bevölkerung Preußens waren aber die Annexionen des 18. Jahrhunderts (Schlesien, polnische Teilungen) ungleich bedeutender; die größte jüdische Bevölkerungsdichte (6,4 %) wies Preußen im Großherzogtum Posen, der späteren Provinz Posen, auf. Im Westen hingegen markiert der Verlauf des Rheins alte jüdische Siedlungsgebiete, deren politische Zugehörigkeit oftmals wechselte; am Beispiel Elsass-Lothringens mit seinem signifikanten jüdischen Bevölkerungsanteil wird dies besonders deutlich.
Das Alte Reich, die Übergangsformen der »Franzosenzeit« mit dem Königreich Westphalen und dem Großherzogtum Berg, mit Rheinbund und Großherzogtum Warschau, der Deutsche und Norddeutsche Bund, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie, das Deutsche Kaiserreich, deren Nachfolgestaaten nach 1918 sowie schließlich das nationalsozialistische »Dritte« und dann »Großdeutsche Reich« mit den ihm seit 1939 unterworfenen europäischen Gebieten markieren die politischen Räume, in denen sich deutsch-jüdische Geschichte abspielte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommen die Bundesrepublik Deutschland und die DDR als Staatenräume einer sich langsam erneuernden deutsch-jüdischen Geschichte hinzu. Diese steht in steter Verflechtung mit der europäisch-jüdischen Geschichte. Sie entfaltet sich in wechselnden Zentren und von den Peripherien her, in unterschiedlich akzentuiertem Austausch und variierenden Zuordnungen. Dieses Wechselspiel lässt sich abbilden unter dem Begriff der Migration, denn Wanderungsströme prägen die Geschichte der jüdischen Minderheit in Europa, und speziell über Mitteleuropa hinweg auf besondere Weise.
Räume, Migration, Siedlungsformen
Die Frage nach den geographischen und politischen Räumen der deutsch-jüdischen Geschichte fordert geradezu eine überepochale Betrachtungsweise. Vor allem der deutsch-jüdische Soziologe Werner Jacob Cahnman(n) hat in seinen Studien die Augen für das geographisch-räumliche Bild der deutsch-jüdischen Geschichte geöffnet.2 Cahnman unterschied zwei sehr unterschiedlich geprägte geographische Räume, in denen sich zunächst eine ältere, »rheinisch-französisch« akzentuierte deutsch-jüdische Geschichte entfaltet habe, von der eine jüngere, um 1648 beginnende deutsch-polnische Phase zu unterscheiden sei. Vom Mittelalter zur Neuzeit hin habe sich das Gewicht, diesem Modell folgend, von West nach Ost verlagert. Zum 19. Jahrhundert hin bildete die »Ost-Schiene« dann ihrerseits je einen Nord-Ost- und einen Süd-Ost-Schwerpunkt aus. Als große Zentren jener Schwerpunkte können Frankfurt am Main stellvertretend für die Tradition des deutsch-jüdischen Westens, Hamburg und Berlin für einen hochdeutsch-jüdischen Nordosten sowie Wien und Prag für einen stärker jiddisch geprägten Südosten stehen.3
Dieser idealtypisch gezeichnete geographische Raum wird feingegliedert durch die jeweils bevorzugten Siedlungsformen deutscher Juden, die sich ihrerseits, wiederum bestimmten Entwicklungslinien der longue durée folgend, als epochenspezifisch prägend kennzeichnen lassen: groß- bzw. reichsstädtisch – kleinstädtisch – ländlich und wiederum ländlich/kleinstädtisch – groß- bzw. residenz- und handelsstädtisch, schließlich metropolitan. Migrationsströme und die damit verbundenen fundamentalen Veränderungen der Siedlungsschwerpunkte können als Indikatoren für epochale Umbrüche in der Geschichte der deutschen und europäischen Juden gelten.
Migrationsströme stehen auch am Beginn der Herausbildung der beiden Großgruppen des europäisch-mittelmeerischen Judentums seit der Spätantike: Sepharden und Aschkenasen. Beide Gruppen unterscheiden sich im religiösen und kulturellen Habitus, der wiederum abhängig ist von den Erfahrungen in den jeweiligen Mehrheitsgesellschaften, mit allen Konsequenzen für Rechtsstellung, Sozial- und Berufsstruktur. Ökonomische, soziale und Fragen des rechtlichen Status der Minderheit entwickeln sich ihrerseits zu Push- und Pull-Faktoren für Migration. Das gilt für Mittelalter wie Neuzeit: in welchen sozialen und Rechtsräumen werden Juden geduldet, mit welchem Status? Welche Räume bieten sich zu welchem Zeitpunkt als Räume der Aufnahme an, zu welchen Bedingungen? Dies sind ins Räumliche gewendete Aspekte des schlechthin zentralen Themas der Inklusion und Exklusion.
Inklusion und Exklusion
Deutsch-jüdische (und cum grano salis europäisch-jüdische) Geschichte ist die Geschichte einer diskontinuierlichen Inklusion, die phasenweise und unter ständiger Gegenwirkung desintegrativer Kräfte zu gelingen schien, zuletzt jedoch auf gewalttätigste Weise negiert wurde. Sie steht in unablösbarem Zusammenhang mit der Gewaltgeschichte des Christentums einerseits und mit der alles andere als »unbefleckten« Geschichte der europäischen Modernisierung andererseits, ihren jeweiligen Rückschlägen und ihrem schließlichen, abyssischen Ausbruch absoluter Zivilisationsferne im 20. Jahrhundert als der dunklen, ins Nationalistische und schließlich Deterministisch-rassistische gekehrten Seite der rationalistischen Fortschrittsideologie der Epoche.
Die Variationen des großen Inklusionsthemas mit seinem steten Kontrapunkt der ausschließenden (exkludierenden) Bewegungen lassen sich für die deutsch-jüdische Geschichte der Neuzeit gleichfalls geographisch-räumlich und zeit-räumlich bestimmen. Das ältere kaiserliche Schutzjudentum wurde mediatisiert und zur Frühen Neuzeit hin neu definiert, so dass, zumal in den neuen höfisch-absolutistischen Herrschaftskomplexen seit dem 17. Jahrhundert, zahlreiche Formen von Privilegierungen entstanden (Hofjuden, Generalprivilegierte, etc.). Diese Rechte waren funktional, von den Herrschern ad personam zugeteilt, um nicht zu sagen, verkauft worden. Aber sie konnten in einen Modernisierungsdiskurs Eingang finden, der zunehmend nach dem »Wert« aller für das »gute« Staatswesen fragte und, von Einzelverhältnissen abstrahierend, an Homogenisierung interessiert war. Hier war der Weg vom »nützlichen Untertanen« zum Staatsbürger vorgezeichnet, und gerade für die Angehörigen der jüdischen Minderheit sollte definiert werden, unter welchen Voraussetzungen ihre »bürgerliche Verbesserung« erreicht und mit welchen Statusgewinnen dieser Schritt belohnt werden konnte. Überlegungen dieser Art gingen von den aufgeklärt-absolutistischen Staaten aus, das spät-friderizianische Preußen sowie das josephinische Reform-Österreich an ihrer Spitze. Quer dazu lief die in Europa durch die Französische Revolution von 1789 befeuerte Idee des allgemeinen Menschenrechts mit der Forderung nach gleichem, voraussetzungslosem und unverzüglich zu gewährenden Staatsbürgerrecht für alle. Diese Idee wurde, ausgehend von Frankreich, in die Zerfallsstaaten des Alten Reichs und in die Neugründungen exportiert sowie in unterschiedlichem Maße in Edikten gesetzgeberisch fixiert. Geleitet wurde diese »Sattelzeit« von etwa 1750 ab durch das Motiv der »Aufklärung«, das Paradigma der Vernunft, das auch den innerjüdischen Reformdiskurs (haskala) bestimmte. Den jüdischen Reformern ging es darum, den Anschluss an den wissenschaftlichen Geist der Zeit zu gewinnen, wiederum als Voraussetzung einer gelingenden Inklusion in die Mehrheitsgesellschaft. Auch die Religiosität blieb vom Reformgedanken keineswegs unberührt, mit der Konsequenz einer Konfessionalisierung des Judentums im Laufe des 19. Jahrhunderts, die sich am Grad der jeweiligen Historisierung des religiösen Gesetzes, der Verwissenschaftlichung des Nachdenkens über jüdische Religion im Sinne einer »Theologie« sowie der homogenisierenden Einordnung in staatlich vorgegebene Räume religöser Betätigung bemaß.
Mit der Reorganisation und Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress brachte dieses Jahrhundert zunächst Rückschläge für die Bestrebungen nach Inklusion der Juden. Einheitliche Regelungen konnten für das Gebiet des neugegründeten Deutschen Bundes nicht erzielt werden, und so entstand in der Folgezeit eine höchst ausdifferenzierte »Integrationslandschaft« mit unterschiedlichsten Graden rechtlicher Gleichstellung sogar innerhalb einzelner Staaten des Bundes, wie beispielsweise in Preußen. Die Bürokratien verhielten sich zögernd, während die ideologische Gegenströmung, angefacht durch teils bereits rassistisch untersetzte Nationalismen die Möglichkeit einer gelingenden Inklusion der Juden in die Mehrheitsgesellschaft bestritt und erbittert bekämpfte. Soziale Krisen befeuerten ihrerseits eine sozioökonomisch motivierte Judenfeindschaft, die phasenweise, zumal in Verbindung mit den Revolutionen von 1830 und 1848/49 zu Ausbrüchen von Gewalt gegen Juden führte. Auf der anderen Seite versuchten jüdische wie nichtjüdische Vertreter eines liberal-bürgerlichen Freiheitsdenkens – etwa in den Debatten der Frankfurter Nationalversammlung – die emanzipatorische Idee einer bedingungslosen rechtlichen Gleichstellung der Juden zu verwirklichen. Als Preis dafür wurde – gleichfalls in unterschiedlichsten Dosierungen – eine Anpassung an den kulturellen Habitus der Mehrheitsgesellschaft angesehen oder gefordert, sowohl seitens jüdischer als auch nichtjüdischer Akteure. Die religiöse Reform stellte die theologische Variante dieses Prozesses der »Verbürgerlichung« dar; auf der säkularen Seite entsprachen ihm zahlreiche Spielarten der »Assimilation« (völlige Aufgabe der jüdischen Identifikation) und Akkulturation (Mischformen jüdischer und nichtjüdischer Identitätskonstruktionen). Sie reichen von Konversion, Gemeindeaustritt und Mischehe bis hin zu lediglich äußerlicher Angleichung an die Stile der Mehrheitsgesellschaft unter privater Beibehaltung des jüdisch-kulturellen und -religiösen Habitus. Die Vertreter einer »Wissenschaft des Judentums« versuchten demgegenüber einen innerjüdischen, nicht primär religiösen Modernitätsstandpunkt zu entwickeln, um das Ziel der Haskala weiterzuverfolgen, nämlich Juden als Juden auf geistige Augenhöhe mit den nichtjüdischen Repräsentanten der Wissenschaft als des Leitparadigmas der Zeit zu führen und derart ihre Inklusionsfähigkeit zu beweisen.
Die völlige und voraussetzungslose rechtliche Gleichstellung der Juden qua Gesetz wurde mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 für den kleindeutschen Nationalstaat sowie mit der Verfassung von 1867 für die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie erreicht. Der durchschnittliche jüdische Bevölkerungsanteil betrug in jenen Jahren in Deutschland maximal 1,25 % (1871: 512 000), in Deutsch-Österreich um 1 % (1869: 59 500, davon die weitaus meisten in Wien). Keineswegs war für diese kleine, aber stark innovative und zu hohen Graden akkulturationsbereite Gruppe der Weg zur Inklusion damit abgeschlossen. Juden konnten vielfach überdurchschnittliche soziale Aufstiege vorweisen, zumal in Handel, Gewerbe, Industrie und den Freien Berufen. Die Chancen, die der ökonomische und technologische Wandel vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bot, hatten viele Juden genutzt – wiederum auch durch Migration, jetzt in die pulsierend expandierenden neuen Großstädte. Doch fast in gleichem Maße provozierte dieser Erfolg neue exklusorische Gegenströmungen. Die große Wirtschaftskrise der 1870er Jahre (»Gründerkrach«) begünstigte eine Reihe von judenfeindlichen Agitatoren, Initiativen, Gruppen, bald auch Parteien, denen es zwar nicht gelang, die gesetzlich gewährte rechtliche Gleichstellung der Juden zu revidieren, deren »Erfolg« auf die Dauer jedoch darin bestand, die Mehrheitsgesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen mit einer latenten Judenfeindlichkeit zu durchsetzen. Als besonders tückisch erwies sich dabei eine ideologische Melange aus sozioökonomischem Ressentiment gegen die vermeintlichen »Gewinner« der industriellen Modernisierung, pseudo-wissenschaftlich verkleidetem, sozialdarwinistische Modetheorien der Zeit nutzenden Rassenantisemitismus und nationalem Chauvinismus, in dem nationale Machtphantasien und rassistisch begründete Homogenitätsideen ineinander verschmolzen.
Die Integration der sich in ihrer Mehrheit »deutsch« fühlenden bürgerlichen Juden war durch diese exklusorischen Strömungen massiv gefährdet. Gerade Schlüsselmarkierungen der bürgerlich-nationalen Identifikation (»einjährig-freiwilliges« Reserveoffizierspatent, weitergehende Karrieren im Militär, in den höheren öffentlichen Ämtern, insbesondere als ordentliche Universitätsprofessoren, Mitgliedschaft in Studentenverbindungen und Standesorganisationen) wurden jüdischen Lebensläufen systematisch vorenthalten. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die antisemitischen Agitatoren seit dem Beginn der 1880er Jahre, als eine erneute Migrationswelle – diesmal aus dem sogenannten »Ansiedlungsrayon« im Westen des Zarenreichs – die Struktur der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und Österreich fundamental veränderte. Die nicht auf bloße Durchwanderung begrenzte Massenmigration sogenannter »Ostjuden« mit völlig anderem sozialen und kulturellen Hintergrund forderte auch die alteingesessenen deutschen Juden heraus, trieb vor allem jedoch die antisemitische Agitationsspirale weiter an; gegen die »Ostjuden« als »minderwertige Elemente« russischer und polnischer Herkunft ließ sich trefflich polemisieren.
Schließlich führte der Erste Weltkrieg zu einem neuen Tiefpunkt in der Auseinandersetzung um die Stellung der deutschen Juden. Galt für unzählige Juden der Dienst in den deutschen Armeen als letzter und endgültiger Nachweis ihres uneingeschränkten und unbedingt opferbereiten »Deutschtums«, so verstand es wiederum die antisemitische Agitation, die Stimmung zu drehen. Das vaterländische Engagement der Juden wurde diskreditiert und durch propagandistische Verdikte über vermeintliche »Kriegsgewinnlerei« und »Drückebergerei« konterkariert. Dass sich das Preußische Kriegsministerium 1916 dazu hinreissen ließ, eine »Judenzählung« im Heer zu veranlassen, ließ die Agitatoren triumphieren und erschütterte das Vertrauen der Juden nachhaltig. Bereits durch die zionistische Bewegung war seit dem späteren 19. Jahrhundert im innerjüdischen Diskurs die Möglichkeit des Gelingens einer Inklusion auf Basis der Akkulturation radikal bestritten worden. Diesem Modell stellten die Zionisten die Alternative einer nationalen und kulturellen Selbstbesinnung des Judentums entgegen, die – in einer letzten und endgültigen großen Migrationsbewegung – in die Gründung eines eigenen jüdischen Staates, vorzugsweise in Palästina, münden sollte. Unter den bürgerlichen deutschen Juden fand der zionistische Gedanke Sympathisanten, jedoch nur wenige aktive Anhänger. Zur Auswanderung und zur Übernahme eines neuen, stark agrar-sozialistisch-kollektivistisch akzentuierten, gegenbürgerlichen Lebensstils in einem zu kolonisierenden Palästina ließen sich vorwiegend Angehörige der jüngeren Generationen motivieren.
Gleichwohl veränderte sich über die Schwelle des Weltkriegs hinweg auch das Gesicht des deutschen Judentums. Durch anhaltende Zuwanderung aus dem Osten hatten sich, zumal in großen Städten wie Wien und Berlin, neue Viertel mit starken russisch-polnisch-jüdischen Bevölkerungsanteilen herausgebildet. Auf der anderen Seite hatte der verstärkte Kontakt jüdischer Intellektueller mit ostjüdischer Kultur und Religiosität, etwa mit dem mystisch akzentuierten Chassidismus, das Interesse für ein »ursprünglicheres« Judentum geweckt, das sich nicht in Akkulturationsschüben der Selbstauflösung näherbringe, sondern vielmehr der eigenen kulturellen Identität besinne. Diese »jüdische Renaissance«, programmatisch vorangetrieben etwa von Denkern wie Martin Buber, blieb nicht frei von Versatzstücken des zeitgeistigen völkischen Denkens.
Die Jahre der Weimarer Republik zeigen sich als Jahre der Polarisierung. Kunst, Kultur, aber auch Wissenschaft der 1920er Jahre sind von den Leistungen jüdischer Intellektueller bedeutsam geprägt. Auf der anderen Seite tobte ein immer gewaltbereiterer Antisemitismus, dessen Publikum sich vor allem aus Anhängern politisch-ideologischer Fanatismen sowie Angehörigen sozialer Grenzschichten speiste: den durch den Weltkrieg Entwurzelten, den vom »Versailler Schanddiktat« bitter Enttäuschten, den von den ökonomischen Krisen dieser »ersten Nachkriegszeit« Radikalisierten. Juden zu Sündenböcken für all diese unerklärlich scheinenden Umbrüche zu stempeln, war vereinfachend genug, um agitatorische und terroristische Energien freiz...
Table of contents
- Deckblatt
- Titelseite
- Copyright
- Inhalt
- Vorwort
- 1 Die Räume und Themen der deutsch-jüdischen Geschichte
- 2 Kategorien und Konzepte
- 3 Theorien, Narrative und Interpretationen
- 4 Methoden
- 5 Schluss: Wozu deutsch-jüdische Geschichte?
- 6 Bibliographischer Leitfaden zur neueren deutsch-jüdischen Geschichte
- Anmerkungen
- Register