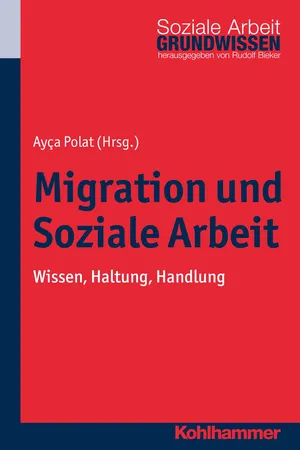![]()
TEIL III HANDLUNGSKOMPETENZEN: HANDLUNGSZIELE UND METHODISCHE ANSÄTZE
Was Sie in diesem Abschnitt lernen können
Handlungs- und Methodenwissen gehören für die unmittelbare Zusammenarbeit mit Adressat*innen zu den Kernkompetenzen von Fachkräften. Gemeint sind damit Grundfertigkeiten des methodischen Handelns. Diese müssen arbeitsfeldspezifisch sein und sich aus den Wissens- und Haltungskompetenzen ableiten lassen bzw. damit im engen Zusammenhang stehen.
Dieser Abschnitt beschäftigt sich daher mit den folgenden Fragen:
1. Welche Handlungsziele und methodischen Ansätze lassen sich aus den in den Abschnitten I und II formulierten Erkenntnissen für die Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft ableiten?
2. Welche Handlungsansätze und Methoden haben sich in der sozialen und pädagogischen Arbeit in der Migrationsgesellschaft bewährt?
3. Wie und wodurch kann den spezifischen Anforderungen entsprochen werden? Welche Beispiele gibt es hierfür?
Dazu werden neben Ansätzen aus Deutschland auch Projekte aus dem Ausland vorgestellt. Hierbei handelt es sich zum einen um den Beitrag von Mohammed Baobaid aus Kanada, der am Beispiel der Arbeit des Muslim Resource Centre for Social Support and Integration auf die Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen in der Familienhilfe eingeht. Zum anderen geht es um sozialraumorientierte Ansätze der Gesundheitsförderung in der Stadt Groningen, die in dem Beitrag von Han Stoffer und Ben Boog vorgestellt werden.
Da eine Berücksichtigung aller relevanten Arbeitsbereiche der sozialen und pädagogischen Arbeit den Umfang dieses Bandes sprengen würde, wird exemplarisch auf die Arbeit mit den folgenden Zielgruppen eingegangen:
• Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte,
• Familien mit Migrationsgeschichte,
• ältere Menschen mit Migrationsgeschichte,
• geflüchtete Menschen.
Die Zielgruppe der geflüchteten Menschen wird in diesem Abschnitt ausführlicher behandelt, da die Arbeit mit ihnen in der Praxis eine immer relevantere Rolle spielt und zugleich bei vielen Institutionen und Fachkräften ein hoher Bedarf an Wissens- und Handlungskompetenzen wahrnehmbar ist.
![]()
DIVERSITÄTSBEWUSSTE ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN
1 Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung mit jungen Kindern
Petra Wagner
In der Frühpädagogik werden Bildungsprozesse als subjektive Aneignungstätigkeiten verstanden, mit denen sich ein Kind von Geburt an ein Bild von der Welt macht (vgl. Berliner Bildungsprogramm 2014, S. 13). Diese Weltentdeckungen verweisen auf die individuellen Eigenaktivitäten eines jeden Kindes wie auch auf ihre gesellschaftliche Einbettung. Je nach sozialem Kontext unterscheiden sich Erfahrungsmöglichkeiten der jungen Kinder und auch die Informationen, die sich ihnen zutragen und aus denen sie ihr Weltwissen konstruieren. Dabei gewinnen Kinder nicht nur ihr Bild davon, nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Welt funktioniert, sondern auch ihr Bild von sich selbst und ihre Bilder von anderen Menschen. Die Verarbeitungen junger Kinder zeigen ihre Auseinandersetzung mit soziokultureller Diversität und deren gesellschaftlicher Bewertung. In der Migrationsgesellschaft beziehen sich die Bewertungen auf das, was Eingewanderten zugeschrieben wird: phänotypische Merkmale, Religion, Sprache(n), Familienkonstellation, Familienkultur. Für Kinder verbinden sich diese Zuschreibungen und Bewertungen mit anderen, entlang weiterer Differenzlinien wie Geschlecht, Behinderung, sozioökonomischem Status etc. gebildeten und beeinflussen ihre Bildungsprozesse.
1.1 Hintergrund und Begriffsbestimmungen
Soziokulturelle Diversität und Dominanzkultur
Menschen unterscheiden sich also nicht nur individuell, sondern auch nach Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen und kulturellen Wertesystemen. Ihre sozialen Bezugsgruppen sind diejenigen, deren kulturelle Wertesysteme sie teilen. Die soziokulturellen Unterschiede stehen nicht gleichberechtigt nebeneinander. Sie unterliegen Bewertungen, die gesellschaftliche Hierarchien stützen.
In den Selbstbildern von Kindern und in ihren Vorstellungen über andere Menschen zeigt sich, dass sie auf die gesellschaftliche Realitäten Bezug nehmen, deutlich in Äußerungen bereits ab dem dritten Lebensjahr (siehe Beispiele):
• „Behinderte sind wie Babys, die können nicht sprechen, nicht laufen.“
• „Frauen können keine Bestimmer sein, Männer sind Bestimmer!“
• „Du kommst nicht in die Vorschule, du kannst kein Deutsch!“
• „Jamaya ist braun, sie kann nicht Dornröschen sein!“
• „Zwei Männer können nicht heiraten, nur ein Mann und eine Frau.“
Kinder nehmen Bewertungen entlang bestimmter Identitätsmerkmale vor und verweisen darauf beim Aushandeln von Spielinteressen und bei ihren Präferenzen für Spielpartner*innen. Differenzlinien, auf die sie Bezug nehmen, überschneiden sich: Sie argumentieren als Junge oder Mädchen, mit oder ohne Migrationshintergrund, nehmen Bezug auf Alter, Sprache, Behinderung, auch auf Religion, Familienkonstellationen, später im Grundschulalter auch verstärkt auf sozioökonomische Unterschiede der Familien und sexuelle Orientierung.
Das gesellschaftliche Wissen, das Kinder bereits in frühen Jahren zeigen, ist ein Wissen um die in ihrer Lebenswirklichkeit vorherrschende Dominanzkultur, in die sie sich selbst und andere einordnen. Dominanzkultur bedeutet, „dass unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen sowie die Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind“ (Rommelspacher 1995, S. 22). Über- und Unterordnung, Höherbewertung und Geringschätzung, viel oder wenig Einfluss sind Informationen über soziale Bezugsgruppen in der Gesellschaft, die Kinder in frühesten Jahren tangieren. Es sind Informationen, mit denen sie bereits in den Kindergarten kommen und die sie im Weiteren im Kindergarten und in anderen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen aufnehmen.
Louise Derman-Sparks, die Mitbegründerin des Anti-Bias-Approach, eines Ansatzes gegen Diskriminierung für Kinder ab zwei Jahren, spricht von „Vor-Vorurteilen“ (pre-prejudices), die Kinder aus den bewertenden Botschaften ihrer Umgebung eigensinnig und kreativ entwickeln. Vor-Vorurteile sind deshalb relevant für Bildungsprozesse, weil sie gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen festigen, die für Kinder und ihre Familien mit Privilegien oder Benachteiligungen verbunden sind.
Vorurteile junger Kinder
Kinder lernen aktiv und beobachten aufmerksam, was sich um sie herum ereignet. Gerade Unterschiede zwischen Menschen machen sie neugierig, und sie haben früh ihre eigenen Theorien darüber, wie solche Unterschiede entstehen. Sie verarbeiten dabei unmittelbare Vorurteile genauso wie subtile Mitteilungen. Sichtbares und Unsichtbares gibt ihnen Aufschluss darüber, wie wichtig etwas oder jemand ist. Die Quellen sind vielfältig: die Werbung, die Konsumwelt, Bilderbücher, Filme, Aufdrucke auf T-Shirts und Caps, Nachrichten, Zeitschriften, Diskurse in ihrem Umfeld. Kinder konstruieren aus all diesen Quellen Vorurteile über Gruppen von Menschen, noch bevor sie jemanden von ihnen kennengelernt haben: „Man lernt Vorurteile aus dem Kontakt mit den vorherrschenden Einstellungen in einer Gesellschaft, nicht aus dem Kontakt mit Einzelnen“ (Derman-Sparks 1998, S. 6).
In einer Meta-Analyse von internationalen Untersuchungen zur Vorurteilsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen (im Hinblick auf Hautfarbe, Ethnie, Nationalität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Geschlecht, Alter und Körperform) zeigt Raabe (2010), dass die Vorurteilsentwicklung in Bezug auf Hautfarbe und Ethnie nach dem sozialen Status der Kinder unterschieden werden muss. So nehmen z. B. bei weißen Kindern Vorurteile gegenüber Schwarzen ab zwei Jahren zu, erreichen mit sieben Jahren einen Höhepunkt und gehen danach zurück, sofern es Kontakte zu Schwarzen Kindern gab. Schwarze Kinder zeigen ab zwei Jahren zunächst keine negativen Vorurteile, sondern sogar eine Bevorzugung der statushöheren Gruppe der Weißen und erst ab acht bis zehn Jahren negative Vorurteile (Raabe 2010, S. 147).
Ähnliches zeigte sich auch in Bezug auf andere ethnische Majoritäts-/Minoritätsverhältnisse, z. B. mit amerikanischen und australischen Ureinwohner*innen als statusniedrigeren Gruppen (ebd., S. 63). Während Kontakte mit Kindern der statusniedrigeren Gruppe bei Kindern der statushöheren Gruppe zu einer Verminderung von Vorurteilen führte, war dies umgekehrt bei Kindern der statusniedrigen Gruppe nicht der Fall. In einer Längsschnittstudie zeigte sich sogar, dass mit den Kontaktmöglichkeiten zu Weißen die Vorurteile der schwarzen Kinder zunahmen (Raabe 2010, S. 155). Eine Erklärung ist, dass Kinder sozialer Minoritäten in von der Majorität dominierten Gesellschaften aufwachsen und sich früh als Mitglieder der von der Majorität dominierten Gesellschaft wahrnehmen. Eine andere Erklärung zieht die Beobachtung heran, dass sich junge Kinder noch nicht sicher einer Bezugsgruppe zuordnen können und in der Präferenz für die statushohe Gruppe zum Ausdruck bringen, dass sie Kenntnis über die soziale Wertigkeit der dominanten Gruppe haben, der sie angehören wollen (ebd., S. 64).
Vorurteile
„Vorurteile sind negative Orientierungen gegenüber Individuen oder Gruppen von Individuen, aufgrund deren Gruppenzugehörigkeit. Sie zeigen sich in der Zuschreibung negativer Eigenschaften, in negativen Empfindungen und in ablehnenden Verhaltensweisen.“ (Ebd., S. 17)
Vorurteile der Kinder sind Schlussfolgerungen aus sozialen Ungleichheiten und Informationen darüber, welchen Gruppen von Menschen welcher Platz im gesellschaftlichen Gefüge zugedacht ist. Die Auswirkungen dieser Bewertungen unterscheiden sich danach, welcher sozialen Gruppe ein Kind angehört. Ob Bestätigung als Kind der statushöheren Majorität oder Abwertung als Kind der statusniedrigeren Minorität – die Botschaften spielen eine wichtige Rolle bei der Identitätsentwicklung von Kindern und beeinflussen ihre Möglichkeiten, lernend auf die Welt zuzugehen.
Vorurteile als soziale Konstruktionen
Bewertende Botschaften in den Vorurteilen über Gruppen von Menschen sind kein Abbild tatsächlicher Differenzen, sondern gesellschaftlich ‚gemacht‘. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Menschen, in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, soziale Klasse, körperliche Fähigkeiten, Behinderungen, sexuelle Orientierung usw. Entscheidend ist die Verknüpfung der Unterschiede mit Verallgemeinerungen und Unterstellungen, mit denen gleichzeitig die gesellschaftliche Ungleichheit und damit die Benachteiligung bestimmter Gruppen ‚erklärt‘ werden. Dabei sind nicht die Unterschiede zwischen Menschen die Ursachen der Ungleichheit, es ist umgekehrt: Die Bezugnahme auf Unterschiede fungiert als effektive und machtvolle Rechtfertigung für den ungleichen Zugang von Menschen und Gruppen zu gesellschaftlichen Ressourcen und Positionen. Sie wird gestützt von diskriminierenden Ideologien wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Adultismus, Heteronormativität usw., die jeweils die Höherwertigkeit der einen vor der anderen Gruppe behaupten.
Vorurteile und Bildungsbenachteiligung
Kinder wachsen in einem spezifischen soziokulturellen Kontext auf, der zunächst geprägt ist von ihrer Familienkultur. Was das Kind hier erfährt, bildet für seine ersten Lebensjahre den Horizont seines Denkens, Fühlens und Handelns. Es ist das, was ihm selbstverständlich und ‚normal‘ erscheint. Auch in der existenziellen Angewiesenheit auf seine Familie liegt seine Identifikation mit ihr als erste soziale Bezugsgruppe begründet. Ein junges Kind kann nicht anders, als seiner Familie zugehörig und verbunden zu sein.
Familienkultur
Familienkultur wird verstanden als das jeweils einzigartige Mosaik von Gewohnheiten, Deutungsmustern, Traditionen und Perspektiven einer Familie, in das auch ihre Erfahrungen mit Herkunft, Sprache(n), Behinderungen, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, sozialer Klasse, mit Ortswechsel, mit Diskriminierung oder Privilegierung eingehen.
Bestätigt die institutionelle Kultur einer Kita die gesellschaftlich dominanten Wertsetzungen, so trägt sie dazu bei, dass Kinder früh Vor- oder Nachteile aus ihren sozialen Identitäten ziehen. Kinder, deren Familienkulturen viel Übereinstimmung mit der institutionellen Kultur aufzeigen, können in der Regel einfach auf die Bildungsgelegenheiten zugreifen, die ihnen die Kita bietet, wohingegen sich Kindern Barrieren auftun können, die nichts Vertrautes vorfinden und zusätzlich verunsichert oder entmutigt sind, weil ihre Familienkultur nicht vorkommt oder abgewertet wird.
Studien belegen, dass in Deutschland der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in hohem Maße von ihrer sozialen Herkunft abhängig ist: Kinder aus armen und eingewanderten Familien sind besonders benachteiligt und erleben alltägliche und strukturelle Diskriminierung (siehe Bertelsmann Stiftung 2013). Aus der ‚Vielfalt‘ der Lebensverhältnisse werden für einen Teil der Kinder Bildungs-Hindern...