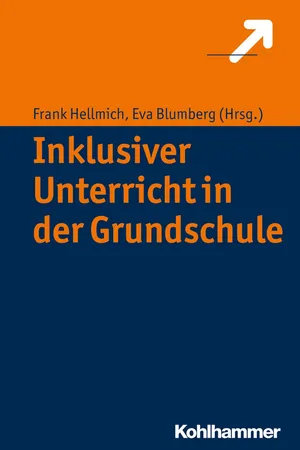![]()
I Inklusives Lernen aus grundschul- und förderpädagogischer Perspektive
![]()
Eckpunkte für die Entwicklung inklusiven Unterrichts
Ursula Carle
Inklusiver Unterricht braucht die ganze Schule als unterstützenden Kontext, da er stark auf demokratische Werte und gelingende Beziehungen angewiesen ist. Es handelt sich also um weitaus mehr als nur um eine unterrichtsmethodische Umstellung. Inklusion – verstanden als Menschenrecht – erfordert einen grundsätzlich anderen Umgang miteinander und damit auch mit den Lerninhalten, -zielen und -bewertungen als es bisher durch das stark auf Selektion ausgerichtete Schulsystem üblich ist und gekonnt wird. Die Entwicklung inklusiven Unterrichts kämpft daher in besonderem Maße gegen Einschränkungen durch tradierte rechtliche, zeitliche, räumliche und curriculare Strukturen, die sich auch in den persönlichen professionellen Routinen der Lehrkräfte manifestiert haben. Durch die Tiefe der nötigen Veränderungen ist die Entwicklung inklusiven Unterrichts im engeren Sinne zudem als langwieriger Lernprozess heterogener Kollegien und ihrer Schülerinnen und Schüler zu verstehen.
Der folgende Beitrag analysiert die Engpässe und besonderen Herausforderungen der derzeitigen Ausgangslage für die Entwicklung inklusiven Unterrichts, skizziert vor dem Hintergrund der heutigen Annahmen über Unterrichtsqualität ein Zielmodell guten inklusiven Unterrichts und zentrale Schritte in diese Richtung, verweist aber auch darauf, dass die Qualität inklusiven Unterrichts ein Entwicklungsprozess auf allen Systemebenen ist. Schulen sind unterschiedlich weit vorangekommen, Grundschullehrerinnen und -lehrer bringen unterschiedliche Voraussetzungen ein. Etliche unterrichten fachfremd. Sonderschullehrerinnen und -lehrer, die in der Grundschule eingesetzt werden, haben eher selten einen geschärften Blick für die fachliche Seite des Unterrichts. Auch die skizzierten Eckpunkte der Entwicklung, verstanden als wissenschaftlich derzeit weitgehend konsensfähige Orientierungen auf dem Entwicklungsweg, müssen in der Praxis vor dem Hintergrund der Situation an jeder Schule erst noch Gestalt gewinnen.
1 Ausgangslage und Problemstellung
Die Entwicklung inklusiven Unterrichts fordert von den Lehrerinnen und Lehrern die ethische Entscheidung für das gleiche Recht aller Kinder auf Teilhabe in allen Lebensbereichen und Bezügen, also auch im Unterricht (z. B. Edwards & Nuttall, 2009; Prengel, 2013). Dabei gilt es den »Mythos des Vorteils homogener Lerngruppen« (Reiser, 2002, S. 408) ebenso zu überwinden wie in der Folge die »Kopplung von Leistungsergebnis und sozialer Gruppierung« (ebd., S. 406). Die Schule soll nicht mehr alle Kinder nur an gleichen fachlichen Maßstäben messen, sondern im Sinne einer »egalitären Differenz« für jedes Kind in der Lerngemeinschaft seiner Kindergruppe fachliche Bezüge zum gemeinsamen Lerngegenstand ermöglichen und die Leistungen jedes Kindes wertschätzen. Das bedeutet zugleich, dass der Unterricht unterschiedliche Perspektiven fördern und ihren Austausch unterstützen soll (vgl. Prengel, 2001, S. 93 ff.).
Solche normativen Setzungen, wie sie international in der Fachliteratur zur Entwicklung des inklusiven Schulsystems zu finden sind, ernten kaum Widerrede, gehören sie doch mindestens seit den 1990er Jahren zum grundschulpädagogischen Basisrepertoire (vgl. Faust-Siehl, Schmitt & Valtin, 1990; Heyer et al., 1993; Schnell, 2003). Probleme treten erst dann auf, wenn die vorweggenommenen oder realen unterrichtlichen Anforderungen mit dem erlernten Repertoire und vor dem Hintergrund der persönlichen Einstellungen nicht mehr zu bewältigen sind (vgl. Kornmann, 1998). Dennoch kann die schlagartige Einführung von Inklusion auf der Ebene der Einzelschule, also ohne umfangreiche Vorbereitung, zu einem Gestaltwandel führen, weil etwa die Notwendigkeit der Differenzierung nicht mehr übersehen werden kann und deutlich wird, dass der gesamte Unterricht umgestellt werden muss (Carle & Berthold, 2004, S. 177). Gleichermaßen ist auf gesellschaftlicher Ebene die politische Grundsatzentscheidung für eine Auflösung der Sonderschulen und die Aufnahme aller Kinder in das Regelschulsystem ein einfacher Schritt. Durch die wenig transparente, über Jahrzehnte gewachsene und tradierte zeitliche, räumliche und rechtliche Struktur jedoch kommen nicht gleich zu Beginn alle obsolet werdenden Rahmenbedingungen in den Blick; weder auf Klassen- und Schulebene noch im Schulsystem. Sie setzen also während des selbst- oder fremdverordneten Veränderungsprozesses einen Rahmen, der zur Entwicklung des inklusiven Unterrichts nicht passt, ja diese entscheidend hemmen kann. Im Übergang vom Tradierten zum Neuen führt das zu parallelen Verhältnissen, im schlimmsten Fall dazu, dass die selektiven Prozeduren über den einsetzenden Veränderungsprozess hinweg staatlich verordnet tradiert werden und folglich in neuen Verkleidungen im inklusiv gedachten Unterricht wieder auftauchen (Geiling, 2012, S. 117 ff.).
Wird der Transformationsprozess systematisch angegangen, schafft das zunächst schrittweise Transparenz im Dickicht der noch nicht bekannten Anforderungen. Ist doch der Übergang vom alten Unterrichtsmodell zum neuen geprägt von Ungewissheit und von der Erfahrung des Nichtkönnens, wie sich beispielweise im Schulversuch Veränderte Schuleingangsphase immer wieder zeigte:
»Ohne Auseinandersetzung mit dem alten System ist das neue nicht zu erwerben. Denn ohne Distanzierung vom Tradierten schluckt das alte System die neuen Elemente und neutralisiert sie. Hinzu kam immer wieder die schmerzliche Erfahrung, das Alte problematisieren und das Neue denken zu können, es aber praktisch noch nicht zu beherrschen« (Carle & Berthold, 2004, S. 177).
Der Wandel stellt also insbesondere die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung auf die Probe, das Vertrauen in die gemeinsame Kompetenz des Kollegiums, das anspruchsvolle Ziel des inklusiven Unterrichts gemeinsam zu erreichen (Parker, 1994).
Mangelnde Systemhaftigkeit eines landesweiten Schulentwicklungsvorhabens hat jedoch zusätzlich zur Folge, dass die Entwicklung inklusiven Unterrichts sehr stark einzelschulbezogen erfolgen muss und die Entwicklungsarbeit wenig unterstützt einzig auf den Schultern der Lehrerinnen und Lehrer liegt.
»Dies verlangt eine hohe Ambiguitätstoleranz, eine gefestigte Überzeugung von der eigenen Arbeit sowie den Mut, teilweise gegen die Logik des Systems zu agieren. Dafür ist ein hohes Maß an Kreativität im Umgang mit den administrativen Rahmenbedingungen und den institutionellen Routinen vonnöten« (Hoffmann, 2014, S. 130).
Für die Lehrerinnen und Lehrer stellt sich eine Herkulesaufgabe. Diese erfordert es, aktuell noch geltende (teils rechtlich verankerte) Grenzen zu überwinden. Handelt es sich doch bei der Entwicklung inklusiven Unterrichts nicht nur um die Einführung einer neuen Makromethode, sondern um die Erneuerung des kompletten Unterrichts in einem erst noch zu reformierenden Schulsystem, eines Unterrichts, den es an der eigenen Schule noch nicht gibt und der folglich nur in Modellvorstellungen existiert.
2 Das Zielmodell: Inklusiver Unterricht in einer Schule für alle Kinder
Inklusiver Unterricht soll guter Unterricht für alle Kinder sein. Eine Schlüsselfunktion innerhalb der mit überschneidungsreichen Variationen bekannten Stellschrauben zur Gestaltung guten Unterrichts nehmen das Klassenklima, die Klassenführung, die Zielsetzungen, die Motivierung und Aktivierung von vertieften Lernprozessen, die Individualisierung und Beachtung von Lernvoraussetzungen, die Klarheit und Strukturiertheit, die Konsolidierung und Vernetzung des Gelernten, die fachliche Korrektheit und die Leistungsanforderung ein (vgl. Carle & Metzen, 2008, S. 105 ff.; Helmke, Helmke & Schrader, 2007, S. 56 f.; Riecke-Baulecke, 2001, S. 141; Carle, 2000, S. 306). Die genannten Merkmale können verschiedene Ausprägungen haben und sind in unterschiedlichen Unterrichtskonzepten zu finden. Qualitätskritisch für inklusiven Unterricht sind darüber hinaus ein zu etablierender Rahmen demokratischer Ziele, partizipativer Strukturen und Handlungsweisen, die soziale Gerechtigkeit und gegenseitige Anerkennung ermöglichen, wie Hinz sie in seinen Eckpunkten des Verständnisses von Inklusion formuliert hat (Hinz, 2014, S. 17 f.). Alle diese Wirkmomente sind vernetzt zu betrachten, kann doch z. B. ohne lernförderliches Klassenklima die beste Lernaufgabe nur begrenzt fruchten.
Der demokratische Rahmen ist nicht nur konstituierend für ein soziales und vertrauensvolles Klassenklima, beides zusammen stellt so etwas wie eine Basisnorm für den Erfolg der übrigen Einflussfaktoren auf die Unterrichtsqualität dar. Deshalb muss Klassenführung darauf ausgerichtet sein, den Kindern in immer wieder neuen Situationen zu zeigen, wie sie eine Lerngemeinschaft werden können. Dazu gehört, dass jedes Kind als einzigartiges Individuum von den anderen Kindern und vor allem vorbildhaft von der Lehrperson würdig und respektvoll behandelt wird. Gleichzeitig muss demokratisches Handeln in der Klasse angeleitet und strukturell unterstützt werden. Dazu gehört, dass die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse, ihre Sichtweisen und kritische Punkte einzubringen und in der Gruppe unter der Leitlinie einer »egalitären Differenz« (Honneth, 1992) zu verhandeln. Wenn es sich hierbei um eine Basisnorm für guten Unterricht handeln soll, muss auch gezeigt werden, wie sich der demokratische Rahmen und das soziale Klassenklima auf eine effiziente Steuerung des fachlichen Unterrichts auswirken. Diese Steuerung funktioniert nicht mechanisch, sondern menschlich und braucht zu ihrem Wirksamwerden Regeln, Raum, Zeit und geeignete Aufgaben, zu denen jedes Kind Sinnbezüge herstellen kann. Effizient ist die Steuerung des Unterrichts immer nur in Bezug auf bestimmte Ziele. Wenn es das Ziel ist, vertiefte Verstehensprozesse zu befördern, muss die Klassenführung den Austausch von Denkweisen, Lösungswegen, Arbeits- und Lernmethoden etc. ermöglichen und damit mehrdimensional alle Aspekte der Entwicklung der Kinder im Blick haben: fachliche, arbeitsmethodische, soziale und emotionale. Ohne geeignete Unterrichts- und Feedbackstrukturen kann niemand dieser komplexen Anforderung entsprechen. Kooperative, projektorientierte und reflexive Methoden und darauf bezogene Lernprozessbegleitung und Leistungsrückmeldung gewinnen an Bedeutung, sind aber auf kooperative und wertschätzende Beziehungen in der Klasse angewiesen. Entsprechend wird sich ein gutes Klassenklima durch einen guten Zusammenhalt, wenig Konkurrenz untereinander und hohes Engagement von Lehrperson sowie Schülerinnen und Schülern auszeichnen.
Annedore Prengel sieht inklusive Didaktik zusätzlich in Verbindung mit individualisiertem Lernen und inklusiver Diagnostik (Prengel, 2013, S. 6 f.). Individualisierung bedeutet für sie, dass im Gesamtkontext der Schulklasse anschlussfähige Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus für die Kinder mit verschiedenen Lernvoraussetzungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus können therapeutische Maßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung, in den Unterricht integriert werden, wenn alle Kinder davon profitieren können. Dafür sind einerseits lernbegleitende Einschätzungen durch die Lehrperson und durch die Schülerinnen und Schüler selbst erforderlich. So kann z. B. das Portfolio Anlass für ein Gespräch zwischen den Kindern und auch zwischen Kind und Lehrperson sein. Inklusive Diagnostik schließt nach Prengel (2013) auch nichtaussondernde spezielle Diagnostik mit ein, wenn es um die Analyse spezieller Bedürfnisse geht, z. B. weil besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen oder ein Nachteilsausgleich sichergestellt werden soll. Die spezielle Diagnostik zusammen mit der lernbegleitenden Einschätzung aller Kinder bildet dann die Grundlage für die Unterrichtsplanung, die sowohl die ganze Klasse als Lerngemeinschaft als auch das einzelne Kind einbeziehen muss.
Das OECD/CERI-Programm »Schooling for Tomorrow« (OECD, 2006) hat den Begriff der Personalisierung ins Spiel gebracht, nach dem nicht nur die Niveaudifferenzierung für individualisiertes Arbeiten eine Rolle spielt, sondern die Person stärker ins Blickfeld rückt und über die inhaltliche Arbeit auch der Erwerb personenbezogener Kompetenzen mehr Gewicht erhält. Damit soll den Schülerinnen und Schülern Raum für eine individuell angemessene Lernrhythmisierung, eigene Lernwege, Lernstrategien und Arbeitstechniken eingeräumt werden. Gleichzeitig verspricht man sich durch die Ansprache persönlicher Interessen eine aktivere und mehr in die Tiefe gehende Auseinandersetzung der Kinder mit den Lerninhalten.
Curricular verankerte Kompetenzziele bleiben auch im inklusiven Unterricht bestehen und sollen individuell bestmöglich erreicht werden. Das setzt voraus, dass die ...