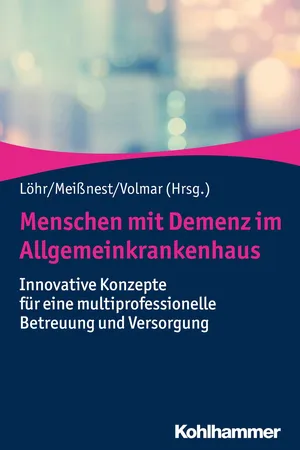![]()
1 Erfahrung einer Angehörigen
Paula Schneider
1.1 Leben oder Sterben?
»Er stirbt«, hatte meine Schwester am Telefon gesagt.
Ich hatte meinen Flug aus Griechenland umgebucht und war noch vor den anderen da gewesen. Vor meiner Oma, meiner Tante und meinem Onkel, die sich alle von meinem Vater verabschieden wollten. Er saß in einem Rollstuhl an der Wand, in einer Reihe mit anderen. Zuerst erkannte ich ihn nicht.
Jemand hatte ihm die Haare zurückgekämmt, sein Gesicht war eingefallen und leichenblass. Das war nicht mein Vater, das war ein anderer, einer, der nichts mehr erwartet.
»Papa stirbt«, dachte ich.
Zwei Wochen zuvor hatten meine Schwester und sein Psychiater ihm ein Glas Wasser angeboten. Die Flüssigkeit war ihm aus dem Mund gelaufen, aber er hatte zu trinken versucht. Zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater bereits zweieineinhalb Wochen jegliche Nahrung und Flüssigkeit verweigert. Noch nie war mir so bewusst gewesen, wie sehr ich ihn liebte und wie sehr ich mir wünschte, dass er am Leben war. Abend für Abend saß ich bei meinen Freunden im Wohnzimmer und telefonierte mit meiner Schwester in Deutschland, um zu beraten, was wir tun sollten. Die Distanz machte alles sehr viel schwieriger. Lange diskutierten wir über eine Magensonde. Meine Schwester und der Psychiater waren dafür, der Arzt meines Vaters und sein gesetzlicher Betreuer waren dagegen. Ich wusste nicht, was zu tun war. Ein zweiter Onkel, der Gerontologe ist, beriet meine Schwester. »Aus der Ferne kannst du die Situation nicht beurteilen«, sagte er mir.
Aus dem Krankenhaus kam die Nachricht, dass unser Vater nur dann einen schnellen PEG-Operationstermin erhalten würde, wenn er bereits künstlich durch die Nase ernährt würde. Ansonsten gelte sein Fall nicht als Notsituation. Die Wartezeit für eine Operation betrage etwa zwei Wochen. Ihm einen Schlauch durch die Nase legen zu lassen, war unvorstellbar für uns. Im Pflegeheim war ihm bereits eine Kanüle mit Flüssigkeit ins Bein gelegt worden.
Monate zuvor war unser Vater während eines Aufenthalts in der geschlossenen Psychiatrie als dement diagnostiziert worden. Er hatte mehrere Schlaganfälle gehabt, war mit dem Fahrrad auf einer Schnellstraße aufgegriffen worden, und hatte sich am Ende auf dramatische Weise auf dem Anrufbeantworter meiner Schwester verabschiedet. Aus der Klinik entlassen, lebte er dann noch für eine Weile alleine in seinem Haus auf dem Land. Mobile Dienste brachten ihm Essen und Medikamente und ich besuchte ihn regelmäßig mit dem Zug und füllte seinen Kühlschrank. Außerdem gab es eine Pflegekraft, die ihn beinahe täglich besuchte. Zwei Wochen bevor sein Betreuer ihn dann zur Kurzzeitpflege in das Heim bringen ließ, war er plötzlich nicht mehr erreichbar. Als er endlich wieder ans Telefon ging, war er sehr verwirrt.
»Papa, wie geht es dir?«, hatte ich gefragt und er hatte kaum antworten können. Offensichtlich war er in einer akuten Notsituation. Zwei Ärzte, die ihn wenige Stunden später aufsuchten, kamen zu dem Schluss, dass kein Grund zur Sorge bestehe. Auch im Krankenhaus am nächsten Tag war man der Meinung, dass alles in Ordnung sei. Den Verdacht, dass mein Vater einen weiteren, schweren Schlaganfall gehabt haben könnte, bestätigte niemand, obwohl vor allem die Pflegekraft, die ihn regelmäßig sah, sehr beunruhigt über seinen Gesundheitszustand war. Sein Betreuer gab ihn daraufhin zur Kurzzeitpflege in ein Heim. Eineinhalb Wochen später hörte mein Vater auf zu essen und zu trinken. Bald konnte er weder schlucken noch sprechen, gehen oder stehen.
Am Tag unseres Wiedersehens war die Lage todernst geworden. Meine Großmutter, meine Tante, mein Vater und ich saßen mit ihm im Garten des Pflegeheims. In eine Decke gewickelt und im Rollstuhl sitzend, lauschte er – in sich zusammengesackt – unseren Gesprächen. Ab und zu lachte er und sagte Dinge, die wir nicht verstanden.
»Er hätte nie so leben gewollt«, sagte mein Onkel beim Mittagessen. »Dann lieber tot.« Ihm hatte mein Vater auf die Frage, ob er sterben wolle mit »ja« geantwortet. Meine Großmutter meinte: »Man weiß es nicht.« Zum Abschied hatte sie ihm mit lang ausgestreckten Arm den Kopf gestreichelt. Abends saß ich an seinem Bett. Er hatte den Kopf zur Wand gedreht. Wie ich als Kind, wenn er nach einem Streit zur Tür hereinkam, um Frieden mit mir zu schließen. Ich musste herausfinden, was er wollte. Leben oder Sterben. Und ihn dann, so gut ich konnte, auf seinem Weg begleiten. Das war mein Plan.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Papa«, sagte ich. »Jetzt bist du wie ich damals. Ich habe keine Ahnung, was du dir wünschst. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du sterben willst.«
Mein Vater war ein sehr aktiver Mensch gewesen. Seine intellektuellen Fähigkeiten und Kreativität hatten stets sein Leben bestimmt. Noch als Rentner hatte er mühelos ein paar hundert Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt oder mit einem Klettergurt gesichert hohe Bäume beschnitten. Als Kind hatte ich ihn vergöttert und zugleich große Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Die Scheidung meiner Eltern hatte unsere Beziehung noch komplizierter gemacht, als sie es ohnehin schon war, und nicht zuletzt aufgrund seiner Krankheit war es nicht immer einfach, ihn zum Vater zu haben. Inwiefern die manisch-depressive Erkrankung, unter der er litt, ihn neben der spät im Alter entstandenen vaskulären Demenz beeinflusste und formte, wurde mir erst vollends klar, nachdem sein Arzt sämtliche Medikamente abgesetzt hatte. Die positive Wirkung, die Psychopharmaka haben können, wurde überdeutlich, als er ohne sie in eine tiefe Depression glitt.
»Sterben wollen fühlt sich anders an«, dachte ich, als ich vor ihm saß und gleichzeitig keine Ahnung hatte, was in ihm vorging. Seit ich denken kann, hatte er vom Tod gesprochen. Irgendwann würde er sich umbringen, hatte er immer
Abb. 1.1: Ungeheuer
wieder gesagt und Witze über die verschiedenen Todesarten gemacht. Nun war die Situation eine gänzlich andere. Trotzdem mussten wir so schnell wie möglich herausfinden, ob es ihm diesmal wirklich ernst war. Wir wollten, dass er lebt, aber nicht gegen seinen Willen. Wie findet man das heraus, wenn jemand nicht sprechen kann? Nachdem ich mit den Pflegerinnen des Heims, der Pflegedienstleitung und der Heimleitung gesprochen hatte, wurde ein Krankentransport organisiert. Die Sanitäter, die meinen Vater auf ihre Trage hoben, waren fassungslos, wie schlecht es ihm ging. »Wie sind die denn hier drauf?«, fragte der eine.
1.2 In der Notaufnahme
Dann: Mein Vater in der Notaufnahme. Überall Schläuche. Wieder lag er regungslos da (
Abb. 1.2).
Wieder sagte ich Textbausteine auf: »Manisch-depressiv«, »dement«, »schon immer latent magersüchtig«, »er hat sich umbringen wollen, seit ich denken kann«, »schwere Depression«, »Medikamente abgesetzt«, »Magensonde«.
Ich erklärte den Ärzten, es ginge darum, dass unser Vater erst in einem anderen Zustand entscheiden könne, ob er leben oder sterben wolle. Derzeit befinde
Abb. 1.2: Klein
er sich offenbar in einer sehr schweren Depression. Nichts zu tun hieße, ihn innerhalb weniger Tage sterben zu lassen. Eine Patientenverfügung gab es nicht.
Ich weiß nicht, was die Ärzte dachten, mit denen ich sprach. Ich weiß nur, wie schwer es mir fiel, zu erklären, was meiner Schwester und mir schon seit Wochen im Kopf herumgegangen war. Sie waren skeptisch, aber am Ende lösten sich ihre verschränkten Arme. Der eine meinte, er würde eine Blutuntersuchung machen. »Vielleicht können wir ihn dann erstmal hierbehalten«. Die Blutprobe hatte katastrophale Werte; zu meiner großen Erleichterung durften wir bleiben. Eine Stationsschwester erzählte uns einige Tage später, dass die Kollegen im Labor Witze darüber machten, dass sie tagelang immer wieder neue Blutproben von einem Mann erhielten, der eigentlich schon längst hätte tot sein müssen. Der Natriumwert meines Vaters war so hoch, dass ihn kein Gerät mehr messen konnte.
Das Krankenhaus roch gut. Neutral. Hier gab es Linoleumböden, Menschen in sauberen weißen Kitteln, Schläuche und Scheren, Metallzangen und Messer. Dinge, vor denen mein Vater Angst hatte und ich auch. Aber es waren Dinge, die Leben retten konnten. Ich hatte das Gefühl, gleichzeitig das Richtige und das Falsche zu tun. Das Wichtigste aber war, dass wir bleiben durften. Auch mein Vater schien erleichtert. Aber die Diskussion um die Magensonde ging weiter. Die Stationsärztin hatte eine klare Haltung:
»Magensonde? Das ist ja wie ein Schwein mästen.«
Bereits nach der ersten Nacht wurde mein Vater auf eine andere Station verlegt, wo jemand anderes verantwortlich war. Was dann folgte, waren eineinhalb schwierige Wochen, von denen er einige Tage im Delir um sein Leben rang. Wie es mir während jener Zeit ging, möchte ich mit Hilfe von sieben Listen verdeutlichen:
Liste Nr. 1
»Es kostete meine ganze Kraft«
• darauf zu achten, dass mein Vater an keinem der Schläuche zog
• i...