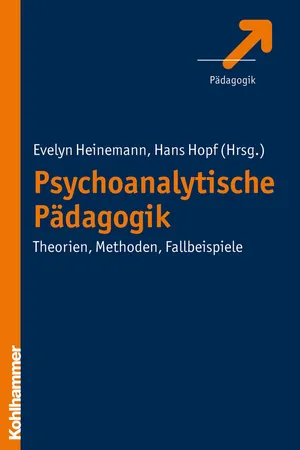![]()
Psychoanalytische Pädagogik in Institutionen
![]()
Psychoanalytische Unterstützung für Frühgeborene und ihre Eltern
Sevgi Meddur-Gleissner
Einleitung
Die Frühgeburt wird definiert als Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche. In den so genannten entwickelten Ländern beträgt der Anteil der Frühgeburten zwischen 5 und 12 % aller Geburten. Ungefähr 13 Millionen Frühgeburten gibt es jährlich auf der ganzen Welt, das sind 9 % aller Geburten. Angesichts der Fortschritte in Perinatologie und Neonatologie in industrialisierten Ländern sind die Überlebensraten dramatisch gestiegen, sogar bei Säuglingen mit extrem geringen Gewicht. Heute überleben mehr als 95 % der Säuglinge, welche vor der 28. Schwangerschaftswoche, also 12 Wochen zu früh, und mit einem Gewicht von unter 1250 g geboren werden. Säuglinge, die mit 24 Wochen geboren werden, haben immerhin noch eine Überlebenschance von 50 %. Die Rate schwerwiegender Behinderungen bei Säuglingen, die mit oder unter 25 Wochen geboren werden, beträgt ca. 25 %, bei Säuglingen, die zwischen 25 und 27 Wochen geboren werden, ca. 15 % (Als und Butler 2008, 46).
Wir begegnen zunehmend Kindern, deren Eltern therapeutische Hilfe wegen Symptomen wie Unruhezustände, Lernstörungen, psychosomatische Reaktionen oder diversen anderen Entwicklungsstörungen in Anspruch nehmen. Bei näherem Hinsehen stellt sich nicht selten ein direkter oder indirekter Zusammenhang mit einer Frühgeburtlichkeit heraus. Als und Butler (2008) sprechen von einer dauerhaften Benachteiligung Frühgeborener, was viele Aspekte umfasst wie Schulleistungen, Affektregulierung und soziale und emotionale Anpassung. Sie führen dies auf den plötzlichen Beginn einer abrupten Flut sensorischer Eindrücke zurück, die von der Evolution eher in einem gestaffelten Zeitrahmen vorgesehen sei. Auch sei die Trennung bei der Geburt unvorbereitet. Die Eltern können sich erst allmählich körperlich und seelisch auf die Geburt ihres Kindes einstellen. Es bestehen Unterschiede zwischen Frühgeborenen und reifgeborenen Säuglingen. Nach Als und Butler (ebd., 47) zeigen neuere Forschungen, dass diese Benachteiligungen meist bleiben und häufig sogar zunehmen.
Dies zwingt uns als Analytiker und Psychotherapeuten zu einer Auseinandersetzung mit den psychischen Folgen der Frühgeburtlichkeit. Sowohl in Praxen als auch in der Institutsambulanz begegnen wir zunehmend Kindern mit frühen Bindungsstörungen, deren Eltern therapeutische Hilfe suchen. Symptome wie Unruhezustände, Lernstörungen, psychosomatische Reaktionen oder diverse andere Entwicklungsstörungen hängen öfters mit einer Frühgeburtlichkeit zusammen.
Diese Tatsache haben wir, Mitglieder und Kolleginnen des Mainzer Psychoanalytischen Institutes, zum Anlass genommen, uns mit den unbewussten, inneren Prozessen der frühgeborenen Säuglinge und deren Eltern näher zu beschäftigen. Die Mitglieder einer neu gegründeten Arbeitsgruppe, bestehend aus Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Psychoanalytikern und Ausbildungskandidaten hospitieren einzeln in der Frühgeborenenintensivstation der Universitätsklinik Mainz und beobachteten mehrmals pro Woche je ein frühgeborenes Baby über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen.
Die Säuglingsbeobachtung, die zum Bestandteil einer psychoanalytischen Ausbildung gehört, liefert dem Beobachter wertvolle Hinweise über die frühe Mutter-Kind-Beziehung. Diese Beobachtungen sensibilisieren uns für die unbewussten innerpsychischen und interpersonellen Prozesse, die wir uns als Therapeuten in den Kindertherapien zu Nutze machen. Dies gilt insbesondere beim Verstehen sehr früher Bindungsstörungen. Wir möchten unser Wissen von der Säuglingsbeobachtung für die Prävention nutzen, indem wir z. B. Eltern beim Verstehen kindlicher Signale unterstützen oder mit Vertretern anderer Fachgebiete zusammenarbeiten. Aus diesen Überlegungen heraus entstand unsere Frühgeborenenambulanz, die Eltern Frühgeborener vor und nach der Geburt eine unterstützende Begleitung ermöglichen soll.
Die Welt des Frühgeborenen in der Klinik
In der Arbeitsgruppe wurde uns bewusst, dass man bei der Beschäftigung mit dem Thema Frühgeburt einen Grenzbereich menschlicher Erfahrung betritt, in dem wenig Raum für die mit der Geburt eines Kindes üblicherweise verbundene Freude zu spüren ist. Vorherrschend ist vielmehr die Allgegenwärtigkeit des Todes und die Angst vor ihm. Das Überleben des Säuglings erscheint wegen seiner biologischen und psychologischen Unreife unsicher. Und selbst wenn das Baby überlebt, bleibt für die Betroffenen die Frage, ob die Frühgeburt irreversible Schäden hinterlassen wird.
Was bedeutet es, wenn der frühgeborene Säugling die Umgebung des Mutterleibes gegen die Intensivstation für Frühgeborene tauscht (Als und Butler 2008, 44), zu einer Zeit, in der sich sein Gehirn rasch entwickelt, wenn der erste Kontakt mit seiner Umwelt nicht mit der Brust der Mutter, sondern mit kalten, penetrierenden technischen Geräten, Schläuchen und schmerzhaften Stichen aufgenommen werden muss. Wie verarbeitet er diese Erfahrungen und wie sehen die intrapsychischen Verarbeitungsmodelle aus? Die folgenden exemplarischen Auszüge aus Beobachtungen in der „Intensivstation für Frühgeborene“ von Katja Eisinger, Mitglied der Frühgeborenenambulanz, vermitteln die Lebens- und Überlebenssituation eines frühgeborenen Kindes.
„Schon bei der Anfrage um eine Erlaubnis, eine Beobachtung auf der Frühgeborenenstation absolvieren zu dürfen, wurde ich damit konfrontiert, in was für einen empfindlichen Bereich ich vordringen wollte. Ich musste ein Gesundheitszeugnis vorlegen und garantieren, dass ich nur beobachten würde und auf keinen Fall in irgendeiner Weise tätig werde. Ich bekam das Gefühl, in eine außerordentlich verletzliche Welt einzudringen. Die vielen Vorsichtsmaßnahmen wirkten auf mich wie eine Warnung, es mir noch einmal gut zu überlegen, ob ich auch wirklich einen Einblick in einen Bereich erhalten möchte, in dem man eigentlich gar nichts zu suchen hat. Es kam mir fast so vor, als würde ich in eine intrauterinäre Welt eindringen … Ich bekam von der Schwester einen Säugling zugeteilt, dessen Mutter mit der Beobachtung einverstanden war. Aus Gründen der Schweigepflicht werde ich nicht mehr zu dem Säugling sagen, als dass er in der 23. Woche geboren wurde und schon seit einigen Wochen auf Station lag. Ich nenne ihn hier Daniel … Als ich Daniels Zimmer das erste Mal betrat, sah ich zuerst sein Bettchen, viele Schläuche und Geräte, die leise Piepser von sich gaben. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf: „Das ist kein Mensch“. Doch als ich seine winzigen Hände und sein Köpfchen entdeckte, das die Größe einer Grapefruit hatte, war er sofort ein sehr kleines Kind für mich und die Geräte gerieten schlagartig in den Hintergrund. Ich war erstaunt darüber, wie schnell man in dem Kontakt zum Kind die Technik komplett ausblenden kann … Die Mutter kam, begrüßte zunächst ausgiebig ihren Sohn und streichelte ihn zärtlich. Dann erkundigte sie sich bei der Schwester nach den aktuellen Gesundheitswerten. Mit Hilfe der Schwester versorgte sie Daniel: wickelte ihn, nahm ihn aus dem Bettchen, säuberte ihn. Sie wirkte dabei sehr unsicher, sah immer wieder hilfesuchend zur Schwester und fasste ihren Sohn mit ganz vorsichtigen, streichelnden Händen an, als wäre er aus dünnstem Glas. Wie ich Daniel so nackt vor mir liegen sah, erschreckten mich die Kabel, die in seinem Körper steckten und die durchstochenen Fersen. Ich dachte, hier liegt fast mehr Kabel als Mensch … Als Daniel einmal anfing, sich in seinem Bettchen zu bewegen, kam eine Schwester zu ihm und steckte ihm einen Schnuller in den Mund, damit er sich beruhigte. Ich war erstaunt, hatte seine Mobilität nicht als Beunruhigung, sondern als Explorationsbedürfnis empfunden und dachte sofort, die Schwester weiß es bestimmt besser. Mir wurde deutlich, wie schnell ich meiner eigenen Wahrnehmung misstraute und die Verantwortung aus Unsicherheit lieber jemand anderem übertrug … Einmal grimassierte er heftig. Ich konnte seine Grimassen nicht deuten, fragte mich, ob es ihm gut ginge und ertappte mich, wie ich auf den Monitor schaute, als würde dort stehen, wie Daniel sich fühlte … Ein anderes Mal war Daniel bis zum Gesicht eingewickelt, was das Gefühl verstärkte, dass er in einer anderen Welt lebte. Es schien mir auf einmal ungeheuer schwierig, Zugang zu dieser Welt zu finden. Wie er da so lag, verkabelt und bis oben verpackt, spürte ich das Bedürfnis, ihn rauszuholen, auszuwickeln, irgendwie zu spüren … Ich dachte, so geht es bestimmt vielen Eltern: Einerseits möchten sie ihren Kindern nahe sein, andererseits entsteht gleich die Angst, durch die Ausführung dieses Bedürfnisses etwas zu zerstören: Es könnte ja sein, dass man den Kleinen dabei verletzt, einen gravierenden Schaden zufügt, weil vielleicht einer der Schläuche ausgerissen wird und eine Wunde entsteht. So müssen die Eltern ihr natürliches Bedürfnis, ihr Kind zu halten und zu versorgen, immer wieder unterdrücken … Die Schwestern sind auf dieser Station ständig präsent, was einerseits ein Sicherheitsgefühl vermittelt, andererseits scheinen sie aber auch eine Art Übersetzerfunktion zwischen den Säuglingen und ihren Müttern zu haben. Somit gibt es in dem direkten Kontakt zwischen Mutter und Kind immer noch ein weiteres Element – die Schwester, die einerseits der Mutter bei vielen Unsicherheiten hilft, andererseits wird es der Mutter jedoch erschwert, ihren eigenen Gefühlen zu vertrauen hinsichtlich der Frage, wie sie auf die Bedürfnisse ihres Kindes intuitiv am besten eingehen, wie sie ihre Babys stillen, wickeln und halten sollen. Auf der Frühgeborenenstation waren diese Fragen noch viel prekärer, eine falsche Bewegung und man zieht vielleicht den Beatmungsschlauch aus der Nase. Die ständige lebensbedrohliche Situation führte dazu, dass man auf jede einzelne Bewegung doppelt acht geben musste, so dass z.B. das Wickeln noch etwas technisierter – mit den genau richtigen Handgriffen – gezeigt wurde als es bei einem so genannten normalen Säugling der Fall gewesen wäre. Auch das erschwert der Mutter, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen … Der erste Blick eines jeden, der in den Raum kommt – sei es eine Schwester oder ein Elternteil – gilt dem Monitor. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind scheint von den Monitoren bestimmt zu sein. Wenn ein Baby schreit, haben die Bezugspersonen die schwierige Aufgabe, den Grund für das Schreien (wie Hunger, Schmerzen, Übererregung etc.) herauszufinden. Frühgeborene schreien nur wenig. Hier meldet sich der Monitor, so dass die Kinder und die Eltern in den ersten Lebenswochen nicht die Erfahrung machen, dass sie sich aufeinander abstimmen müssen, um verstanden zu werden. Die Suchbewegung fällt weg, die Eltern wissen sofort, wie sie handeln müssen – z. B. die Sauerstoffzufuhr erhöhen – und müssen nicht anfangen, mit ihrem Kind gemeinsam auf die Suche nach dem störenden Element zu gehen. Gerade diese gemeinsame Suche jedoch scheint mir wichtig für das Erleben des Kindes, das dann die Erfahrung macht, dass jemand anderes zur Verfügung steht, der mit ihm zusammen die beängstigenden Affekte aushält und hilft, die Störungsquelle zu beheben. … Die anfängliche Neugier und Spannung wurde mit jedem Besuch auf der Station schwächer, so dass am Ende vor allem Hilflosigkeit und Ohnmacht zu spüren waren … Wie nah Daniel dem Tod immer noch war, erfuhr ich, als mir die Mutter berichtete, dass er ganz kurz aufgehört hatte zu atmen und kollabiert wäre, worüber sie sich sehr erschrocken zeigte. Er hätte sich nach kürzester Zeit erholt – aber das Wissen um den Beinahe-Tod geriet wieder massiv ins Bewusstsein. Gerade unter diesen Umständen bewunderte ich die Mutter, die es schaffte, eine warme und herzliche Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen. Ich hätte es verstehen können, wenn sie sich innerlich distanziert hätte, die Pflege überwiegend dem Personal überlassen und sich erst dann emotional ihrem Kind hätte zuwenden können, wenn das Überleben weitgehend gesichert wäre. Denn die permanente Todesbedrohung des eigenen Kindes auszuhalten scheint für mich fast unmöglich. Für Daniel jedoch war es ein Glück, dass er eine Mutter hatte, die sich trotz seiner lebensbedrohlichen Situation liebevoll um ihn kümmerte und ihm damit beistand, seine gesundheitlichen Schwierigkeiten zu ertragen.“
Für mich stellt sich die Frage, inwieweit die Frühgeburt und die damit verbundenen Erfahrungen des Kindes, vor allem die frühe Trennung, in den analytischen Verstehens- und Deutungsprozess einbezogen werden können. Gemeint ist hiermit, dass das frühgeborene Kind auf Grund der Notwendigkeit besonderer medizinischer Betreuung in den ersten Wochen seine ersten Objekterfahrungen nicht wie normal Geborene mit einer Mutter, sondern in einer invasiven Umgebung und mit vielen körperlichen Schmerzen mit dem Krankenhauspersonal und vielen Maschinen machen muss. Die Beziehung zu den zur medizinischen Versorgung des Kindes eingesetzten Maschinen sind die erste relevante Objektbeziehung, was für das Verstehen der inneren Konfliktdynamik genauso wie für die Technik der Behandlung relevant ist. Besser verstehbar in ihrer Genese werden auf diesem Weg insbesondere gewisse Besonderheiten der Übertragungsbeziehung und der Gegenübertragungsgefühle. Ein Beispiel dafür ist die anhaltende Sehnsucht nach dem Brutkasten, die zur Bildung einer Homöostase führt. Die erste Umwelt eines Frühgeborenen ist die Frühgeborenenstation. Das bedeutet in der Realität: Schleuse, Sterilität und räumliche Trennung von der Mutter. Der Beobachter kann plastisch erfahren, dass ein frühgeborenes Kind ein zerbrechliches Baby ist, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Man könnte dies als ein „Kaum-Sein“ (Hidas und Raffai 2002, S. 57) bezeichnen.
Befände sich das Kind noch im Bauch der Mutter, wäre es von der Mutter beschützt. Statt dessen wird der Säugling, betreut von einem technisch versierten, gut ausgebildeten Personal, in einem künstlichen Uterus gehalten. Der wichtige Hautkontakt wird durch das „Känguruhen“ befriedigt. Die unbewusste Frage einer Mutter während der Schwangerschaft: „Werde ich eine gute oder eine schlechte Mutter sein?“ oder die unbewussten Verschmelzungsphantasien mit dem idealisierten, vollkommenen Baby werden durch die frühe Notgeburt abrupt beendet; die Entidealisierung, die meist am Ende der Schwangerschaft einsetzt, fehlt. Der Anblick des frühgeborenen Babys löst bei der Mutter sowohl Befremden als auch unerträgliche Schuldgefühle und Ängste aus. Hilflosigkeit und Überwältigungsgefühle bis hin zur Distanzierung können auftauchen. Mit dem Anblick wird die unbewusste Entwertung als Mutter assoziiert, die mit dem eigenen Versagen gleichgesetzt wird. Es entsteht die Phantasie: „Ich konnte mein Kind nicht halten.“ Das Kind verweilt in der Regel bis zum Geburtstermin im Brutkasten, weil die Ärzte und Schwestern, aber vor allem die Maschinen, an die das Frühgeborene angeschlossen ist, das Kind in den Augen der Mutter besser „bemuttern“ als sie selbst. Real führt dies zu einer Passivität der Mutter. Die Beobachter erlebten manche Mütter sowohl als passiv als auch als teilweise emotional unbeteiligt.
Die Geräusche der verschiedenen Maschinen im Krankenzimmer, die mal monoton, mal laut sind, dann wieder alles schrill übertönen, werden zu (beruhigenden) Primärobjekten, die Sicherheit geben und das Überleben garantieren. Der Säugling erfährt eine sofortige Resonanz auf seine unmittelbare Befindlichkeit. Es ist gut vorstellbar, dass die regelmäßigen Geräusche der Maschinen die Todesangst des Kindes mildern. Es entsteht eine Interaktion zwischen Säugling und Maschine. Das ist insofern relevant, als wir bei unseren Beobachtungen in der Frühgeborenenstation den Eindruck gewannen, dass einige der Eltern zu ihrem Säugling erst dann eine Bindung herstellten, als das Überleben des Kindes gesichert war. In der Zwischenzeit wurde das Baby an das Stationspersonal abgetreten. Die Funktion des mütterlichen Primärobjekts übernahm die Station samt aller Maschinen.
Was macht der Säugling mit seinen Gefühlen? Was macht er mit den Schmerzen, die er ertragen muss? Ein lebendiges Objekt, das seine Affekte erwidert, ist nur bedingt oder nicht ausreichend vorhanden. Die primären Liebes- und Hassgefühle des Kindes können in dieser Zeit nicht ausreichend in ein mütterliches Objekt projiziert und von ihm gehalten werden. Das heißt, es fehlt an einer lebendigen Interaktion. Es fehlt an einem ausreichenden Container, der Triebim...