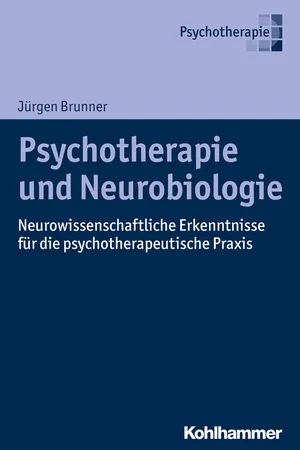![]()
1 Gegenseitige Annäherung von Psychotherapie und Neurobiologie
1.1 Freuds Zukunftsvision einer neurobiologisch fundierten Psychotherapie
Als junger Wissenschaftler beschäftigte sich Sigmund Freud (1856–1939) intensiv mit Neuroanatomie und Neurophysiologie. Er publizierte zu verschiedenen neurowissenschaftlichen Themen. Zu seinen frühen Forschungsgegenständen gehören beispielsweise die Spinalganglien und das Rückenmark, die Syringomyelie, die Wirkung des Kokains, die Hemianopsie, der Ursprung des Hörnervs und die Aphasie.1 Heute würde man sagen: Der Begründer der Psychoanalyse begann seine Karriere als Neurobiologe. Der frühe Freud hielt sogar eine neurobiologische Fundierung der Psychoanalyse prinzipiell für möglich. Er entwickelte früh ein Gespür für das innovative Potential der Neurobiologie und war davon überzeugt, dass der Erkenntnisfortschritt der Neurowissenschaften in der Zukunft wegweisend sei für das ätiologische Verständnis und die Behandlung psychischer Störungen.
Die methodischen Begrenztheiten der Neurowissenschaften in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schätzte Freud allerdings realistisch ein. Daher nahm er an, dass die Neurowissenschaften zu seinen Lebzeiten eher wenig zur Entschlüsselung der menschlichen Psyche beitragen können. Dies dürfte ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, warum er selbst den neurobiologischen Ansatz nicht weiter verfolgte und rein psychologische Theorien entwickelte. Die Traumdeutung (1900) markiert seine Abkehr von der neurobiologisch orientierten Psychiatrie seiner Zeit. Freud ging einen eigenen Weg abseits des wissenschaftlichen Mainstreams. Er knüpfte vornehmlich an philosophische Theorien des Unbewussten an, die von Arthur Schopenhauer (1788–1860) und anderen Denkern entwickelt worden waren. Insbesondere der Einfluss Schopenhauers auf die Entwicklung einer Theorie des Unbewussten ist als hoch zu veranschlagen (Young und Brook 1994; Zentner 1995).
Zeitlebens hielt Freud seine psychoanalytischen Theorien nicht für in Stein gemeißelt. Vielmehr betrachtete er sie lediglich als vorläufige Hypothesen und heuristische Konzepte, die durch spätere naturwissenschaftliche Forschung modifiziert und sogar falsifiziert werden können. In Jenseits des Lustprinzips (1920) schreibt Freud (1999b, S. 65): »Die Mängel unserer Beschreibung würden wahrscheinlich verschwinden, wenn wir anstatt der psychologischen Termini schon die physiologischen oder chemischen einsetzen könnten. […] Die Biologie ist wahrlich ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, wir haben die überraschendsten Aufklärungen von ihr zu erwarten und können nicht erraten, welche Antworten sie auf die von uns an sie gestellten Fragen einige Jahrzehnte später geben würde. Vielleicht gerade solche, durch die unser ganzer künstlicher Bau von Hypothesen umgeblasen wird.« Auch die heutige Psychotherapie als Wissenschaft ist gut beraten, wenn sie Freuds Auffassung teilt und offen ist für die Entwicklungen der Neurobiologie. Diese Neuerungen sind sowohl bei der Überprüfung und Modifikation bisheriger Konzepte als auch bei der Generierung innovativer Ansätze angemessen zu berücksichtigen. Zwangsläufig führt die Beschäftigung mit der Neurobiologie zu einem »Abschied von liebgewordenen psychoanalytischen Therapiefossilien« (Henningsen 1998, S. 86). Zu solchen Atavismen gehören etwa abstruse Auffassungen von Melanie Klein (1882–1960) über frühkindliche aggressive Phantasien, welche der neurobiologischen Tatsache widersprechen, dass derart komplexe affektive und kognitive Leistungen in frühen Entwicklungsphasen überhaupt nicht neuronal realisierbar sind (Henningsen und Kirmayer 2000).
Der späte Freud (1999a, S. 108) betonte im Abriss der Psychoanalyse (begonnen 1938 und unfertig geblieben) den hypothetischen und heuristischen Charakter der psychoanalytischen Konzepte und verwies auf das revolutionäre Potential der Neurobiologie in der Zukunft: »[…] uns beschäftigt die Therapie hier nur insoweit sie mit psychologischen Mitteln arbeitet, derzeit haben wir keine anderen. Die Zukunft mag uns lehren, mit besonderen chemischen Stoffen die Energiemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen. Vielleicht ergeben sich noch ungeahnte andere Möglichkeiten der Therapie; vorläufig steht uns nichts besseres [sic] zu Gebote als die psychoanalytische Technik und darum sollte man sie trotz ihrer Beschränkungen nicht verachten.« Freud war also offensichtlich der Meinung, dass seine psychologischen Termini nur vorläufigen Charakter haben und in der Zukunft durch adäquatere naturwissenschaftliche Begriffe substituiert werden müssen. Damit waren seine eigenen psychologischen Konstrukte für ihn selbst lediglich heuristische Modelle und Metaphern, also nichts weiter als eine bloße façon de parler. Zugleich zeigt sich in Freuds Prophezeiung, die Sprache der Psychologie werde in der Zukunft in das Vokabular der Chemie übersetzt, seine tief verwurzelte materialistische Grundüberzeugung, sein metaphysischer Monismus (Kächele et al. 2012). Obwohl er selbst keine eigenen neurobiologischen Forschungen mehr durchführte, blieb sein Denken stets durch die Biologie und andere Naturwissenschaften seiner Zeit geprägt, was sich in seiner Terminologie und in seiner Metaphorik widerspiegelt.
1.2 Das spannungsreiche Verhältnis von Psychotherapie und Neurobiologie
Einige der ungeahnten Möglichkeiten, von denen Freud nur träumen konnte, stehen uns heute zur Verfügung. Die rasante Entwicklung der Psychopharmakologie ab den 1950er Jahren hat eine Reihe von »besonderen chemischen Stoffen« (Freud 1999a, S. 108) hervorgebracht, mit denen sich neurobiologische Abläufe und damit psychische Funktionen direkt beeinflussen lassen. Nebenbei bemerkt: Die Entwicklung der Psychopharmaka hat wichtige sozialpsychiatrische Reformen erst ermöglicht. Salopp formuliert: Die bedeutenden Psychiatriereformen, etwa eines Franco Basaglia (1924–1980), wären ohne die Entdeckung der Antipsychotika gar nicht möglich gewesen.
Psychoanalyse und Psychotherapie gingen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts einen von der Psychiatrie unabhängigen Weg und entwickelten sich weitgehend unabhängig von den Neurowissenschaften. Dies führte zu unglücklichen dichotomen Polarisierungen und heute nicht mehr haltbaren ideologischen Grabenkämpfen zwischen biologischer Psychiatrie und Psychopharmakotherapie auf der einen Seite und Psychotherapie auf der anderen Seite. Die biologischen Psychiater warfen den Psychoanalytikern unwissenschaftliche Spekulation und eine Überbetonung biographischer Einflussfaktoren bei Vernachlässigung genetischer und biologischer Aspekte vor. Die Psychoanalytiker konterten und bezichtigten die biologisch orientierten Psychiater eines einseitigen biologischen Reduktionismus und kritisierten die Oberflächlichkeit und das mangelnde Verständnis für die intrapsychische und interpersonelle Dynamik bei übermäßiger Fokussierung der Biologie.
Die Fortschritte der neurobiologischen Methoden und der neurobiologisch inspirierten oder neurobiologisch fundierten Psychotherapieforschung machen heute eine Annäherung zwischen sprechender Medizin und somatischem Ansatz geradezu unausweichlich. Zu nennen sind die rasanten Fortschritte in der Bildgebung, so dass heute Einblicke in Gehirnfunktionen in vivo mittels funktioneller Kernspintomographie (fMRT) oder Positronen-Emissions-Tomographie (PET) möglich sind. Ein Meilenstein für die neurobiologische Psychotherapieforschung war die PET-Studie von Baxter et al. (1992), in der erstmalig nachgewiesen wurde, dass Psychotherapie objektivierbare neurobiologische Effekte hat. Konkret wurde gezeigt, dass eine erfolgreiche Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen eine Reduktion des Glucosemetabolismus in den Basalganglien (Nucleus caudatus) bewirkt. Dadurch war erstmalig der Nachweis gelungen, dass Verhaltenstherapie auf neurobiologischer Ebene wirkt. Die in der Pionierarbeit von Baxter et al. (1992) beschriebenen neurobiologischen Effekte einer Verhaltenstherapie wurden von anderen Autoren repliziert (Schwartz et al. 1996; Nakatani et al. 2003). Durch diese Befunde konnte erstmals buchstäblich vor Augen geführt werden, dass eine erfolgreiche Psychotherapie zu funktionellen Gehirnveränderungen führt, wodurch eine Normalisierung der neuronalen Aktivität bei Therapie-Respondern erreicht wird, deren Gehirnaktivität sich nach Psychotherapie an die von Gesunden angleicht.
In den letzten 20 Jahren wurden zahlreiche fMRT-Untersuchungen durchgeführt, die anhaltende neurobiologische Effekte verschiedener Psychotherapieverfahren bei unterschiedlichen Störungsbildern eindrucksvoll belegen. Diese Untersuchungen führten zu einer erheblichen wissenschaftlichen Aufwertung der Psychotherapie. Es war der Nachweis dafür erbracht worden, dass psychotherapeutische Interventionen nachhaltige und objektivierbare Veränderungen von neuronalen Funktionsabläufen und Gehirnstrukturen bewirken. Die Psychotherapie brauchte sich nun nicht länger vor der biologischen Psychiatrie zu verstecken. Heute besteht Konsens darüber, dass eine wirksame Psychotherapie neurobiologische Korrelate hat. »Change the mind and you change the brain«, so lautet griffig der Titel einer Publikation über die Bildgebungs-Korrelate einer verhaltenstherapeutischen Behandlung der Spinnenphobie (Paquette et al. 2003).
Eine wirksame Psychotherapie verändert nachhaltig das Gehirn, sowohl funktionell als auch strukturell. Vieles spricht heute dafür, dass Psychotherapie das Epigenom modifiziert und die Genexpression beeinflusst. Daraus resultieren Funktions- und Strukturveränderungen von Neuronen. Aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse gilt das traditionelle Verhältnis von Psychotherapie und Neurowissenschaften als Widersacher heute als antiquiert, denn das Gehirn als organisches Substrat psychischer Phänomene wird durch Erleben, Denken, Fühlen, Handeln und durch psychotherapeutische Interventionen verändert. Umgekehrt führen materielle Veränderungen durch eine Psychopharmakotherapie oder andere biologische Interventionen zu Effekten auf der psychischen Phänomenebene.
Heute stehen sich biologische Psychiatrie, Psychopharmakotherapie und Psychotherapie weniger antagonistisch und unversöhnlich gegenüber als früher. Bei vielen Krankheitsbildern ist die Kombination von Psychopharmaka und Psychotherapie indiziert und leitlinienkonform. Die Neurobiologie hat den interdisziplinären Dialog befördert und einer fruchtbaren Integration Vorschub geleistet. Man vermutet heute, dass Psychotherapie und Antidepressiva über unterschiedliche neurobiologische Mechanismen wirken. Diese unterschiedlichen Wirkmechanismen könnten synergistische Effekte erklären. Beispielsweise wirkt eine kognitive Verhaltenstherapie wahrscheinlich über eine Stärkung des Frontalhirns. Dadurch kann die überschießende Aktivität des limbischen Systems herunterreguliert werden. Psychotherapie wirkt nach diesem Modell also top-down. Antidepressiva scheinen hingegen eher bottom-up zu wirken, indem sie direkt subcorticale limbische Strukturen beeinflussen.
Psychotherapeutische Interventionen sind bei entsprechender Indikation oft mindestens so wirksam wie Medikamente. Häufig ist Psychotherapie einer Psychopharmakotherapie sogar langfristig überlegen. Daher stellt Psychotherapie bei vielen Indikationsbereichen die Therapie der Wahl dar (Brunner 2016a). Sowohl Psychopharmaka als auch Psychotherapie verändern nachhaltig neuronale Vorgänge. Die Neurobiologie ist also wirklich »ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten«, wie Freud (1999b, S. 65) es vor fast hundert Jahren formuliert hat. Wir blicken in eine spannende Zukunft und dürfen von der Neurobiologie in der Tat »die überraschendsten Aufklärungen« (Freud 1999b, S. 65) erwarten. Die Neurobiologie wird in der Zukunft auch die Psychotherapie verändern. Inzwischen haben wir neurowissenschaftlich begründete Hypothesen darüber, wie eine Psychotherapie das Gehirn nachhaltig verändert und umstrukturiert. Der stetige Zuwachs an neurobiologischem und störungsspezifischem Wissen dürfte dazu führen, dass bisherige nosologische und therapeutische Konzepte grundlegend modifiziert, einige sogar aufgegeben werden müssen. Dies war ausschlaggebend dafür, dass Klaus Grawe (2004) den Begriff Neuropsychotherapie einführte. Darunter verstand er eine neurowissenschaftlich inspirierte Psychotherapie (Grawe 2004, S. 372). Traditionelle pathogenetische Dichotomien wie genetisch versus umweltbedingt oder organisch versus psychogen/funktionell lassen sich vor dem Hintergrund des neurobiologischen Erkenntnisfortschritts heute nicht mehr aufrechterhalten. Psychotherapeuten und Psychopharmakologen führen heute keine unsinnigen Grabenkämpfe mehr; vielmehr werden synergistische Effekte beider Verfahren zunehmend beachtet. Man beschäftigt sich heute damit, wie bestimmte Substanzen die Effektivität einer Psychotherapie steigern (augmentieren) können. Unter dem Einfluss neurobiologischer Erkenntnisse hat Grawe aufgehört, in dogmatischen Therapieschulen des 20. Jahrhunderts zu denken. Er vermisst dadurch nichts, sondern ist überzeugt, dass die Konzepte herkömmlicher Therapieschulen keine brauchbare Basis mehr für die Psychotherapie darstellen (Grawe 2004, S. 443). Wahrscheinlich leistet die Neurobiologie einen wichtigen Beitrag zu einer Integration im besten Sinne, also zu einer wechselseitigen Annäherung zwischen zeitgemäßen verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Verfahren, aber auch zwischen Psychotherapie und biologischer Psychiatrie.
1.3 Die moderne Epigenetik: Brücke zwischen Genetik und Umwelteinflüssen
Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte haben die Annahme bestätigt, dass genetische Faktoren bei häufigen psychischen Erkrankungen wie der Depression bedeutsam sind. Technischer Fortschritt hat dazu geführt, dass heute nicht mehr nur einzelne Kandidatengene, sondern das gesamte Genom mit Hochdurchsatzverfahren untersucht werden kann. Dieser genomweite Ansatz ist im Unterschied zur Untersuchung von Kandidatengenen nicht mehr hypothesengeleitet. Derartige genomweite Untersuchungen nehmen auch solche neurobiologische Systeme ins Visier, die man bisher noch nicht mit der Depression oder einer anderen psychischen Störung in Verbindung gebracht hat. Dadurch eröffnen sich neue Horizonte. Bisher ungeahnte Zusammenhänge können gesehen und neuartige Hypothesen zur Pathogenese generiert werden. Derartige genomweite Untersuchungen laufen derzeit, sind aber methodisch sehr aufwendig. Die Bedeutung der Genetik für die Ätiologie ist sicherlich nicht unwesentlich; allerdings ist der Einfluss der Genetik geringer als ursprünglich erwartet. Ursprünglich nahm man an, dass die Gehirnentwicklung überwiegend genetisch determiniert sei. Diese Auffassung gilt heute als obsolet. Inzwischen gilt es als gesichert, dass die Gehirnentwicklung das Ergebnis eines komplexen Wechselwirkungsprozesses zwischen Genetik und Umwelteinflüssen ist, wobei postnatale Einflüsse sich in der Struktur des Gehirns niederschlagen (Sullivan 2012). Nach einem modernen Konzept (Gröger et al. 2016) ist die Gehirnentwicklung das Resultat aus genetisch programmierten neuronalen Netzwerken und Adaptationsprozessen, die durch Umweltfaktoren angestoßen werden. Die funktionelle Gehirnreifung wird durch soziale Interaktionen und Erfahrungen maßgeblich beeinflusst. Die Plastizität des Gehirns hängt von Interaktionen und Umwelteinflüssen wesentlich ab. Die Entwicklung neuronaler Strukturen wird durch biographische Erfahrungen ganz entscheidend geprägt.
Heute nimmt man in grober Näherung an, dass beispielsweise das Depressionsrisiko nur zu etwa einem Drittel erblich und zu zwei Dritteln umweltbedingt ist (Saveanu und Nemeroff 2012). In den letzten Jahren wurden diese Umwelteinflüsse intensiver erforscht (
Kap. 2). So hat sich körperlicher und sexueller Missbrauch in der Kindheit als ein wesentlicher Faktor erwiesen, der den Verlauf einer Depression beeinflusst und für die optimale individuelle Therapieplanung von Bedeutung ist. Es zeigte sich, dass Frauen, die in der Kindheit missbraucht wurden, von Psychotherapie stärker profitieren als von einer Psychopharmakotherapie (Nemeroff et al. 2003). Bei ihnen verbe...