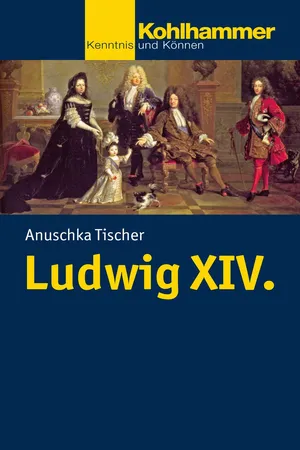
- 243 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Ludwig XIV.
About this book
Wie kaum ein anderer Herrscher der Neuzeit hat Ludwig XIV. (1638-1715) seine Epoche geprägt. Diese Biographie blickt hinter die Maske der Macht, fragt nach der Persönlichkeit des Herrschers und den innovativen Zügen seiner Regierung. Als Kind wurde er als "Sonne" der bourbonischen Dynastie zum König "gemacht", der mit seinen Kriegen den Grundstein des modernen Frankreich legte. Im Innern schuf er die Fundamente neuzeitlicher Staatsverwaltung und wurde mit dem Bau von Schloss Versailles und durch sein Hofzeremoniell zum oft nachgeahmten Modell europäischer Kultur. Bis heute strahlt die öffentliche Person des Sonnenkönigs auf seinen Nachruhm ab. Diese äußerst lesbare Biographie beleuchtet Ludwig im Lichte aktueller Forschung neu.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Ludwig XIV. by Anuschka Tischer in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & Early Modern History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Ludwig – der Gottgegebene, der Große, der Sonnenkönig
Ludwig XIV. kam am 5. September 1638 auf Schloss Saint-Germain-en-Laye, rund 20 Kilometer westlich von Paris, zur Welt. Seine Geburt war so bemerkenswert, dass ihm die Zeitgenossen den Beinamen »der Gottgegebene« (Dieu-donné) verliehen: Ludwigs Eltern, Ludwig XIII. von Frankreich und die spanische Infantin Anna von Österreich, waren bereits seit 23 Jahren kinderlos verheiratet. Die Dynastie der Bourbonen, die erst mit der Erbfolge des 1610 ermordeten Heinrich IV. auf den französischen Thron gekommen war, war somit über einen längeren Zeitraum ohne eine stabile Nachfolge.1 Frankreich hatte mit dem Salischen Gesetz eine klare Sukzessionsordnung. So war bis zur Geburt des Dauphins, wie der französische Thronfolger traditionell tituliert wurde, der präsumtive Thronerbe Ludwigs Onkel Gaston, Herzog von Orléans, ein notorischer Unruhestifter, der seinerseits keinen männlichen Erben hatte. Die nächsten in der Thronfolge stammten aus einer Seitenlinie der Bourbonen: der Fürst von Condé und seine Söhne, die für einen erneuten dynastischen Bruch und einen Politikwechsel mit ungewissem Ausgang gestanden hätten. Nach den langen Religions- und Bürgerkriegen des 16. Jahrhunderts und dem nicht unproblematischen dynastischen Neubeginn mit den Bourbonen waren dies keine guten Aussichten für ein Land, das gerade erst zur inneren Stabilität zurückgefunden hatte und auf die außenpolitische Bühne zurückgekehrt war. Die Geburt des Thronfolgers 1638 erschien dann als ein Zeichen Gottes, der Neuausrichtung Frankreichs schließlich seinen Segen zu geben. Der Junge wurde nach Ludwig IX. dem Heiligen benannt wie sein Vater und die folgenden französischen Könige. Diese Benennung war nicht nur eine Reminiszenz an den jeweiligen Vorgänger, sondern ein Bezug darauf, dass die Bourbonen auf den Thron gekommen waren, weil sie aus einer von Ludwig dem Heiligen begründeten Seitenlinie abstammten. 1640 wurde die junge Herrscherdynastie weiter abgesichert durch die Geburt von Ludwigs XIV. Bruder Philippe, der den Titel eines Herzogs von Anjou erhielt und nach dem Tod seines Onkels Gaston auch dessen Herzogtum Orléans übernahm.
Selbstbild und Selbstdarstellung
Ludwig XIV., der nach dem frühen Tod seines Vaters bereits 1643 König wurde, nahm in seiner langen Regierungszeit ab 1661 nicht nur alle politischen Entscheidungen in die eigene Hand, sondern er wollte auch das Bild vorgeben, das die Welt und die Nachwelt von ihm haben sollten. Dafür inszenierte er sein eigenes Leben und nutze alle Möglichkeiten der Selbstdarstellung von der Malerei bis zur Architektur, von der Historiographie über das Ballett bis zur Gartengestaltung. Es ist hinter dieser minutiösen Gestaltung kaum möglich, ihn als authentische Person zu greifen. Er ist eine »kulturelle Konstruktion« (Lothar Schilling),2 eine »Königsmaschine« (Roi-Machine, Jean-Marie Apostolidès).3 Seine Biographie zu schreiben, bedeutet zugleich, »Ludwig XIV. zuzusehen, wie er seine Rolle als König spielt, als erster König der Welt« (regarder Louis XIV jouer son rôle de roi, de premier roi du monde, Lucien Bély).4
Dennoch ist es dem König nicht gelungen, das Urteil der Geschichte über ihn so zu prägen, wie er sich sehen wollte: Gezielt lancierte man in Frankreich nach seinem Herrschaftsbeginn die Rede von Ludwig dem Großen (Louis le Grand). Doch obwohl Ludwig XIV. zweifellos prägend war für seine Zeit und obwohl sein Herrschaftsstil und kulturelles Gepränge ein Modell waren, an dem andere sich orientierten, hat sich dieser Beiname nicht durchgesetzt. Selbst in Frankreich, wo der König die öffentliche Meinung kontrollierte, gedachte man seiner nach seinem Tod immer seltener als Ludwig dem Großen, auch wenn der Beiname bis heute sporadisch Verwendung findet. Es ist jedoch das 17. Jahrhundert, das Zeitalter der drei ersten Bourbonen auf dem französischen Thron, das als »großes Jahrhundert« (Grand Siècle) firmiert, weil Frankreich sich in dieser Zeit aus den Bürgerkriegswirren herausarbeitete und sich heraufarbeitete zur politischen und kulturellen Führung in Europa. Ludwig XIV. dominierte dieses »große Jahrhundert« als König von 1643 bis 1715. Er läutete aber auch bereits das Ende des »großen Jahrhunderts« ein, den Niedergang, der sich bis zur Französischen Revolution 1789 immer weiter fortsetzen sollte. Im Rückblick erschien diese Epoche dann umso größer und glanzvoller. Voltaire konterkarierte seine eigene Gegenwart eine Generation später, indem er ihr das »Zeitalter Ludwigs XIV.« entgegenhielt, ein Titel der bis heute leicht als Lobpreis vermeintlich vergangenen Glanzes und Größe missverstanden wird.
Außerhalb Frankreichs hielten sich die Bewunderung für Ludwig XIV. und die Kritik an ihm allerdings ohnehin frühzeitig die Waage. Seiner aggressiven, überpräsenten Selbstdarstellung setzten andere Herrscher moderatere, oft konkurrierende, Inszenierungsmodelle entgegen. Die gegen den König gerichteten politischen, militärischen und publizistischen Kampagnen kritisierten nicht nur sein Handeln, sondern sie dekonstruierten bereits zeitgenössisch auch seine eigene Inszenierung.5 Neben dem Mythos Ludwig XIV. entstand so zeitgleich ein Gegenmythos. Im distanzierten historischen Urteil ist die Rolle des Königs in der Geschichte offensichtlich zu zwiespältig, als dass man ihn als »der Große« titulieren würde. Unbestritten sind dagegen seine Wirkung und Prägekraft, die bis in die Gegenwart reichen. Präsent ist er als »Sonnenkönig« (Roi Soleil). Die Sonnensymbolik hatte Ludwig XIV. selbst aufgegriffen und damit die führende Position des Kaisers in der fürstlichen Hierarchie in Frage gestellt. Der Titel des Kaisers implizierte traditionell den Vorrang vor allen anderen christlichen Fürsten, eine Rolle, die mit der der Sonne am Firmament in Analogie gesetzt wurde. Doch Ludwig XIV., ein politisch und militärisch starker Herrscher, dessen Position durch eine auf ihn zugeschnittene Staatsrechtstheorie bekräftigt wurde, sah sich angesichts seines eigenen Erbrechts und seiner vermeintlich uneingeschränkten Autorität als französischer König den Kaisern überlegen, die gewählt wurden und sich der politischen Mitsprache der Reichsstände stellen mussten. Herablassend betrachtete er sie als »Wahlfürsten« und »Generalkapitäne einer Deutschen Republik«.6 Erfolgreich etablierte sich Ludwig XIV. gegen Leopold I., dem die Sonnensymbolik eigentlich gebührte, als »die andere Sonne«.7 Dieses Symbol, das, anders als die Beinamen vom Gottgegebenen oder vom Großen, subtil in Bildprogrammen, Ballettkostümen oder Feuerwerksfiguren transportiert wurde, ging schließlich ganz auf Ludwig XIV. über. Zu verhalten hatte Leopold I. die Sonnenemblematik verwendet, zu wenig passte sie zum defensiven Kaisertum, das er repräsentierte. Für Ludwig XIV. erwies sie sich dagegen als perfekt. Prägnant bringt dieses Symbol seine Rolle in der Geschichte auf den Punkt, denn wie die Sonne besaß er eine Strahlkraft, die zugleich wärmte und faszinierte, aber auch blendete und verbrannte.
Titulierungen Ludwigs im Kontext seiner historischen Bedeutung
Ob wir die Titulierung Ludwigs XIV. als Gottgegebenem, als Großem oder als Sonnenkönig aufgreifen, immer sind es Beinamen, die der dynastischen oder herrschernahen Propaganda entspringen. Die Geschichtswissenschaft hat diese zu entschlüsseln und gegebenenfalls zu dekonstruieren. Dennoch machen die verschiedenen Titulierungen Ludwigs eines deutlich: die Entwicklung Frankreichs von einer um Stabilität ringenden Monarchie in den 1630er Jahren, für die bereits die Geburt des Thronfolgers ein göttliches Geschenk war, hin zu einer Führungsmacht in Europa, deren Herrscher eine herausragende Rolle in der Geschichte beanspruchte und einnahm. Dieser Schritt war keineswegs das alleinige Werk Ludwigs XIV., der allerdings das, was andere vor ihm und für ihn aufgebaut hatten, konsequent zu nutzen verstand. Ludwig XIV. war der erste französische König seit rund einem Jahrhundert, der sich wieder völlig auf die Außenpolitik, aber auch auf einen systematischen Staatsaufbau konzentrieren konnte. Frankreich war mit dem Frieden von Cateau-Cambrésis 1559 von der politischen Bühne Europas verschwunden und in den Religionskriegen versunken. Die französischen Könige, die bis dahin ihre Monarchie und deren Rolle in Europa aktiv gestaltet hatten und dabei an der Spitze des Kampfes gegen die habsburgische Hegemonie standen, agierten zunehmend defensiv. Die Zerreißprobe erlebte Frankreich, als mit dem Bourbonen Heinrich IV., dem König von Navarra, ein Hugenotte den Thron erbte. Erst nach einem längeren Bürgerkrieg und schließlich der Konversion zum Katholizismus konnte Heinrich IV. 1594 gekrönt werden. Befriedet war Frankreich damit nur an der Oberfläche: In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten die Nachfolger Heinrichs IV. es immer wieder mit Aufständen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen zu tun. Heinrichs IV. Sohn Ludwig XIII. unternahm mit seinem Prinzipalminister Kardinal Richelieu eine konsequente Politik der Stärkung der königlichen Autorität, die allerdings das Oppositionspotenzial weiter verschärfte.
In den 1630ern hatten Ludwig XIII. und Richelieu die Opposition so weit im Griff, dass sie an die einstmalige anti-habsburgische Politik früherer französischer Könige wieder anknüpfen konnten: 1635 erklärte Ludwig XIII. seinem Schwager Philipp IV. von Spanien den Krieg und verwickelte Frankreich damit auch in den Dreißigjährigen Krieg: Einen Krieg gegen Spanien von einem Krieg gegen den Kaiser trennen zu können, erwies sich angesichts der Einheit des Hauses Habsburg und der engen Interessenverflechtung der Habsburger Philipp IV. und Ferdinand II. als illusorisch, zumal Frankreich bereits seit 1631 den Krieg Schwedens im Heiligen Römischen Reich finanziell unterstützte. Als Ludwig XIII. 1643 starb, hinterließ er seinem erst 4-jährigen Sohn somit zwei Kriege, aber auch eine Opposition, die vielfach nicht beseitigt, sondern nur unterdrückt worden war und bald erneut hervortrat. Die Minderjährigkeit Ludwigs XIV. wurde zur Feuerprobe für die Position der französischen Krone nach innen wie nach außen. Es war das Verdienst Annas von Österreich, die als Regentin für ihren Sohn fungierte, und des Prinzipalministers Kardinal Jules Mazarin, dass die Krone diese Feuerprobe bestand. Aus dem »gottgegebenen« Ludwig XIV. konnte dann ein König werden, der sich selbst als groß und als Sonne am politischen Firmament sah und dem von anderen eine herausragende Rolle in der Geschichte zugestanden wurde und wird.

Ludwig XIII., der Vater Ludwigs XIV., starb bereits 1643 und hinterließ den Thron seinem erst vierjährigen Sohn.
Die Herausforderungen, vor denen Frankreich stand, waren in ganz Europa ähnlich: der Wandel der mittelalterlichen ständischen Gesellschaft mit einer wachsenden Bedeutung des handel- und gewerbetreibenden Bürgertums und anderer Funktionseliten; die Verdichtung des modernen Staates mit einem Anwachsen der Bürokratie und der Durchdringung sowie auch Vereinheitlichung des Herrschaftsraumes; ein enormer Geldbedarf, der zunächst aus der Kriegsintensität der Epoche resultierte, aber auch eine langfristige Folge des wachsenden Staates mit wachsenden Staatsaufgaben war; die Auseinandersetzungen um die politische Autorität zwischen dem Monarchen und verschiedenen gesellschaftlichen Einflussgruppen; die konfessionelle Spaltung; die kleine Eiszeit, die in Europa im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte und zu Ernteausfällen und sonstigen klimabedingten Auswirkungen auf die Gesellschaft führte.
Frankreich auf dem Weg in die Moderne
Auch wenn die konkreten Bevölkerungszahlen unsicher sind und sich während der langen Herrschaftszeit Ludwigs XIV. durch demographischen Wandel und territoriale Zugewinne veränderten, so hat sich doch die mit Pierre Gouberts Klassiker zur französischen Alltagsgeschichte eingeführte Faustformel von »Ludwig XIV. und 20 Millionen Franzosen« bewährt.8 Frankreich war damit das bevölkerungsreichste Land Europas. Es hatte mehr Einwohner als das Heilige Römische Reich, als Polen-Litauen oder als Russland, die Frankreich alle an Fläche übertrafen. Frankreich war folglich dicht besiedelt, insbesondere gemessen an anderen Territorialstaaten. Dabei war das Land zu über 90 % agrarisch geprägt. Die hohe Bevölkerungszahl und Bevölkerungsdichte hatten Auswirkungen auf die Politik der französischen Krone: In Frankreich hatte der Modernisierungsprozess bedingt durch den Hundertjährigen Krieg (1337–1453) früher als in vielen anderen europäischen Herrschaftsgebieten begonnen. Frankreichs Entwicklung hin zu einem institutionalisierten, in seinen Verfassungsgrundlagen gefestigten, in ersten Ansätzen bereits nationalen Staat, der stetig steigende Steuern erhob, war darum am Beginn der Neuzeit vergleichsweise weit fortgeschritten. Die französischen Könige hatten ihre Autorität beständig ausbauen und zentralisieren können. Zwar stellten die Religionskriege in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts diese Entwicklung nochmals ernsthaft in Frage, mit den Bourbonen aber wurde sie konsequent wieder aufgegriffen und weitergeführt. Damit waren die französischen Könige nicht nur vielen anderen Herrschern in der Absicherung und der Durchsetzung ihrer Herrschaft voraus, sondern diese Dynamik hatte angesichts der Bevölkerungssituation in Frankreich auch wesentliche Auswirkungen auf ganz Europa: Wenn der französische König in seinem Herrschaftsgebiet Entscheidungen oder auch seine Sicht auf Politik und Gesellschaft durchsetzen konnte, so erreichte er damit bereits einen vergleichsweise hohen Anteil der europäischen Bevölkerung. Wenn er Steuern durchsetzte, so standen ihm quantitativ mehr Steuerzahler zur Verfügung als jedem anderen Herrscher. Diese Voraussetzungen trugen mit zur Bedeutung und zur Modellhaftigkeit Frankreichs in der Epoche Ludwigs XIV. bei, wobei das französische Modell aber immer auch mit anderen konkurrieren musste.9
Ludwig XIV. nutzte die Strukturen, die er vorfand, konsequent. Kardinal Mazarin, der Prinzipalminister und Ziehvater des jungen Königs, ließ bei seinem Tod 1661 ein nach Innen und Außen befriedetes, aufstrebendes Land zurück. Ludwig XIV. nahm die Zügel nun konsequent selbst in die Hand und trieb die Entwicklungstendenzen hin zu einer starken Krone, einer starken Dynastie und einem in Europa starken Frankreich ins Extrem. Er drängte damit sein Land in neue Konflikte. Hoffnungen auf eine Periode la...
Table of contents
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- 1 Ludwig – der Gottgegebene, der Große, der Sonnenkönig
- 2 Ein junger König zwischen Krieg und Frieden (1643–1661)
- 3 Die Sonne Frankreichs, die Sonne Europas: Ludwig XIV. erfindet sich selbst
- 4 Ein ständiges Streben nach Ruhm
- 5 Der Allerchristlichste König
- 6 Der Schrecken Europas
- 7 Der König stirbt
- 8 Ludwig XIV. und die Nachwelt
- Fazit
- Register