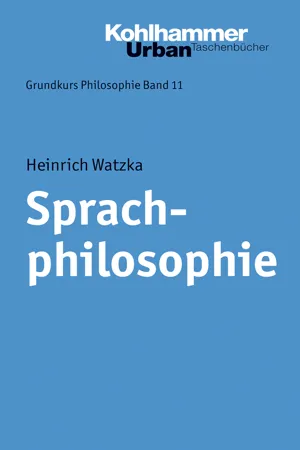![]()
1. Einführung
1.1 Die Anfänge einer Sprachreflexion im Abendland und ihr jähes Ende
Arno Borst beginnt sein monumentales Werk zur Geschichte der Meinungen über den Ursprung und die Vielfalt der Sprachen und Völker mit folgender Episode (Borst 1957, 3): Ein Mann aus Verona mit Namen Bonigrinus stand 1296 vor dem Inquisitionsgericht in Bologna, vor dem er als Anhänger der Irrlehre der Katharer angeklagt war. Das Verhör bestätigte diesen Verdacht. Bonigrinus gab an, dass der Teufel alles Irdische geschaffen habe, auch sei die Sintflut sein Werk gewesen. Völlig anders bewertete er den Turmbau zu Babel und das Ereignis der Sprachentrennung. Statt diese als Teufelswerk hinzustellen, plädierte er mit einem völlig unkatharischen Argument für die Gleichheit aller Sprachen und Religionen: „item dixit, quod sicut sunt LXXII linguae, ita sunt LXXII fides“, als ob die Teilung der Sprachen und Religionen in gleicher Weise göttlichem Ratschluss entspräche. Bonigrinus entpuppte sich als ein früher Vertreter einer pluralistischen Religionstheorie. Auffällig ist die Koppelung von sprachlicher Zugehörigkeit und religiöser Identität. Bonigrinus endete 1297 auf dem Scheiterhaufen.
Der Glaube an 72 Sprachen war fester Bestandteil der Sprachtheorie im Mittelalter. Borst fasst den Topos oder das Klischee wie folgt zusammen: „Gott schuf den Menschen und gab ihm die Sprache; diese Sprache deckte sich mit den Dingen genau; Gott redete mit Adam Hebräisch. Aus Adams Familie erwuchsen viele Stämme, die alle ein Volk mit einer Sprache blieben. Erst in Babel wurde durch den frevelhaften Turmbau die Einheit des Menschengeschlechts zerrissen; es entstanden durch Gottes wunderbares Eingreifen 72 Sprachen und 72 Völker, die alle mit der hebräischen Ursprache und Adams Volk verwandt waren und blieben. Von ihnen stammten die ‚heutigen‘ Sprachen und Völker unmittelbar ab, noch immer 72 an der Zahl. Bei der Sprachenteilung blieb es bis Pfingsten; seither ist die Differenzierung durch die göttliche Stiftung der Kirche, durch den Aposteln vom Heiligen Geist geschenkte Kenntnis aller Sprachen überwunden; die drei am Kreuz Christi angebrachten Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein sind zugleich als Bibelsprachen über alle anderen Idiome hinausgehoben und geheiligt. In ihnen werden sich die getrennten Völker versammeln, und am Ende der Zeiten werden alle Stämme dem Herrn im Himmel auf Hebräisch ihr Halleluja singen“ (Borst 1957, 6). Sämtliche der soeben aufgeführten Motive kommen in mittelalterlichen Texten wirklich vor, aber neben ihnen finden sich auch zahlreiche andere Spekulationen, so dass sich eigentlich nicht von einer einheitlichen Sprachtheorie im Mittelalter sprechen lässt. Die Zahl der Sprachen stand zu der Völkerzahl in eher lockerem Zusammenhang. Die Bedeutung der Ereignisse am Turm von Babel wurde kontrovers diskutiert. Über den Urzustand im Paradies waren widersprüchliche Hypothesen im Umlauf: ob Adams Sprache Hebräisch, Syrisch oder gar Deutsch war; ob Gott zu Adam in einer dieser Sprachen redete oder ob er die ‚Sprache‘ der Naturerscheinungen, Blitz, Donner, Wolke benutzte; ob er sich gar nicht vernehmlich äußerte, sondern durch Eingebung mit Adam kommunizierte. Nicht weniger vielfältig waren die Ansichten über Art und Zahl der heiligen Sprachen und die wiedergefundene Spracheinheit am Ende der Zeiten.
Was sagt die hebräische Bibel über den Anfang? Am Anfang sprach Gott: „Es werde Licht.“ Und es wurde Licht. Die Schöpfung hebt an als eine gewaltige Sprechhandlung Gottes. Erst durch das Aussprechen der Dinge erhalten diese ihr Sein und ihr Wesen. In Genesis 2,16 spricht Gott erstmals mit Adam, um ihm die Bewahrung und Nutznießung des Gartens (mit Ausnahme der Früchte des Baumes der Erkenntnis von ‚böse‘ und ‚gut‘) zu übertragen. In welcher Sprache redete Gott mit Adam? War es Hebräisch? Schon bei den Rabbinen beginnt der Streit über diese Frage und setzt sich über die Kirchenväter bis ins Mittelalter hinein fort. Auffällig ist, dass Gott nicht damit beginnt, aus dem Ackerboden die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels zu formen, bevor er mit Adam geredet hatte. Gott führte die untermenschliche Kreatur, die er aus Lehm herstellte, dem Adam zu, um zu sehen, wie er (Adam) sie benennen würde. Wie Adam jedes Lebewesen benennen würde, so sollte es heißen. Die Bibel weist Adam die Rolle des „Nomotheten oder Gesetzgebers“, d. h. des „ersten Schöpfers der Sprache“ zu, wie sie auch in der Mythologie anderer Kulturen nachweisbar ist (Eco 1994, 21). Die Bibel lässt es offen, auf welcher Grundlage Adam die Tiere benannte. Benannte er sie bei einem Namen, der ihnen auf der Grundlage eines „außersprachlichen Rechts“ zukam (ebd.), oder ging er bei der Namensgebung willkürlich vor? Hat Adam jedes Tier auf der Grundlage einer wesentlichen Bestimmung, seiner Natur benannt, oder begründete er mit der Benennung lediglich eine Konvention?
In
Genesis 2,22f. erblickt Adam die ihm zugedachte „Hilfe“, die „ihm entsprach“, was sich in der von Adam vorgenommenen Namensgebung ausdrückt: „Das ist doch nun endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch,
Männin soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen“, so in der Übersetzung Martin Luthers, der das hebräische
so übersetzt, um hörbar zu machen, dass es sich um das Feminin zu
handelt. In
Genesis 3,20 nennt Adam seine Frau „Eva“, was ‚Leben‘ oder ‚Mutter der Lebenden‘ bedeutet. Wir haben also zwei Fälle von „Benennungen nicht-willkürlicher Art“, in denen der Mensch die Sache mit ihrem „richtigen“ Namen benennt (Eco 1994, 22).
Die Frage des Nomotheten oder Gesetzgebers des Namens wird in Platons Dialog Kratylos, der ersten sprachphilosophischen Abhandlung im Abendland, explizit gestellt und unbeantwortet gelassen. Der Gesetzgeber könnte den Dingen einen Namen verliehen haben, der ihnen kraft ihrer Natur (φύσει) zukommt, er könnte mit der Benennung aber auch nichts weiter als eine Konvention begründet haben. In diesem Fall trügen die Dinge einen Namen, der ihnen aufgrund einer Übereinkunft (νόμῳ) zukomme. Der Fürsprecher der Konventionalitätsthese ist Hermogenes, die These von der natürlichen Richtigkeit der Namen wird Kratylos, nach dem der Dialog benannt ist, in den Mund gelegt. Sokrates zeigt sich im Dialog zunächst unentschieden. Er probiert es mit Etymologien, er diskutiert die These, dass der Name durch Lautnachahmung oder Lautmalerei (Onomatopöie) richtig benenne und gibt diese These der Lächerlichkeit preis, und hält dann mit der eigenen Position nicht länger hinter dem Berg, wonach die wahre Erkenntnis nicht von den Benennungen („Worten“), sondern von den Sachen selber auszugehen hat. Wenn es überhaupt eines ‚Nomotheten‘ bedarf, dann ist dieser kein andere als der in der Dialektik, d. h. an der am Wahren interessierten Unterredungskunst geschulte Philosoph. Platon schlägt einen dritten Weg zwischen der Konventionalitätsthese des Hermogenes und der These des Kratylos von der natürlichen Richtigkeit der Namen ein, womit er das Problem beiseiteschiebt. Die Sprache ist seither kein eigentliches Thema für die Philosophie des Abendlandes. Das zentrale Thema der Philosophie der Antike und des Mittelalters ist das Seiende, verstanden als Idee (Platon) oder als substanzielle Form (Aristoteles). Seit dem Spätmittelalter schiebt sich die erkenntniskritische Skepsis vor die Erkennbarkeit des so verstandenen Seienden. Die theoretische Philosophie der Neuzeit schlägt sich mit der Frage der Objektivität unserer Begriffe und der unerschütterlichen Fundamente unseres Wissens vor dem Hintergrund der universell gewordenen Skepsis herum, nicht mehr mit dem Seienden.
Literatur:
Eco 1994.
Kraus 1996.
Prechtl 1998.
Leiss 2009.
1.2 Denken in der Neuzeit
Die Tätigkeiten, die wir seit dem Beginn der Neuzeit „Denken“ nennen, untergliedern sich entsprechend des dreistufigen Schemas der damaligen Logik in die Handlungen des Begreifens (Begriffsbildung), des Urteilens und des Schließens. Die Trias liegt allen Logikbüchern der Epoche seit der Logik von Port-Royal von 1662 zugrunde (Arnauld/Nicole 1994). Noch Immanuel Kant unterteilt den ersten Hauptteil seiner Logik, die Allgemeine Elementarlehre, in die Abschnitte: (1.) „Von den Begriffen“, (2.) „Von den Urteilen“, (3.) „Von den Schlüssen“ (Kant 1977, 521ff.). Bei der Begriffsbildung geht unser Verstand induktiv vor, indem er die Phänomene vergleicht, Ähnlichkeiten feststellt und bestimmte Merkmale abstrahiert, die er in einem Begriff zusammenfasst. Der Begriff ist stets der Begriff eines Gegenstandes. Die basalste Form des Urteils ist die Subsumtion eines Gegenstands unter einen Begriff, z. B.:
Dieser [Mensch] ist weise.
Im Urteil lassen sich aber auch mehrere Begriffe von einem Gegenstand miteinander verknüpfen. Das Urteil ist demnach ein Verknüpfen oder Trennen der Begriffe von Gegenständen, d. h. eine Synthesis von Begriffen mit Blick auf Gegenstände, z. B.
Der Berg raucht.
Schwäne haben weißes Gefieder.
Nicht alle Menschen sind weise.
Ein Urteil kann wahr oder falsch sein. Werden Urteile in eine bestimmte Form gebracht, lassen sich aus Urteilen weitere Urteile ableiten, ohne dass die Wirklichkeit über die Wahrheit dieser Urteile befragt werden müsste. Die Wahrheit von Urteilen lässt sich also manchmal auch an der Form von Urteilen ablesen, z. B.
[Prämisse:] Alle Menschen sind sterblich.
[Prämisse:] Alle Athener sind Menschen.
[Konklusion:] Alle Athener sind sterblich.
Die in der Trias von Begriff, Urteil, Schluss zusammengefassten Verstandestätigkeiten sind keine sprachlichen Tätigkeiten. Begriff, Urteil, Schluss besitzen zwar Äquivalente in den natürlichen Sprachen – jedem Begriff entspricht idealerweise ein Prädikatswort in einer Sprache, der Verknüpfung von Subjekt und Prädikat im Satz entspricht die Synthesis der Begriffe von einem Gegenstand im Urteil, dem Schluss entspricht die Ableitung von wahren Urteilen aus wahren Urteilen –, aber die entsprechenden Verstandeshandlungen sind nicht wesentlich an die Verwendung von Sprachzeichen gekoppelt. Begriffe dürfen daher nicht mit den Prädikatswörtern einer Sprache, Urteile nicht mit Aussagen und Schlüsse nicht mit Ableitungen von Aussagen aus Aussagen verwechselt werden.
1.3 Die abgeleitete Intentionalität der Sprachzeichen
Was wir die Semantik von Sprachzeichen nennen – dass Wörter Bedeutung haben und für Gegenstände stehen, dass Aussagen wahr oder falsch sind –, gilt als ein Phänomen, das sich von der Tatsache herleitet, dass Menschen die Fähigkeit besitzen, eine Konvention der Art zu begründen, dass Typen von Lauten oder Schriftgebilden dazu benutzt werden können, den Inhalt von Urteilen auszudrücken und mitzuteilen. Die Erfindung des Geistes, mittels Laut- und/oder Schrifttypen Gedankeninhalte auszudrücken und mitzuteilen, nennen wir eine „Sprache“. Eine Sprache besteht, stark vereinfacht ausgedrückt, aus zwei endlichen Mengen: (1.) aus einem endlichen Vorrat an Zeichen, den Phonemen, die nicht weiter variiert, sondern zu Morphemen (Silben) und Lexemen (Wörtern) kombiniert werden; (2.) aus einer endlichen Menge von Verknüpfungsregeln (Syntax, Grammatik), die es erlauben, aus Wörtern Sätze zu bilden. Durch Flexion und Verknüpfung lassen sich immer komplexere Sätze bilden. Der Satz ist die grundlegende Einheit der Verständigung, d. h. mittels Sätzen, und nur mit ihnen, können wir einen Inhalt ausdrücken, d. h. etwas zu verstehen geben. Sätze können wahr oder falsch sein. Wörter haben Bedeutung, weil sie in Sätzen verwendet werden können, in denen wir etwas zum Ausdruck bringen, mit dem wir Wahrheit beanspruchen.
Von sich her haben die Laut- und/oder Schrifttypen, die im Verbund mit Verknüpfungsregeln eine Sprache konstituieren, keinerlei Bedeutung. Die Semantik der Sprachzeichen ist vielmehr von der Intentionalität des menschlichen Geistes entlehnt, d. h. von seiner Fähigkeit, Begriffe auszubilden, denen Gegenstände entsprechen, und mittels der Begriffe Urteile zu fällen, die mit Blick auf einen gegebenen Sachverhalt wahr oder falsch sein können. Der Begriff der Intentionalität, der das Vermögen des Geistes bestimmt, sich auf etwas zu beziehen, seien es reale oder nur vorgestellte Gegenstände, Eigenschaften oder Sachverhalte, geht in der modernen Diskussion auf den Philosophen und Psychologen Franz Brentano zurück (Brentano 1924). Der Sache nach ist das Phänomen seit der Antike bekannt.
Intentionalität im ursprünglichen Sinn kommt allem Anschein nach dem Geist allein zu, niemals den Sprachzeichen. Die Semantik jedweder Sprache wurzelt in der Intentionalität des Geistes von Denkerinnen und Denkern, welche Sprache haben. In der Reihenfolge der Erklärung hat die Erklärung der Intentionalität des Geistes Vorrang vor der Erklärung der Semantik der Sprachzeichen. Die Erklärung der Intentionalität des Geistes fällt in den Zuständigkeitsbereich der Philosophie des Geistes, die Erklärung der Semantik von sprachlichen Zeichen in die Zuständigkeit der Sprachphilosophie. Wenn der Erklärung der Intentionalität des Geistes gegenüber der Erklärung der Semantik einer Sprache der Vorrang ge...