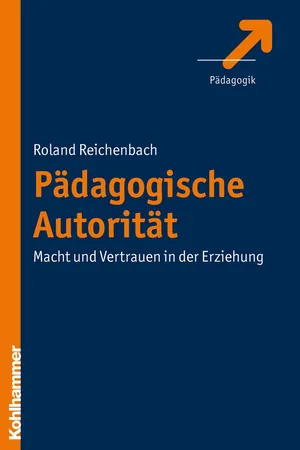![]()
1
Zur Einleitung: „Gerne
zeitlebens unmündig …?“
Geprägt von einem französisch-republikanischen Verständnis von Schule und Bildung werden im Folgenden Facetten eines Phänomens und damit verbundener Diskurse vorgestellt werden, das und die im deutschsprachigen Raum seit gut drei Jahrzehnten vorwiegend, aber nicht ausschließlich jenem politischen Lager überlassen wird, in welchem, wenn Fragen der Autorität im Raum stehen, eher der Gesichtspunkt der Disziplinierung (der Kinder, der Schülerinnen und Schüler, der Bürgerinnen und Bürger) als das Moment der Bewahrung progressiver Kultur (insbesondere des Rechts und der Rechte, der Moral und der Konventionen) interessiert. Zumindest implizit wird hier die angreifbare Meinung transportiert, wonach dem Fortschritt im Politischen und Ethischen sowie der Bildung und Bildungssysteme heute ironischerweise eher durch Konservierung und Schutz der kulturellen Errungenschaften gedient zu sein scheint, die es der Einzelperson und den Kollektiven ermöglichen, am Ideal und an der Illusion der individuellen bzw. kollektiven Selbstbestimmung festzuhalten. Bei der Sicherstellung dieser Leistung kommt der (Anerkennung der) Autorität der Kultur eine Schlüsselrolle zu, wobei diese Autorität wahrscheinlich weniger als Gegensatz zur demokratischen Staats- und Lebensform denn vielmehr als in ihrem Dienste stehend verstanden werden sollte. Damit sind Fragen nach dem Stellenwert des Gehorsams (und des – hier nicht weiter fokussierten – Glaubens) impliziert, die meist nur strittige Antworten nach sich ziehen.
Wenn von „Autorität“ die Rede ist, häufen sich regelmäßig die Missverständnisse, u. a. da zwischen 1. dem Konzept der autoritären Persönlichkeit (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford 1950; Seipel & Rippl 1999), 2. den autoritären Verhaltensweisen (vgl. schon Lewin, Lippitt & White 1939) und 3. der Anerkennung von Autorität(en) (vgl. Arendt 1994; Sofsky & Paris 1994) nicht oder nur ungenügend unterschieden wird. Wenn im Folgenden von Autorität gesprochen wird, dann – wenn nicht anders angegeben – vorwiegend im letzteren Sinn. Dabei fungiert Autorität nicht als Merkmal der Persönlichkeit oder als Verhaltensdisposition eines Individuums, sondern bezeichnet vielmehr ein asymmetrisches, aber letztlich wechselseitiges Anerkennungsverhältnis. Es handelt sich also um ein Merkmal einer Beziehung zwischen Einzelpersonen oder zwischen Personen und kulturellen Entitäten.
1.1 Faulheit und Feigheit
„Faulheit und Feigheit“ sind nach Immanuel Kant die Ursachen, „warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (…), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben“ (Kant 1783/1974, S. 9). Das sind herrlich kräftige Worte und man meint sie gleich mögen und für wahr halten zu müssen. Sie suggerieren, die meisten Menschen würden ohne die Laster der Faulheit und der Feigheit im Grunde immer und unbedingt für Mündigkeit votieren. Gesetzt den Fall, wir wüssten, was unter „Mündigkeit“ in einem nicht-legalistischen Sinn verstanden wird: Was könnte das Motiv sein, Mündigkeit als normaler Einzel- und Bedürfnismensch ohne supererogatorische Ambitionen für so wünschenswert zu halten? Etwa die Annahme, dass die Konsequenzen der Anerkennung fremder Leitung immer, meist oder zumindest manchmal negativ zu beurteilen wären? Und vielleicht umgekehrt die Konsequenzen von selbständigem Handeln und Urteilen (Selbstleitung) so positiv?
Sich nicht von fremder Leitung freizusprechen, dafür sprechen neben Faulheit und Feigheit, und, weniger lasterhaft: dem Bedürfnis nach Sicherheit, mitunter auch Gründe der Klugheit, der Bescheidenheit und womöglich sogar der Selbsterkenntnis. Da aber der Gehorsam einen ausgesprochen schlechten Ruf hat (vgl. z.B. Gruen 2002, 2010), obwohl es ohne ihn in der einen oder anderen Weise und in vielerlei Hinsicht – nicht nur der pädagogischen – ja gar nicht geht, war es überzeugend, Mündigkeit als Telos vernünftiger und natürlicher Bildung zu verstehen: der mündige Mensch unterwirft sich nur den Maximen der selbstgesetzgebenden Vernunft, also letztlich nur sich selber. Vom Pathos dieser emanzipatorischen Hybris, die m.E. immer noch wesentlich mehr Sympathiewerte verdient als ihr im zeitgenössischen Oberflächenrealismus zugestanden werden kann, ist heute freilich nicht mehr viel zu merken. Geblieben ist allein der schlechte Ruf des Gehorsams. Diesen verbessern zu wollen, ist eine vielleicht wichtige, aber delikate Angelegenheit, bei der man sich die Hände fast sicher schmutzig macht. Nun lautet die treffende Frage nicht schmutzige oder reine Hände, sondern – um es à la mode de Jean-Paul Sartre (1989) zu sagen – schmutzige oder keine Hände. Wirkungslose Kommentare mögen zwar das kleinere Übel sein als unkontrollierte Weltveränderung, und die Pflicht zur besseren Interpretation der Welt jener zur Verbesserung der Welt zunächst vorausgehen, aber stören tut es doch, nichts zu bewegen und verändern und von so vielem bewegt und verändert zu werden. Gibt es also neben dem dumpfen Gehorsam, der in die Barbarei geführt hat, nicht auch eine Kultur des Gehorchens, die nichts Barbarisches oder Kriecherisches an sich hat? Könnte es nicht zumindest in Spezial- und Einzelfällen eine großzügige und stolze Geste sein, sich „fremder Leitung“ zu unterwerfen? Wenigstens dem Scheine nach? Könnte es nicht gerade ein Ausdruck von Autonomie sein, bestimmte Autoritäten als die richtigen und legitimen anzuerkennen, wie Raatzsch (2007) kürzlich analysierte?
Während die Bedeutung des politischen und moralischen Urteilsvermögens unterschätzt werden mag, ist eine gewisse Sympathie mit Harry Frankfurts Sichtweise m. E. nun schwer abzuwenden, wenn er schreibt: „Wir müssen moralische Fragestellungen ernst nehmen, das bedarf kaum einer Erwähnung. Dennoch denke ich, dass die Relevanz, die der Moral für unsere Lebensführung zukommt, tendenziell überbewertet wird. Die Moral ist weniger einschlägig für die Bildung unserer Präferenzen und die Orientierung unseres Verhaltens, sie gibt uns weniger Auskunft über die Fragen, was wir schätzen und wie wir leben sollen, als man gemeinhin annimmt. Außerdem kommt ihr nicht so viel Autorität zu, wie man meint. Selbst wenn sie Wichtiges mitzuteilen hat, hat sie nicht notwendigerweise das letzte Wort“ (Frankfurt 2005, S. 10). Während es eine (vielleicht kaum zu fassende) moralische Kultur gibt, so ist Kultur doch stets sehr viel mehr als Moral. Die Autorität der Moral steht auch nicht über der Autorität der Kultur, da die erstere nur als Teilaspekt der letzteren repräsentierbar ist. Wenn Moral nicht notwendigerweise das letzte Wort hat, so hat Kultur vielleicht doch das vorletzte. Wer oder was aber das letzte Wort hat, darüber wissen wir nichts – und wohl sollte man nicht so klug werden, dass man schließlich so dumm wird, es wissen zu meinen. Daran ändert auch die Analyse der „Grundlosigkeit“ bzw. des „mystischen Grundes“ der Autorität nicht viel (vgl. Derrida 1991; Wimmer 2009).
Kurz: vorletzte Worte sollte man gelten lassen. Wobei „gelten lassen“ hier vielleicht so viel heißen mag wie „zumindest dem äußeren Anschein nach akzeptieren“. Mehr soll man, wenigstens aus einer gesellschaftlichen und republikanischen Perspektive betrachtet, von den Menschen nicht verlangen: es ist unrealistisch, unanständig und zeitweilig sogar gefährlich. Ohne Scheinunterwerfungsleistungen und -gesten geht es vor allem im Alltag überhaupt nicht; das heißt, es geht schon, aber das soziale Leben ist dann noch unangenehmer, als es eh schon häufig ist. Sitte, Konvention und Anstand mögen bieder und bürgerlich anmuten, aber sie stehen wenigstens dem Mythos der Authentizität fern. Da über die destruktiven Seiten der offenen Kommunikation meist nicht gerade tiefschürfend nachgedacht wird, hält sich das Ideal einer offenen und nicht-strategischen Gesellschaft in der einen oder anderen Variante (politisch, moralisch, pädagogisch) unverdient am Leben. Doch Illusion, Täuschung und Betrug sind die Ingredienzien nicht nur der modernen, sondern überhaupt von Gesellschaft. Eine Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an „ärgerlichen Tatsachen“ (Dahrendorf) kann deshalb auch nicht geschätzt oder gar geliebt, sondern höchstens ertragen werden. Aber die unzähligen, eitlen und unwahrhaftigen Erscheinungsweisen der Menschen machen das Leben insgesamt angenehmer, oft schöner und immer wieder freundlicher. Wenn Kant in seiner Anthropologie schreibt, „Kleidung, deren Farbe zum Gesicht vorteilhaft absticht, ist Illusion; Schminke aber Betrug. Durch die erstere wird man verleitet, durch die letztere geäfft“ (Kant 1977, S. 441), so ist er doch weder gegen die Illusion vorteilhafter Kleidung noch gegen den Betrug der Schminke. Gerade Kant sicher nicht (vgl. Manthey 2005)!
1.2 Autorität und Tradierung der Kultur
Die Hauptaufgabe von Erziehung und Unterricht ist die Tradierung von Kultur (im weitesten Sinne). Diese elementare Bestimmung wird mit manchen pädagogischen und/oder didaktischen Moden allzu schnell ignoriert. Lieber möchte man die Kinder für eine Zukunft fit machen, von der man gleichzeitig behauptet, man kenne sie nicht. Dass dies eine eigenartige Pädagogik sein muss, fällt schon gar nicht mehr auf. Auch und gerade der Kompetenzdiskurs hilft dabei, die Löcher des Sinns und Zwecks von Schule zu kaschieren, die wohl auch fehlendem Nachdenken geschuldet sind. Man muss vielleicht nicht unbedingt wissen, wohin die Reise faktisch geht, aber pädagogisch und politisch wenigstens, wohin sie gehen sollte. Wer sich mit der Geschichte der Zukunft (Noack 1996) beschäftigt, also mit der Frage, was Zukunft für andere Kulturen und vor allem für die Menschen in anderen Epochen bedeutet hat, mag erahnen, wie fahrlässig die Rede des „Bruches“ mit der Vergangenheit und von der sogenannten „offenen Zukunft“, die man sich einzugestehen habe, für die Pädagogik der Moderne auch sein kann. Der Sinn der Schule und der vielen sozialen Praxen, die wir in ihr, aber auch außerhalb von ihr erlernen, ist ja gerade, ein möglichst verbindliches – und auch sozial verbindendes – Band zwischen Vergangenheit und Zukunft für die Schüler/innen und die Gesellschaft im Ganzen darzustellen. Doch es kann immer nur Überliefertes, Bekanntes und Bewährtes gelehrt werden, nur „altes“ Neues, jedenfalls nicht das Unbekannte und zukünftig Neue. Alles andere widerspiegelt einen „ethnocentrisme de l’actuel“, wie Finkielkraut (1999) einmal formulierte, da der ausschließliche Gegenwartsbezug als eine Form des Ethnozentrismus gesehen werden kann – gegenüber den Toten und den noch Ungeborenen (vgl. Margalit 2000).
Wir haben es hier implizit mit der Frage der Autorität zu tun, mit Formen der horizontalen Autorität, um genauer zu sein, d. h. etwa der Autorität der Vergangenheit, der Tradition, der Religion, des Rituals, des Bildungskanons und vor allem der Sprache, kurz: der Kultur, die wir zunächst – als „Neuankömmlinge“ in der Welt der Menschen, als „Immigranten“, wie Arendt einmal formulierte – erlernen müssen: ungefragt und alternativlos! Diese horizontale Autorität ist aber auch in die Zukunft verlängert: die Autorität der Zukunft, des Projekts, des Fortschritts, des Versprechens und des Vertrages (vgl. Kojève 2004; Meirieu 2005; Revault d’Allones 2005; Steiner 2005). Scheinbar emanzipiert von den vertikalen Autoritäten, von Gott, Kirche, Militär und Staat, oder wenigstens von ihren personalen Erscheinungen, gibt es anonyme horizontale Autoritäten (vgl. Hunyadi 2005) – das Geld, der Markt, die Erfolgs- und Schönheitsideale, die Medien etc. –, denen sich breite Teile der Gesellschaft vermeintlich umstandslos unterwerfen, während die Schule, weil sie sich der Herkunft-Zukunfts-Dimension nicht mehr sicher zu sein scheint – hilflos und manchmal peinlich, manchmal aber auch dynamisch und zuversichtlich –, sich immer anzupassen versucht an die sich verändernde Welt. Die Halbwertszeit des Wissens würde sich rasant verringern, heißt es dann, das Wissen sich explosionsartig vermehren und wir in einer Gesellschaft leben, die man am besten als Wissensgesellschaft bezeichnen würde. Davon merkt man aber meist nicht gerade sehr viel.
Nun ist es pädagogisch (aber nicht nur pädagogisch) bedeutsam, dass die symbolische Welt ihrerseits zumindest ontogenetisch zunächst personal repräsentiert wird. Die Anerkennung einer Person als Autorität impliziert im Bereich des Verhaltens Gehorsam und im Bereich des Wissens Glauben. Obwohl diese Leistungen (Gehorsam und Glauben) elementar für die pädagogische Situation und fundamental für das Kindsein sind (vgl. Damon 1984), wird Autorität auch von Erziehungswissenschaftlern wie vielen anderen vor allem als Gegensatz zu Freiheit, Demokratie und Autonomie begriffen. Dies ist nicht unbedingt einsichtig, weil 1. ein Wegfall von Autorität individuelle und kollektive Freiheitsspielräume weder notwendigerweise vergrößert noch sichert (vgl. Arendt 1994). 2. Ebenso muss die radikale Ablehnung von Autorität kein Ausdruck der Befreiung von derselben darstellen, sondern kann gerade ein Ausdruck einer speziellen (negativen) Bindung an dieselbe sein („Ablehnungsbindung“, vgl. Sennett 1985). 3. Die Sicht, wonach jeder Gehorsam pathologisch ist (vgl. Gruen 2002), scheint humanistisch und romantisch motiviert, ist aber vielleicht selber als Zeichen der Hyperpathologisierung zu verstehen. Schließlich 4. stellen die Konzepte Autorität und Autonomie keine logischen oder empirisch evidenten Gegensätze dar (vgl. Raatzsch 2007).
Der Wegfall oder die Schwächung von „vertikalen“ – d. h. personalen, sozialen oder transzendenten – Autoritäten in den Bereichen Politik, Religion, Recht, Schule und Familie u. a. hat manchen Autoren zufolge mit der Unfähigkeit der älteren Generation zu tun, der jüngeren begrüßenswerte Zukunft noch glaubhaft versprechen zu können (vgl. Revault d’Allonnes 2005, 2006), d.h. also auch mit der „Offenheit“ der Zukunft. Die Schwächung der temporalen Dimension von Autorität ist demzufolge nicht nur in Bezug auf die Vergangenheit zu diagnostizieren – z.B. als Traditionsverlust –, sondern auch als „Zukunftsverlust“, was die Legitimität von Autorität(en) noch deutlicher in Frage stellt. Ihre Schwächung hilft der Etablierung von „horizontalen“, d. h. mehr oder weniger anonymen „Autoritäten“ (vgl. Steiner 2005).
Eine sich republikanischen Idealen verpflichtet sehende Schule trägt das Selbstverständnis der Autorität der Tradition, des Wissens und der Sprache (Kultur) mit wenig Irritation in sich bzw. in ihren wichtigsten Repräsentanten, den Lehrpersonen. Die Ordnung und Objektivität, die sie verkörpert, birgt auch Potentiale für die Bedürfnisse des Kindes bzw. der Schülerinnen und Schüler nach Sicherheit und nach Weltlichkeit. Kinder sind überhaupt nicht esoterisch motiviert, sondern vielmehr exoterisch. Eine Schule andererseits, deren Lehrpersonen vor allem die persönliche Beziehung und die schulische Gemeinschaft und Gemeinschaftlichkeit in den Mittelpunkt stellt, birgt andere Potentiale und Probleme. Zu ihren Stärken gehört sicher der Fokus auf diskursive Verfahren und argumentative Auseinandersetzung, wo sie möglich sind. Was aber tatsächlich als Wirkungsfolgen von unterschiedlich gearteten Schulen hinsichtlich solcher Dimensionen valide behauptet werden kann, wird wenig sein. So müssten die jungen Französinnen und Franzosen aus Sicht einer uninformierten deutschsprachigen Pädagogik die Schule ziemlich eingeschüchtert, angepasst und wenig selbstbewusst verlassen. Aus einer entsprechend uniformierten französischen Perspektive müssten die jungen Deutschen ihre Schule vergleichsweise als undisziplinierte Egoisten und Chaoten verlassen, wären denn solche Wirkungen der insgesamt relativ dramatisch anmutenden schulpädagogischen Unterschiede überhaupt nachweisbar. Doch beides scheint insgesamt nicht ...