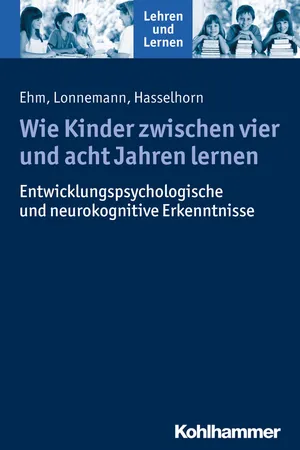![]()
1 Auffassungen von Lernen und inhaltliche Schwerpunkte dieses Buches
Das Lernen im Vorschul- und frühen Schulalter ist äußerst vielfältig. Es reicht vom Erlernen des Fahrradfahrens, dem Aneignen einer Sprache und dem Erwerb des Lesens und Schreibens über die Herausbildung von Vorlieben bzw. Abneigungen (z. B. für Pferde oder Dinosaurier) und die Übernahme möglicher Vorurteile (z. B. »Jungen können besser Rechnen«) sowie die Ausprägung von Angewohnheiten (z. B. Fingernägelkauen) bis hin zur Erkenntnis, dass man manches lieber nicht wiederholen sollte (z. B. eine heiße Herdplatte berühren). Allein die Aufzählung dieser Beispiele macht deutlich, dass Lernen ganz unterschiedliche Bereiche betrifft (z. B. den motorischen oder den sprachlichen Bereich), auf ganz unterschiedliche Weise zustande kommt (z. B. bewusst vs. beiläufig) und dass Lernprozesse von unterschiedlicher Dauer sein können (einmalige Erfahrung vs. langwieriger Prozess).
Kinder unterscheiden sich in ihrer Lernaktivität und in ihrem Lernerfolg. Es zeigen sich also sog. interindividuelle Differenzen zwischen gleichaltrigen Kindern. Bei einem einzelnen Kind lässt sich zudem beobachten, dass es nicht immer gleich erfolgreich in seinen Lernbemühungen ist und ihm das Lernen in manchen Bereichen leichter, in anderen hingegen schwerer fällt. Hier spricht man von sog. intraindividuellen Schwankungen oder Unterschieden. Hinzu kommen solche intraindividuellen Veränderungen, die zur Folge haben, dass sich das Lernen bzw. Lernmöglichkeiten mit zunehmenden Alter auch qualitativ verändert. Warum sich Kinder in ihrer Lernaktivität und im Lernerfolg unterschieden, warum ihnen das Lernen in manchen Bereichen leichter fällt als in anderen und wie sich ganz allgemein die Lernmöglichkeiten zwischen vier und acht Jahren verändern, soll im Verlauf dieses Buches immer wieder thematisiert werden. Doch zunächst wollen wir uns der Frage widmen, was Lernen überhaupt ist. Wann sprechen wir davon, dass jemand etwas gelernt hat? Hierüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Dennoch lässt sich auf einer allgemeinen Ebene eine einheitliche Vorstellung, d. h. ein definitorischer Kern von Lernen, identifizieren.
Definition
Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial einer Person als Folge von Erfahrungen kommt.
Warum ist hierbei jedoch nicht von Verhalten, sondern von Verhaltenspotenzial die Rede? Von Potenzial wird gesprochen, weil sich das Produkt des Lernens, also das Lernergebnis, nicht notwendigerweise unmittelbar in einem konkret beobachtbaren Verhalten niederschlagen muss. So werden z. B. englische Vokabeln vielleicht nicht direkt im Unterricht, sondern erst bei einem Schüleraustausch ein erstes Mal verwendet. Das Gelernte kann sich also auch erst in zukünftigen Handlungen oder Verhaltensweisen zeigen.
Aber ist Lernen tatsächlich nur die Folge von Erfahrungen? Wie sieht es mit Erkenntnissen aus, die durch Nachdenken erlangt werden? Natürlich kann eine Erkenntnis auch ohne eine unmittelbar vorausgehende Erfahrung entstehen. Ohne jegliche Erfahrungen ist dies jedoch nicht möglich. Damit unterscheidet sich der Prozess des Lernens auch von anderen Mechanismen menschlicher Verhaltensänderungen, wie z. B. Reifungsprozessen, die nicht an Erfahrungen gebunden sind.
1.1 Auffassungen von Lernen
Darüber, was genau Lernprozesse ausmacht, wie eine überdauernde Änderung von Verhaltenspotenzialen charakterisiert ist und welche Art von Erfahrungen geeignet ist, um einen Lernprozess auszulösen, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Mit anderen Worten: Es gibt unterschiedliche Lerntheorien. Diese haben sich über die Zeit hinweg deutlich geändert. Die Psychologie des Lernens hat sozusagen in den vergangenen Jahrzehnten selbst einen Lern- und Entwicklungsprozess durchlaufen (Oberauer, 2007; Siegler, 2005). Bis in die 1960er Jahre hinein waren behavioristische Lerntheorien vorherrschend. Im Behaviorismus wurde das Verhalten (behavior) in Abhängigkeit von erfahrenen oder zu erwartenden Konsequenzen untersucht, geistige Vorgänge wurden nicht betrachtet. Im Zuge der sog. kognitiven Wende gerieten daraufhin die inneren (kognitiven) Prozesse, die an Lernprozessen beteiligt sind, stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. So ist das Lernen nach den sozial-kognitiven Theorien abhängig von individuellen kognitiven Voraussetzungen und individuell erfahrenen Umweltgegebenheiten. Beispielsweise beruht das Modelllernen auf der Annahme, dass Kinder auch durch Beobachtung anderer lernen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das Gesehene aufmerksam verarbeitet und im Gedächtnis gespeichert werden kann. Informationsverarbeitungstheorien konzentrierten sich in der Folge vor allem auf die dem Lernen zugrunde liegenden Mechanismen und die dafür notwendigen kognitiven Voraussetzungen und Kapazitäten, wie z. B. Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Schließlich stellten konstruktivistische Lerntheorien die Lernenden selbst in das Zentrum ihrer Betrachtungen, betonten die Zusammenarbeit mehrerer Individuen und beschrieben Lernen als aktiv zu erbringende Leistung, die gemeinsam innerhalb oder außerhalb pädagogischer Kontexte durch Individuen erbracht wird.
Aber warum sollte man sich mit den unterschiedlichen Theorien näher beschäftigen? Sind sie nicht recht abstrakt und haben damit, wie Lernen wirklich abläuft, nichts zu tun? Dies scheint nur auf den ersten Blick so. Denn betrachtet man die unterschiedlichen Auffassungen des Lernens, so hilft dies, Lernprozesse besser zu verstehen und schließlich einschätzen zu können, welche Faktoren beim Lernen besonders bedeutsam sind. Lerntheorien bilden demnach so etwas wie die Basis für das Verständnis von Lernprozessen. Dabei hat jede Lerntheorie ihren besonderen Fokus und auch (historischen) Verdienst. Daher skizzieren wir im Folgenden die Kernannahmen der wichtigsten Lerntheorien.
Behaviorismus
Die Theorie des Behaviorismus kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. In Reaktion auf die psychoanalytische Schule mit ihren empirisch kaum prüfbaren Annahmen legte der Behaviorismus den Fokus darauf, Verhalten mit rein naturwissenschaftlichen Methoden zu erklären. So wurden nur direkt beobachtbare Ereignisse zur Erklärung von Verhalten und Verhaltensänderungen herangezogen. Als Metapher für sämtliche psychische/kognitive Prozesse, die sich (noch) nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden objektiv messen, beschreiben und reproduzieren ließen, diente die sog. Black-Box. Also ein schwarzer Kasten, der zwar Eingang und Ausgang besitzt und in dem psychische Prozesse ablaufen, dessen Innenleben für Behavioristen jedoch als nicht beobachtbar galt und daher als uninteressant eingestuft wurde.
Kern des Behaviorismus sind zwei Lernprinzipien: das klassische Konditionieren und das operante Konditionieren (auch: instrumentelles Konditionieren bzw. Lernen durch Konsequenzen). Beide basieren auf dem Prinzip des Lernens durch Assoziationsbildung. Hiernach kann ein Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen dann gelernt werden, wenn diese miteinander assoziiert werden. Die Assoziationen bilden sich jedoch bei der klassischen und operanten Konditionierung auf ganz unterschiedliche Weise.
Klassische Konditionierung
Bahnbrechend für die klassische Konditionierung war eine zufällige Beobachtung des russischen Physiologen Iwan Pawlow (1849–1936). Dieser hatte im Rahmen seiner Untersuchungen zu Verdauungsprozessen bei Hunden die Feststellung gemacht, dass Hunde bereits ohne die direkte Darbietung von Futter mit Speichelfluss reagierten. Genauer: Sie zeigten bereits dann Speichelfluss, sobald sie einen Glockenton hörten, der die Fütterung ankündigte. Mit dem Glockenton assoziierten Hunde also das Futter, was zu einer Reaktion, dem Speichelfluss führte. Diese Reaktion stellt somit eine gelernte – konditionierte – Reaktion dar. Beim klassischen Konditionieren wird also eine bereits im Verhaltensrepertoire vorhandene Reaktion auf bestimmte Reize auf einen anderen, neuartigen Reiz transferiert. Dabei werden drei Phasen unterschieden: Vor der Konditionierung führt ein unkonditionierter, physiologischer Stimulus (hier das Futter), zu einer unkonditionierten Reaktion (Speichelfluss). In der Konditionierungsphase wird durch das Hinzufügen eines neutralen Stimulus (Glockenton) direkt vor der Präsentation des unkonditionierten Stimulus (Futter) der zuvor neutrale Stimulus durch Assoziation zu einem konditionierten Stimulus (Glockenton), auf den eine Reaktion erfolgt. Nach der Konditionierung reicht die alleinige Präsentation des konditionierten Stimulus (Glockenton) aus, um die konditionierte Reaktion (Speichelfluss) hervorzurufen.
Eine Assoziation zwischen zwei Reizen bildet sich leichter, wenn die Reize zeitlich und räumlich nah beieinander liegen, also Kontiguität vorhanden ist. In manchen Fällen kommt es jedoch auch zu einer Konditionierung, wenn mehrere Stunden zwischen den beiden Reizen liegen (z. B. die Assoziation einer Übelkeitsreaktion mit dem Essen des Vorabends). Neben der Kontiguität ist vor allem die Kontingenz zwischen zwei Reizen entscheidend für die Konditionierung: Eine konditionierte Reaktion (z. B. Speichelfluss) auf einen neutralen Stimulus (z. B. Glockenton) wird nur dann ausgebildet, wenn der neutrale Stimulus das Auftreten des unkonditionierten Stimulus (z. B. Futter) zuverlässig vorhersagt, also signalisiert.
Reizgeneralisierung und -diskrimination. Eine einmal gelernte Verbindung kann auch auf ähnliche Reize übertragen werden. So zeigte sich bei konsequenter Paarung von Glockenton und Futter, dass Hunde in der Folge auch auf andere Geräusche, wie z. B. Pfeifen, mit Speichelfluss reagierten. Ein ethisch sehr bedenklicher Nachweis dieser Reizgeneralisierung gelang John B. Watson um 1920. Er kombinierte beim kleinen Albert das Berühren einer weißen Ratte mit dem Ertönen eines lauten und angsteinflößenden Tons. Daraufhin zeigte Albert nicht nur beim Anblick der Ratte, sondern auch bei ähnlichen Reizen, wie beispielsweise dem Fell eines Hasen, Baumwollbüscheln oder weißen Bärten, Angstreaktionen. Bei der Reizgeneralisierung fallen die Reaktionen umso stärker aus, je ähnlicher sich die Reize sind. Das konzeptuelle Gegenstück zur Reizgeneralisierung ist die Diskrimination (Unterscheidung). Beispielsweise sind Hunde in der Lage zu lernen, nur auf spezifische akustische Reize, aber nicht auf andere Geräusche mit Speichelfluss zu reagieren.
Extinktion und Spontanerholung. Erhält ein Hund nach dem Ertönen der Glocke für längere Zeit kein Futter, dann wird irgendwann der Speichelfluss ausbleiben. Dieses Abschwächen der konditionierten Reaktion durch wiederholte Abwesenheit des unkonditionierten Reizes (Futter) wird als Extinktion bezeichnet. Der konditionierte Reiz wird dabei wieder zum neutralen Reiz und die Assoziation mit dem Futter geschwächt, also im gewissen Sinne verlernt. Reiz-Reaktions-Verbindungen können jedoch auch spontan wieder auftreten, wenn auch meist mit geringerer Intensität und kürzerer Dauer. In einem solchen Fall spricht man von Spontanerholung.
Fokus: Statistisches Lernen
Das Prinzip des Lernens durch Assoziationsbildung liegt auch anderen lerntheoretischen Ansätzen zugrunde, wie z. B. dem sog. statistischen Lernen. Durch die bloße Aufnahme von Informationen aus unserer Umwelt sind wir in der Lage einzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis auf ein anderes folgt. Dies wird als statistisches Lernen bezeichnet (siehe z. B. Saffran, Aslin & Newport, 1996). So assoziieren wir Reize, die in einem statistisch vorhersagbaren Muster auftreten. Da viele Ereignisse in unserer Umgebung, z. B. die Abfolge von Sprachlauten oder von motorischen Handlungen, in vorhersehbarer Reihenfolge verlaufen, ermöglicht statistisches Lernen, derartige Abfolgen zu antizipieren und nachzuahmen. Das statistische Lernen wurde in verschiedenen Bereichen untersucht (z. B. Musik oder Motorik) und scheint insbesondere beim Spracherwerb eine wichtige Rolle zu spielen (siehe z. B. Breitenstein & Knecht, 2003, für einen Überblick). Experimentelle Studien zeigen z. B., dass Kinder im Grundschulalter in der Lage sind, das Regelwerk einer einfachen künstlichen Grammatik basierend auf der Häufigkeit verschiedener Wortfolgen zu erlernen, ohne bewusst Aufmerksamkeit aufzuwenden.
Operante Konditionierung
Gelernte unwillkürliche Reaktionen (wie z. B. Speichelfluss oder Angst) lassen sich durch die klassische Konditionierung sehr gut erklären. Obwohl viele Forschungsarbeiten zum Konditionieren in Tierversuchen durchgeführt wurden, gilt auch bei uns Menschen: Unser Verhalten wird häufiger als uns bewusst ist, durch einfaches Assoziationslernen gesteuert. Manchmal lösen Düfte wohlige Gefühle ins uns aus, weil wir sie mit schönen Momenten verbinden, andere Gerüche hingegen ungute Gefühle, ja bisweilen sogar Ängste, da wir sie in emotional belastenden Situationen wahrgenommen haben. Wie aber werden Verhaltensweisen erlernt, die nicht auf einer angeborenen, unkonditionierten Reiz-Reaktions-Verbindung basieren, wie beispielsweise die Erledigung der Hausaufgaben oder das häufige Zuspätkommen zu einer Verabredung? Anders gefragt: Was kann man tun, um die A...