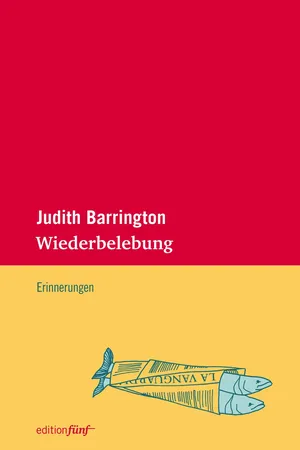![]() Erster Teil
Erster Teil![]()
Kein Entkommen
Hubschrauber kreisten über dem Schiff, aber angesichts der Hitze und der dichten Rauchschwaden konnten sie nicht tief genug gehen, um jene hochzuziehen, die nach Ablegen aller Rettungsboote noch an Bord des Dampfers festsaßen. Rundum versammelte sich eine ganze Flotte von Schiffen, aber auch sie musste Distanz halten, weil das Wasser von Menschen wimmelte, die in lecken Booten herumtrieben, sich an Möbelstücke klammerten oder in Rettungswesten zwischen verkohlten Wrackteilen schwammen. Die Welt sah Fernsehbilder des Schiffs, dessen Rauchwolke wie ein Leichentuch über den Atlantik wehte, bis schließlich kurz vor Morgengrauen alle an Bord verbliebenen Passagiere über eine Strickleiter ins Meer hinabstiegen. Ein Schiff der britischen Marine barg die Leichen meiner Eltern, sie wurden nach Gibraltar gebracht und dort zusammen mit etwa einem Duzend weiterer britischer und deutscher Passagiere beigesetzt.
Einige Monate davor, im Herbst 1963, war ich von zu Hause ausgezogen in eine riesige Wohnung in Kensington, die ich mit drei anderen jungen Frauen teilte. Trotzdem fuhr ich fast jedes Wochenende nach Hause, und im Gepäck hatte ich neben meiner schmutzigen Wäsche auch diverse Geschichten über meine neue Stelle bei der BBC und einen explosionsartig wachsenden Kreis von Bekannten, die ich als Freunde bezeichnete. Ich spielte unabhängig sein, ein Spiel, das ich mit neunzehn noch nicht wirklich gut beherrschte, und meine Eltern schienen willens, mir Zeit zu lassen. Sie halfen mir aus der Klemme, wenn ich pleite war; sie holten mich Freitagabend vom Bahnhof ab und fuhren mich Sonntagabend wieder hin. Ich kehrte nach London zurück, erholt nach einem Wochenende mit viel Schlaf und richtigen Mahlzeiten – beides Seltenheiten in der Kensingtoner Wohnung.
Mein Bruder und meine Schwester, fünfzehn und elf Jahre älter als ich, hatten die Familienbande, auf die ich mich noch verließ, schon lange gekappt. Beide waren verheiratet und hatten kleine Kinder, und hin und wieder statteten sie meinen Eltern in Brighton einen Sonntagsbesuch ab, aber die zwei Familien kamen selten gleichzeitig. Große Familientreffen waren nicht unsere Sache, ich vermute, dass niemand allzu lange so viele kleine Kinder unter einem Dach haben wollte.
In jenem Winter hatte es Streit um die Frage gegeben, wo wir Weihnachten feiern sollten. Bisher hatte immer meine Mutter zu Truthahn und Christmas Pudding eingeladen, in jenem Jahr aber protestierte meine Schwester Ruth, oder vielleicht war es auch mein Bruder John, ich weiß es nicht mehr, dagegen, dass wir uns wieder bei unseren Eltern trafen. Es gab eine Reihe angespannter Telefongespräche, und schließlich verkündeten meine Eltern mit deutlich trotzigem Unterton, dass sie über Weihnachten verreisen würden (und also niemand auf sie Rücksicht nehmen müsse). Mir persönlich war das ziemlich egal. Der Dezember quoll förmlich über vor Partyeinladungen, einige von Leuten, deren Namen ich nicht einmal kannte, und ich wollte einfach so lange wie irgend möglich in London bleiben. So saß ich auch an Heiligabend in der Regent Street beim Friseur, als John mich aufspürte. Er rief an, um mir mitzuteilen, dass das Schiff in Flammen stehe.
Später fiel mir wieder ein, dass ich die Nachricht schon gelesen hatte, als ich auf dem Weg zu meinem Friseurtermin die Piccadilly entlanghetzte: »Kreuzfahrtschiff Lakonia in Flammen!« war auf die Reklametafeln der Evening Standard-Verkäufer gekritzelt, die die Information zudem im gelangweilten Singsang eines tausendmal wiederholten Slogans riefen. Ich hatte dem keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt, ich wusste ja nicht einmal, wie das Schiff hieß, das meine Eltern gebucht hatten.
»Welches Schiff?«, fragte ich deshalb dämlich.
»Das Kreuzfahrtschiff«, sagte er. Ich stand an der Theke des Friseursalons und blickte auf eine Vitrine voller Haarspraydosen. »Auf dem Ma und Pa sind. Komm heute Abend her, die anderen sind schon unterwegs.«
Wir verständigten uns darauf, einmal pro Stunde die Nummer der Greek Line anzurufen, wofür wir der Reihe nach in das stickige Kämmerchen unter der Treppe gingen, um die Tonbandaufnahme der Namen anzuhören. Derer, die man lebend aus dem Meer gezogen hatte. Und derer, die tot geborgen und identifiziert worden waren. Unter der Schräge, an die mit Bleistift Telefonnummern von Babysittern und Handwerkern gekritzelt waren, stand ich nun am kühlen Nachmittag in meinem ausgeleierten blauen Pullover und nachts im Flanell-Pyjama. Das Band begann nicht immer bei A: Sobald die Verbindung hergestellt war, kam man in das laufende Band hinein. Manchmal war es gerade bei C oder D, dann mussten wir das ganze Band bis B anhören, nur um herauszufinden, dass seit unserem letzten Anruf weder mein Vater noch meine Mutter hinzugefügt worden waren. In den Stunden dazwischen veranstalteten wir für die Kinder Weihnachten: Geschenke unterm Baum, Truthahn und Christmas Pudding, abends am 26. eine Weihnachtspantomime (vermutlich Dick Whittington und seine Katze), und während all dessen lief uns Erwachsenen unablässig die alphabetische Liste durch den Kopf, wie ein Mantra. Wenn wir zu den Nachrichten zusammenkamen und hörten, dass Unmengen schwarzen Rauchs aus dem Schiff quollen, witzelten wir, dass unser Vater, wenn es sonst nichts gab, ein Floß bauen würde. Einmal rief meine Schwester die Putzfrau meiner Eltern an und trug ihr auf, Decken zum Aufwärmen in den Trockenschrank zu legen.
An einem dieser Tage stand ich am Fenster des Gästezimmers und blickte auf den reifbedeckten Rasen, wo Spatzen sich um Kuchenreste zankten. Ich hörte die Tür aufgehen, John kam herein. Ich hörte, wie er sich räusperte und sagte: »Sie haben Pa gefunden. Ihn geborgen. Er ist tot.« Dann hörte ich, wie die Tür ins Schloss gezogen wurde, und wartete darauf, dass er zu mir kam. Ich fühlte mich kalt und weiß wie der Reif, aber irgendwo in mir flackerte etwas Warmes für meinen Bruder, ich sehnte mich danach, dass er bei mir war. Ich wollte mich an ihn lehnen. Mein Kopf sollte seine Schulter berühren.
Wenig später drehte ich mich um. Der Raum war leer. Das Geräusch der Tür, die sich schloss, war das Geräusch von John gewesen, der ging. Ich komme schon klar, hätte ich sicher gedacht, wenn Denken möglich gewesen wäre. Ich kann allein auf mich aufpassen. Aber mein Gehirn war eisig, und der kleine warme Fleck in mir erfroren.
Nach den Feiertagen kehrte ich in meine Wohnung und zu meiner Arbeit zurück. Es gab immer noch keine Nachricht von meiner Mutter, obwohl man viele Leichen geborgen hatte, die noch nicht identifiziert waren. Dabei handelte es sich vor allem um Frauen, die meisten Männer hatten eine Brieftasche dabei. John flog nach Gibraltar und entdeckte die Leiche meiner Mutter, er fuhr dorthin, ohne es mir zu sagen, und er organisierte auch, dass unsere Eltern dort beigesetzt wurden, auf dem Fels von Gibraltar. Hätte er mich gefragt, ich hätte vermutlich gesagt: »Es ist mir egal. Mach, was du für richtig hältst.«
An einem stürmischen Januartag kamen wir in einer kleinen Kirche in Patcham zusammen, meine Mutter hatte dort manchmal sonntagmorgens den Gottesdienst besucht. Es gab keine Särge, nur viele Menschen, die ernst dreinblickten, und meine weinende Schwester. Ich weinte nicht: Ich war noch immer am Fenster des Gästezimmers eingefroren. Ich weinte über ein Jahr lang nicht, dann gab es eine kleine Schmelze, auf die eine noch viel längere Eiszeit folgte. Es hallte in der Kirche, als wir Oh hear us when we cry to Thee for those in peril on the sea sangen – wegen seiner wunderbaren Melodie schon immer eins meiner liebsten Kirchenlieder. In meinen besten Mantel gewickelt, sang ich trotzig mit und überging Ruths unerwartetes Schluchzen.
Noch im Januar kam ein offiziell aussehender Brief, in den Umschlag war ein blaues Wappen geprägt. Er enthielt einen Brief des Kapitäns der Centaur, die die Leichen von Ma und Pa geborgen hatte. Er sprach mir sein Beileid aus und teilte mit, dass man uns in Kürze einige persönliche Gegenstände unserer Eltern zuschicken werde. »Ich dachte«, schrieb er weiter, »dass es für Sie sicherlich von Bedeutung ist zu wissen, dass die Armbanduhren Ihrer Eltern beide um 6 Uhr 12 stehen geblieben sind. Dies lässt den Schluss zu, dass sie gemeinsam ins Wasser hinabgestiegen sind.« Ich knüllte den Brief zusammen und warf ihn weg.
Ende März hatten Ruth und ich das Haus meiner Eltern leergeräumt und die Möbel verkauft. Ich hatte stoisch Hunderte von Kondolenzbriefen zur Kenntnis genommen und für eintausend Pfund auf mein Recht verzichtet, die Greek Line zu verklagen. Das alles erledigte ich mit roboterartiger Effizienz. Im April fing ich eine heimliche Beziehung mit einer Frau an und kündigte bei der BBC. Ich redete mit niemandem über irgendetwas Wichtiges; tatsächlich lernte ich sehr schnell hervorragend zu lügen. Im Mai bekam ich einen Sommerjob in Spanien angeboten, den ich annahm. Ich wollte weg, ich wollte raus aus England, um der Trauer zu entkommen, und fuhr doch genau dorthin, wo meine Eltern ihre glücklichsten Jahre miteinander verbracht hatten.
Meinen zwanzigsten Geburtstag feierte ich mit einem luxuriösen französischen Mittagessen im Garten eines Restaurants irgendwo in der windigen Ebene südlich von Narbonne, und zwar in Gesellschaft eines gut aussehenden Anhalters namens Tony. Nach Pâté, Salade Niçoise und gegrillter Forelle mit Basilikumfüllung holte ich einen Berg Geschenke aus dem Kofferraum meines Triumph Herald Cabrios, das ich gerade von meiner Mutter geerbt hatte. Während ich sie dort am Tisch öffnete und dazu das Papier aufriss, prostete Tony mir mit Champagner zu und sang zwischen den Geschenken jeweils das komplette Geburtstagslied. Heiße Windböen zerrten an der Papiertischdecke und erfassten ein Stückchen goldglänzendes Geschenkpapier, trieben es über die karge Landschaft, bis es an den Stacheln einer Kaktusfeige hängen blieb, wo es einen Moment zappelte, ehe es sich befreien konnte und weiterflog, um sich schließlich im verdrehten Stamm eines einsamen Olivenbaums zu verfangen, der nach vielen Mistraljahren fast waagerecht wuchs.
Tony war am Vortag aufgetaucht, als ich mit offenem Verdeck durch Montalban brauste. Ich hielt an einer roten Ampel, wo er auf eine Mitfahrgelegenheit hoffte, und er fragte höflich, ob ich in Richtung Süden fahre. »Ja«, antwortete ich kühl, ohne ihn einzuladen.
»Könntest du mich vielleicht ein Stück mitnehmen?«, fragte er mit nordenglischem Akzent, und in seiner Frage steckte kein Anflug von Anmache. »Ich wäre wirklich sehr dankbar.«
»Meinetwegen«, sagte ich schroff, also schwang er seinen kleinen Koffer auf den Rücksitz, sprang über die Tür und setzte sich neben mich. Am Abend fanden wir ein billiges Hotel und nahmen ohne weitere Diskussion zwei Einzelzimmer. Nach dem Abendessen, das Tony bezahlte, entschuldigte er sich, fragte aber vorher noch: »Ist es wohl in Ordnung, wenn ich morgen mit dir bis zur Grenze fahre?«
»Klar«, sagte ich und meinte es auch so. Ich begann, mich an ihn zu gewöhnen.
Er war ein perfekter Geburtstagsbegleiter, der vergnügt mitfeierte, obwohl wir uns erst seit zweiundzwanzig Stunden kannten. Ich hatte meine Geschenke nicht in England öffnen wollen, sondern sie mitgeschleppt, vielleicht als ziemlich verzweifelten Versuch, mit dem Leben in Verbindung zu bleiben, das ich gerade hinter mir ließ. Ich schob Dessert und Kaffee beiseite, arrangierte alle Geschenke auf dem kleinen runden Tisch und erzählte Tony von den Menschen, die sie für mich ausgesucht hatten. Schallplatten und Parfüm von meinen Londoner Freunden, mit denen ich Partys gefeiert, zum Beat der Beatles die Fußböden diverser WGs hatte erbeben lassen. Tony lachte, als ich ihm erzählte, wie der Nachbar unter uns wegen des Krachs einmal die Polizei gerufen hatte, die Polizisten dann gekommen waren, die Helme abgesetzt und bis zum Morgengrauen mit uns getanzt hatten. Eine Elizabeth-Arden-Handcreme von meiner alten Schulfreundin Sue war dabei. Tony hörte geduldig zu, als ich ihm erzählte, wie wir alle zusammengepfercht auf Sues Terrasse für die Prüfungen gepaukt hatten und ihre Mutter uns anflehte, das kleine gelbe Transistorradio leiser zu stellen, aus dem unablässig die Top Zwanzig plärrten. Wir sangen laut mit, ersetzten aber die Texte durch Dialoge aus Shakespeare-Stücken und Abschnitte aus dem Biologiebuch. Es gab Bücher von meinen Geschwistern und Bilder und Glückwunschkarten, die meine Nichten und Neffen für mich gemalt hatten, deren Namen sich Tony gleich merkte.
Aber einen Teil meines Lebens erwähnte ich weder Tony noch sonst jemandem gegenüber, obwohl ich mich genötigt gefühlt hatte, auch diesen mitzunehmen, und zwar in Form eines kleinen lavendelfarben verpackten Geschenks. Seit April war ich viele Male zehn, manchmal elf Stunden lang durch die Dunkelheit gerast, auf kurvenreichen Straßen an schäumenden walisischen Flüssen entlang, um eine Nacht mit Sophia zu verbringen, der Frau, bei der ich nach dem Tod meiner Eltern Trost gefunden hatte; der Frau, die noch vor Ostern meine Geliebte geworden war. Ich riss das lavendelfarbene Papier auf, und das war ihre Gabe: ein Exemplar von Spoon River, auf das Vorsatzblatt hatte sie als Widmung das komplette Gedicht geschrieben, das sie mir an einem Frühlingsabend vor dem Kamin vorgelesen hatte. Ich las die ersten Worte, Had I the heavens’ embroidered cloths … und klappte das Buch sofort zu. Diesen Teil meines Lebens hielt ich die allermeiste Zeit sogar vor mir selbst verborgen. Aber hier war er nun, dieser Teil, und zwang mich zu schuldbewusster Heimlichtuerei, als Tony fragte, von wem das Buch sei. Ich wurde rot und zuckte die Achseln, schob es unter einen Berg Geschenkpapier und ließ seine Frage unbeantwortet.
Schläfrig und schwitzend brachen wir nach dem Mittagessen in Richtung spanische Grenze auf, der Wind peitschte um die Windschutzscheibe und brachte mein Seidentuch wie wild zum Flattern. Während wir über die ausgetrocknete Landschaft preschten, fiel Tonys Kopf nach hinten, und er döste unruhig. Mir selbst war, als schwebte ich in der Luft und beobachtete mich von oben, als sei dies ein Film, in dem ich mitspielte. Ich sah mich über die braune Ebene fegen, in dem salbeigrünen Triumph, einem starken Symbol meiner Mutter, deren frustrierte Träume und Abenteuerlust sich in dem Wunsch manifestierten, ein eigenes Cabriolet zu besitzen. Mein Vater hatte sich jahrelang über diesen Wunsch lustig gemacht. Cabrios, sagte er, seien unpraktisch, besonders in England, wo man praktisch nie offen fahren könne und das Stoffdach im Winter leckte. Ich dachte, er würde nie nachgeben, aber am Ende setzte meine Mutter sich durch.
Mir gefiel die rasante Figur, zu der ich in ihrem kleinen Sportwagen wurde, der jetzt mir gehörte. Nur ich kannte seine Geschichte, und ich schwieg. Ich hatte in den sechs Monaten seit ihrem Tod nicht eine Träne vergossen. Ich hatte jede Menge Whiskey getrunken. Ich hatte aufgehört zu menstruieren, aber darüber dachte ich nicht weiter nach. Auch an meine Eltern dachte ich nicht. Ich fuhr in den Süden, den Koffer voller neuer Badeanzüge. Ich war eine sorgenfreie junge Frau, der die Welt offenstand.
Ich warf einen raschen Blick zu Tony hinüber, sein Kopf war vorgekippt, er schnarchte leise auf seine Brust, und ich merkte, wie ich nachsichtig lächelte. Dieses Lächeln gehörte zwingend zu dem Gesamtbild, es passte zu meiner Rolle in diesem Film. Meine Beziehungen zu Männern verwirrten mich schon seit einigen Jahren. Ich war attraktiv genug, um ihr Interesse zu wecken, hatte aber keine Ahnung, wie man mit ihnen redete. Tatsächlich hatte mich die Lockerheit, mit der ich Tony beim Mittagessen von meinem Leben erzählt hatte, selbst einigermaßen überrascht, aber das lag vermutlich am Champagner. Seit dem Beginn der unaussprechlichen Liebesbeziehung zu Sophia hatte ich meine Bemühungen in Richtung Männer recht entschieden intensiviert. Keineswegs hatte ich mich dem erschreckenden Gedanken genähert, dass ich emotional oder sexuell auf Frauen ausgerichtet sein könnte, trotz des Yeats-Gedichts auf der ersten Seite des Buchs, das ich soeben ausgepackt hatte, jenes Gedichts, das ich in den hintersten Winkeln meines Gehirns hörte, das gleichzeitig Scham und Sehnsucht auslöste, Aufblitzen von Haut, Hitze eines Kaminfeuers:
Hätt ich des Himmels bestickte Kleider,
Durchwirkt mit goldnem und silbernem Licht,
Die blauen, matten und dunklen Kleider,
Der Nacht, des Tages und des halben Lichts,
Ich legte sie zu deinen Füßen aus:
Doch ich bin arm, hab nur meine Träume,
Die legte ich zu deinen Füßen aus,
Tritt sanft, du trittst auf meine Träume.
Vielleicht lag in dem Maß von Energie, die ich auf das andere Geschlecht verwandte, ein Anflug von Verzweiflung, aber das bedeutete nicht, dass ich Männer nicht mochte; Tony beispielsweise war sehr einnehmend: Ich mochte seinen schrägen Witz und wie er vom Leben auf der Farm seines Vaters erzählte.
Als die Vergangenheit wieder sicher im Kofferraum verstaut war, konnte ich mich in Ruhe der Zukunft zuwenden. Ich war auf dem Weg nach Spanien, wo mich eine Stelle erwartete. Zumindest hoffte ich das. Mein Bruder hatte sich schnippisch über den, wie er es nannte, »weißen Sklavenhandel« geäußert, seiner Meinung nach war ich verrückt, allein loszufahren, ohne auch nur einen Brief in der Hand zu haben, der meine Anstellung bestätigte. Zugegebenermaßen war diese Anstellung etwas ungewöhnlich zustande gekommen: Ich hatte Arturo Suqué durch einen Mann kennengelernt, für den ich vorübergehend als Sekretärin arbeitete. Arturos Schwiegervater war Don Miguel Mateu, einer der reichsten Männer Spaniens, zu seinen zahllosen Unternehmen zählten die Kellerei Cavas del Ampurdán, die die Perelada-Weine produzierten. Arturo suchte nun jemanden, der sich um die Touristenhorden kümmerte, die anreisten, um Schloss und Weinkeller zu besichtigen. Er meinte, dass Perelada seine Geschichte besser vermarkten müsse, so wie viele französische Weingüter es taten. Die gesuchte Person könnte im nahen Städtchen Figueras wohnen und Dolmetscher, Fremdenführer, Verantwortlicher für Public Relations sowie Betreuer der britischen Weinimporteure zugleich sein. Dank meines sehr passablen Spanischs, das ich bei den vielen Spanienurlauben mit meinen Eltern und auch in der Schule gelernt hatte, und der Empfehlung meines Chefs bekam ich den Job.
Wir hatten ...