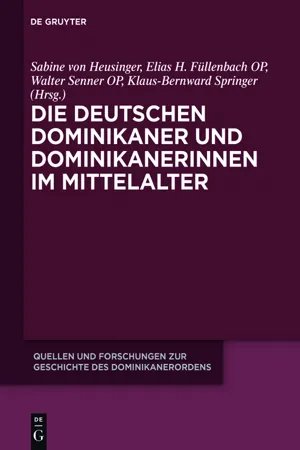![]()
Teil 1: Innovation und Tradition
![]()
Sabine von Heusinger
Ketzerverfolgung, Predigt und Seelsorge – Die Dominikaner in der Stadt
Die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts waren nicht nur vom Städtewachstum geprägt, sondern auch von der Entstehung der Bettelorden. Im Gegensatz zu den „alten“ Orden, die sich nach Weltabgeschiedenheit sehnten, ließen sich die „neuen“ Orden mitten in den Städten nieder und übernahmen eine zentrale Rolle in der Seelsorge der Bevölkerung. Auf die Nachfrage von breiten Bevölkerungskreisen nach evangelischer Nachfolge und apostolischer Armut hatten sie überzeugende Antworten. Dies führte zu ihrem immensen Erfolg, der sich in einer kontinuierlich wachsenden Anhängerschaft niederschlug. Idealtypisch wird die Ankunft von Bettelordensmitgliedern in der Stadt, die rasch zu einer Klostergründung und einer zunehmenden Anhängerschar führte, im Legendarium des Dominikanerklosters zu Eisenach geschildert. Dort findet sich am Ende des 14. Jahrhunderts ein Eintrag, der davon berichtet, wie die Gründung des Dominikanerklosters in Erfurt in den 1220er Jahren abgelaufen sei1. Der Legende nach wurden Predigerbrüder aus dem Pariser Konvent in alle Provinzen geschickt, um den katholischen Glauben zu verbreiten. Dabei wurde Bruder Elger nach Thüringen gesandt, weil er in der Gegend Verwandtschaft hatte und der Volkssprache mächtig war. Er trat vor Ort in Kontakt mit Fürsten, Grafen und Herren und verkündete das Gotteswort an das Volk. Ihn begleiteten gut ausgebildete, angesehene, fromme Männer, denen das Volk bei den Predigten gerne zuhörte. Im Jahr 1229 kamen sie nach Erfurt, wo sie von den Fürsten, Grafen, Herren und den Einwohnern ehrenvoll aufgenommen wurden und ohne Widerstände sofort einen Konvent gründen konnten. Mit der Unterstützung „guter Menschen“ konnten sie den Hof des Vogtes von Rusteberg kaufen und dort eine einfache Kapelle aus Holz erbauen.
In dieser legendarischen Erzählung stecken bereits viele Elemente, die für das Thema „Dominikaner in der Stadt“ zentral sind: Von Paris und Italien aus wurden Dominikaner in das deutschsprachige Gebiet geschickt, um in den Städten Konvente zu gründen; zumindest einige Brüder waren der Landessprache mächtig und kamen rasch in Kontakt mit den dortigen Führungsgruppen und den Gläubigen. Sie waren sehr gut ausgebildet und hervorragende Prediger, die Zulauf beim Volk fanden, das sie von Anfang an beim Bau von Kirchen und Klöstern finanziell unterstützte.
1Die Anfänge des Dominikanerordens
Die Gründung des Dominikanerordens zu Beginn des 13. Jahrhunderts kann als Antwort auf Fragen der Zeit verstanden werden: In Südfrankreich, aber auch am Rhein fanden Häretiker eine begeisterungsfähige Anhängerschaft; in den Städten entwickelte sich unter interessierten Laien eine neue Form von Religiosität, die Teil der Armutsbewegung wurde und die Forderung nach radikaler apostolischer Nachfolge aufgriff. Weder Säkularklerus noch traditioneller Ordensklerus waren in der Lage, auf die spirituellen Bedürfnisse der Gläubigen adäquat zu reagieren. Diese Lücke konnten die Dominikaner füllen, denn sowohl von ihrer Besitzlosigkeit als auch von ihrer Predigt ging eine große Überzeugungskraft aus. Statt Handarbeit stand das Studium der Theologie an erster Stelle, um den Häretikern auch argumentativ gewachsen zu sein. Und schließlich waren die Brüder nicht länger an einen bestimmten Konvent oder einen Pfarrsprengel gebunden, sondern konnten ihren Auftrag an jedem beliebigen Ort erfüllen2. Rasch fand der Orden nach seiner Konstituierung Unterstützung von drei Seiten: 1. durch die Kurie, 2. durch den Adel und 3. durch die städtischen Führungsgruppen3. Den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wandel in den Städten trieben vor allem die kaufmännischen Eliten voran. In einer Zeit, in der eine kommunale Identität entstand, interessierten sie sich auch für neue Formen religiöser Praxis und theologischer Diskurse. Eine neue Frömmigkeit ergriff in dieser Zeit Männer und Frauen, Adlige und städtische Eliten, sowohl fromme Menschen, die in den Klerus eintreten, als auch solche, die im Laienstand bleiben wollten4.
Im Gegensatz zu den Franziskanern war für die Dominikaner das Streben nach apostolischer Armut nicht der Inhalt ihres Aufbruchs, sondern ein Mittel zur Verwirklichung ihres primären Ziels, der Bekehrung und notfalls Verfolgung von Ketzern5. Vor allem im Languedoc trat der junge Orden in die Auseinandersetzung mit den Katharern, an der zuvor die Zisterzienser gescheitert waren6. Deshalb legte der Orden besonderen Wert auf das Studium als ein Mittel der Seelsorge, die Konstitutionen sahen für jeden Konvent einen Lektor vor7. Im Dezember 1219 werden die seit September 1217 in Paris eingetroffenen Predigerbrüder urkundlich fassbar, die Universität überließ ihnen 1221 die Kirche St. Jacques mit Hospiz8. Das erste (und zu Beginn einzige) Generalstudium wurde ab 1221 dort eingerichtet9. Der erste Lehrer war ein Weltgeistlicher, Johannes von St. Albans, Magister der Theologie und Dekan von St. Quentin, der von Papst Honorius III. beauftragt worden war, die Lehre zu übernehmen10 – zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine gelehrten Predigerbrüder, die diese Aufgabe hätten ausfüllen können. Da die Studienplätze in Paris schon bald nicht mehr genügten, wurden auf dem Generalkapitel von 1248 vier weitere Generalstudienhäuser eingerichtet: in Bologna, Oxford und Montpellier, die mit den dortigen Universitäten verbunden waren, sowie in Köln11. Das Generalkapitel von 1304 verpflichtete alle Provinzen (mit Ausnahme von drei besonders kleinen), ein Generalstudium einzurichten, und daraufhin entstanden fünfzehn weitere höhere Ausbildungsstätten12. Von Anfang an hielten die Konstitutionen der Dominikaner fest, dass der Orden „vor allem für die Predigt und das Heil der Menschen“ gegründet worden sei13. Gepredigt wurde in den Städten – südlich der Alpen häufig auf öffentlichen Plätzen, nördlich der Alpen häufig in Kirchen14. Die rege Predigttätigkeit der Dominikaner fand aber weder auf Seiten der Säkulargeistlichen noch bei den Mitgliedern der alten Orden ausschließlich Zustimmung15.
Es fällt auf, dass die Bettelorden von Anfang an vor allem in den wirtschaftlich aktiven Regionen wie Flandern, dem Rheinland oder Oberitalien präsent waren. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts gab es die Idee einer sozial abgestuften Seelsorge; die Zusammenarbeit von Klerikern und Laien zur Rettung der Seelen – vor allem mit Hilfe der Predigt – wurde abschließend auf dem IV. Lateranum 1215 festgehalten16. Jörg Oberste nimmt eine Entwicklung an, die von der „pastoralen Wende“ um 1200 zur „kaufmännisch-bürgerlichen Wende“ im 13. Jahrhundert führte17. Damit bezeichnete er die Entstehung des Handels-, Wucher- und Zinsverdikts, das Predigt und Seelsorge vor allem der Bettelorden so nachhaltig prägte18. In der von ihm exemplarisch untersuchten Region des Languedoc blühte eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Häresie um 1200 auf.
2Die Entstehung der Provinz Teutonia
Das erste Generalkapitel 1220 beschloss auch für die Kommunitäten vollkommene – oder evangelische – Armut mit gemeinsamem und persönlichem Bettel. Das Generalkapitel von Bologna im Jahr 1221 legte die Grenzen für die einzelnen Ordensprovinzen fest19. Nach dem Tod von Dominikus im selben Jahr breitete sich der Orden rasch in Europa aus20. Die Entsendung von Brüdern nach England, Skandinavien, Polen, Ungarn und in den Nahen Osten vollendete die Ausbreitung und Konsolidierung des Ordens. Spätestens nach dem Generalkapitel von 1225 wurde Bernardus Teutonicus von Bologna aus nach Deutschland gesandt, um aus den bestehenden Konventen eine Provinz zu formen21. Auf dem Generalkapitel von 1226 konnte er bereits erste Erfolge mitteilen und wurde Provinzial. Das erste Provinzialkapitel tagte danach im selben Jahr in Magdeburg, wo Bernardus vermutlich darum bat, aus seinem Amt entlassen zu werden. Simon Tugwell vermutet, dass dort Konrad von Höxter gewählt wurde – für die ersten Jahre fehlen leider detailliertere Quellen, die eindeutige Aussagen zulassen würden22.
Friesach in Kärnten gilt als der älteste Konvent in der späteren Ordensprovinz Teutonia23. Kurz danach wurde Köln gegründet. Beide frühen Gründungen waren problembeladen: In Friesach trat derjenige Bruder, der den Konvent gegründet hatte, aus dem Orden aus und in Köln wurde der erste Prior als geflohener Zisterzienser (fugitivus) identifiziert und exkommuniziert24. Im Jahr 1224 wurde der Konvent in Magdeburg gegründet und Brüder trafen in Straßburg ein, im folgenden Jahr gab es Gründungen in Trier (vielleicht von Köln aus) und Bremen. Unklar bleibt, auf wessen Initiative hin die Konvente in Würzburg und Worms im Jahr 1226 entstanden25. Die Ordensprovinzen wurden zu Beginn des 14. Jahrhunderts neu geordnet, in der Zeit zwischen 1301 und 1303 wurde die Saxonia von der Teutonia abgetrennt, die Bohemia von der Polonia, die Toulouser von der provenzalischen Provinz und Aragón von der spanischen Provinz. Die Saxonia umfasste in etwa das Gebiet nördlich des Mains und östlich des Rheins26.
3Das Beispiel Köln
Um das Jahr 1220/21 kamen die ersten Brüder nach Köln, die aus Bologna und Paris stammten – der genaue Zeitpunkt ist unklar27. Das Kölner Andreasstift überließ ihnen als erste Unterkunft das St.-Maria-Magdalena-Hospital mit Kapelle in der Stolkgasse. Bereits in einer Urkunde von 1224 wird das Haus conventus sancte Crucis genannt28. Im Jahr 1229 erhielten die Predigerbrüder einen Teil einer angrenzenden Hofstätte, um das Atrium der Kirche vergrößern zu können – die Brüder müssen also schon zuvor mit dem Bau einer Kirche begonnen haben29. Die beiden frühen Prioren des Konvents, Heinrich von Köln und Leo, waren in Paris gemeinsam mit Jordan von Sachsen in den Orden eingetreten und hatten dort zusammen studiert30. Das Kölner Beispiel zeigt, dass keineswegs alle neugegründeten Bettelordenskonvente an der Stadtmauer lagen, wie die ältere Forschung postuliert hatte31. Eine Reihe von weiteren Schenkungen und Käufen erfolgte bis 1254 mit dem Ziel, das Gelände systematisch zu vergrößern, was vor allem durch den Aufbau des Generalstudiums seit 1248 nötig geworden war. Um 1250 war die große Hallenkirche fertig, die den Rang der Kölner Niederlassung betonte32, und um 1271 fanden die Baumaßnahmen an Kirche und Kloster ihren ersten Abschluss33.
Von Anfang an kam es zu Konflikten mit dem Weltklerus. Erzbischof Engelbert von Berg musste die Dominikaner wie auch die Franziskaner in Schutz nehmen, da sich die Säkulargeistlichen über sie beschwerten34. Ein zentraler Konfliktpunkt war der große Zulauf, den die Dominikaner bei ihren Predigten hatten, vor allem von frommen Frauen. Es liegt nahe, hier an Beginen zu denken, die sich seit 1223 in Köln nachweisen lassen – dies ist der älteste Beleg für das Reich35. Im Jahr 1248 kam Albertus Magnus von Paris nach Köln und brachte als Geschenk von Ludwig...