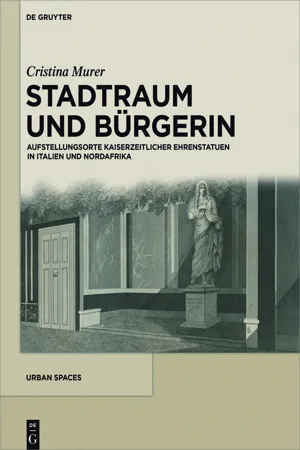Die griechische Agora gilt als Prototyp europäischer Platzanlagen. Aus Sicht der Alten Geschichte und der Klassischen Archäologie ist der öffentliche Platz der Agora der zentrale Ort, an dem sich das Gemeinwesen einer griechischen Stadt konstituierte. Sie bildete den gesellschaftlichen Mittelpunkt der Polis, wie sie sich seit dem 8. Jh. v. Chr. im antiken Griechenland herausgebildet hatte. Die Agorai der geometrischen und archaischen Epoche waren zunächst einmal freie Plätze, die Versammlungen und Festen dienten und nicht zwingend architektonisch gestaltet waren. Seit dem 7. Jh. v. Chr. wurden diese Freiflächen an ihrer Peripherie nach und nach mit öffentlichen Gebäuden ausgestattet, sodass Agorai bis zum 4. Jh. v. Chr. zu eindeutig definierten innerstädtischen Zentren wurden. Ihr Charakteristikum war die unbebaute, von Gebäuden gerahmte und zentral gelegene Fläche, die sowohl merkantile, politisch-administrative als auch sakrale Funktionen auf sich vereinte. Im Gegensatz zu den hellenistischen Agorai erscheinen die Agorai des 8. bis 5. Jh. v. Chr. nicht als baulich und ästhetisch durchstrukturierte Einheiten, sondern als sukzessiv und additiv entstandene Gebäudekonglomerate. Ihre Charakteristika waren locker am Rand der Platzfläche verteilte öffentliche Gebäude, eine offene Platzgestaltung im Verhältnis zum urbanen Gefüge sowie eine freie Platzfläche. Dies änderte sich erst in der Epoche des Hellenismus, als zum ersten Mal regelmäßig an allen Seiten mit Gebäuden gerahmte und nach innen orientierte Platzanlagen überliefert sind. Agorai brachten fortan ihre soziale, politische und religiöse Bedeutung durch ihre monumentale Ausstattung nachhaltig zum Ausdruck. Die dauerhafte Gestaltung der Plätze machte sie zu politischen und architektonischen Zentren hellenistischer Poleis und zu Repräsentationsorten der dort lebenden Gesellschaften.
1.1 Thema und Fragestellung
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die Agorai in der Epoche des Hellenismus, einer von großen politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen gekennzeichneten Zeit. Im Zentrum der Platzanalysen steht die Frage, nach welchen gestalterischen Prinzipien sie errichtet und ausgestattet worden sind und welche Aussagen die materiellen Hinterlassenschaften auf Agorai über die sie prägende und von ihnen geprägte Gesellschaft ermöglichen.
Ausgehend von der These, dass sich hellenistische Agorai in ihrer architektonischen Ausgestaltung von denen der Archaik und Klassik deutlich unterscheiden, stellen sich folgende Fragen: Wie kam es zu einem solchen Bedeutungszuwachs des gestalteten öffentlichen Raumes, der sich anhand der zunehmenden Ausgestaltung der Plätze feststellen lässt? Erfüllten Agorai im Hellenismus andere gesellschaftliche Funktionen als in den Epochen zuvor? In welchem Verhältnis steht dies zur neuartigen Gestaltung und Wahrnehmung der Plätze durch den antiken Betrachter? Können daraus epochenspezifische Gestaltungsprinzipien für hellenistische Agorai abgeleitet werden – und wenn ja, wie sehen diese aus? Und: Wie wurde der Raum der Agora durch die dort agierende Gesellschaft geprägt und wie wirkte er auf sie zurück?
Der Beantwortung derartiger Fragen widmet sich die vorliegende Arbeit. Ihr Ziel ist es, die Beziehung zwischen materieller Gestaltung, Wahrnehmung und Semantik jenes Platzes genauer zu erforschen, der für die antike Stadt von so herausragender Bedeutung ist. Im Zuge der Analyse und Interpretation werden unterschiedliche Theorien aus dem Bereich der Raum- und Gedächtnistheorie, der Kultursemiotik, der Rezeptionsästhetik sowie der Architektursoziologie angewandt, die einen synthesegerichteten Blick auf grundsätzliche Gestaltungstendenzen dieses Platztypus ermöglichen.
Bei hellenistischen Agorai handelt es sich um innerstädtische, öffentliche Platzanlagen, die aufgrund ihrer Funktionen und ihrer Ausstattung den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Mittelpunkt einer Polis bildeten. In der Forschung kann jedoch nicht immer zweifelsfrei zwischen primär politisch oder merkantil genutzten Plätzen unterschieden werden, was im Fall der Existenz von zwei Agorai in einer Stadt zu Bezeichnungen wie Handels- oder Marktplatz geführt hat. Das entscheidende Kriterium bei der Definition von Agorai ist daher nicht ihre Funktion. Damit ein öffentlicher Platz als Agora bezeichnet werden kann, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein, die gemeinsam den Status des Platzes als Agora rechtfertigen. Zu diesen Kriterien gehören die Multifunktionalität, das Vorhandensein politisch-administrativer Gebäude, die Lage innerhalb einer urbanen Umgebung, die Anbindung an die Infrastruktur, die Rahmung mittels Stoai und die Ausstattung mit Statuen. Ein Platz fand Eingang in die vorliegende Analyse, wenn er mindestens drei der genannten Kriterien erfüllte. Ein absoluter Anspruch auf die Notwendigkeit oder Hinlänglichkeit jedes einzelnen Kriteriums wird damit nicht erhoben.
Der zeitliche Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt im Hellenismus, der nach geltenden Epochengrenzen den Zeitraum von 336 bis 31 v. Chr. umfasst. Der hier untersuchte Zeitraum beginnt jedoch etwas früher (um 400 v. Chr.) und endet etwas später (um 50 n. Chr.). Unabhängig von der Relativität jeglicher Epochenkonstruktion hat dies den Zweck, die für den Hellenismus spezifischen Entwicklungen besser ermitteln zu können. Eine etwas weiter gefasste Zeitspanne ermöglicht einen Vergleich mit dem Zustand der Plätze in den Phasen unmittelbar davor und danach und lässt Veränderungen deutlicher hervortreten. So kam es bereits in der 1. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. zu wesentlichen Einschnitten in der Architektur und Platzgestaltung, die für den Hellenismus nicht folgenlos blieben. Ebenso begann mit der Ausbildung des Prinzipats und dem Bau römischer Fora in augusteischer Zeit eine neue politische und urbanistische Entwicklung, die noch von der vorhergehenden hellenistischen Epoche beeinflusst worden ist.
Grundlage der Untersuchung bilden die archäologischen Befunde der untersuchten Agorai, die ggf. von literarischen und epigrafischen Quellen ergänzt werden. Im Fokus des Interesses stehen alle zur Verfügung stehenden materiellen Hinterlassenschaften, die Hinweise auf die Form der Plätze mit ihren Gebäuden, Monumenten und Wegen geben. Auf diese Weise soll der Funktion, der Ästhetik und der Semantik der Platzräume nachgegangen und das Zusammenspiel der einzelnen Elemente auf der jeweiligen Agora näher untersucht werden. Dabei richtet sich die Analyse nicht nur auf formale und funktionale Aspekte, sondern explizit auch auf rezeptionsästhetische Phänomene. Hinweise darauf liefern die durch Stoai und andere Architekturen gestalteten Plätze und ihre Ausstattung in Form von Bildwerken, Altären, Temene usw. Dieser rezeptionsästhetische Ansatz wurde aus der Literaturwissenschaft auf die Kunstgeschichte übertragen und fand bislang im Bereich der Klassischen Archäologie verhältnismäßig wenig Beachtung. Dies ist umso erstaunlicher, als gerade dort eine auf die Wahrnehmung durch einen imaginären Betrachter gerichtete Analyse materieller Hinterlassenschaften zu neuen Ergebnissen führen kann. Eine Rekonstruktion von Agorai im Hinblick auf ihre ästhetischen und semantischen Aspekte erschließt einen Bereich, der im Verhältnis zur Funktion einer Platzanlage eine nicht minder wichtige Rolle gespielt hat und sich im Fall der hier untersuchten Plätze mindestens ebenso konkret nachweisen lässt. Dies geschieht unter der Prämisse, dass zwischen den Bürgern einer Polis und der Agora eine Wechselbeziehung besteht. Die Agora ist ein Produkt menschlicher Handlungen und zugleich werden die auf dem Platz agierenden Menschen durch die von ihnen gestaltete Umgebung beeinflusst. Im Folgenden werden daher die materiellen Hinterlassenschaften auf dem Platz zur sozialen und politischen Verfasstheit der damaligen Gesellschaft in Beziehung gesetzt. Hinzu kommt, dass sowohl die auf dem jeweiligen Platz stattfindenden Aktivitäten (als Platzfunktionen) als auch die ästhetische und semantische Wahrnehmung des Platzes durch den Betrachter (als gestaltete materielle Umgebung) Teil der Interaktion und Kommunikation der dort handelnden Gesellschaft sind. Die Artefakte auf einer Agora sind demnach Bestandteile eines symbolischen Raumes, der in seiner besonderen Gestalt zugleich auch Teil des kollektiven Gedächtnisses und der Identität einer Gesellschaft ist. Diesen symbolischen Raum gilt es, mitsamt seiner zeitlichen Dynamik zu rekonstruieren und zu interpretieren.
Die in der Arbeit aufgeworfenen Leitfragen konzentrieren sich auf die Gestalt hellenistischer Agorai, ihre unterschiedlichen Funktionen sowie die Frage, welche Erkenntnisse die Gestaltung hellenistischer Agorai über die sie nutzende Gesellschaft liefert. Die Synthese aller Analysekategorien ermöglicht eine Einschätzung der Bedeutung, die die Veränderungen gesellschaftlicher Normen und Werte für die Gestaltung der Plätze in hellenistischen Städten besaßen. Dazu werden im Folgenden vier Thesen aufgestellt, die die Fragestellung zur Gestaltung von Agorai als soziales Phänomen konkretisieren und im Zuge der Untersuchung überprüft und differenziert werden.
- Hellenistische Agorai bildeten den Rahmen für die auf den Plätzen praktizierte Kommunikation und Interaktion und gestalteten auf diese Weise die auf ihnen stattfindenden Handlungen wesentlich mit.
- Hellenistische Agorai besaßen primär repräsentative Funktionen, die sie in ihrer sozialen Bedeutung vom politischen Versammlungsplatz der Archaik und vom Verwaltungszentrum der Klassik unterscheiden.
- Agorai waren als Orte der politischen Repräsentation das Produkt von gesellschaftlichen Rivalitäten der dort aktiven Poliseliten.
- Agorai waren als Orte öffentlicher Performanz primär von politischen und weniger von sakralen Faktoren geprägt.
Um diese Thesen zu überprüfen und Antworten auf die genannten Fragen zu erhalten, ist eine systematische Materialauswahl notwendig. Im Hinblick auf einen zeitlichen Rahmen bildete das Aussehen der Plätze um 400 v. Chr. bzw. zum Zeitpunkt der jeweiligen Stadtgründung den Ausgangspunkt der Betrachtungen. Beendet wurde die Analyse nach Möglichkeit in tiberisch-claudischer Zeit (um 50 n. Chr.). Es erfolgte außerdem eine topografische Begrenzung auf das griechische Kernland, die ägäischen Inseln und den Westen Kleinasiens (Abb. 1). Dort fanden während der römischen Expansion im Laufe des Hellenismus die am weitesten reichenden Veränderungen in politischer und urbanistischer Hinsicht statt.
Aufgrund der komplexen Fragestellung bieten sich für eine detaillierte Analyse nur relativ wenige, besonders gut erforschte Platzanlagen an. Hin...