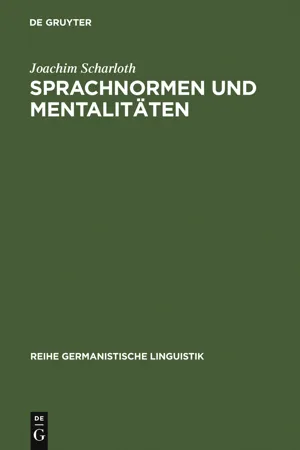
Sprachnormen und Mentalitäten
Sprachbewusstseinsgeschichte in Deutschland im Zeitraum von 1766 bis 1785
- 571 pages
- English
- PDF
- Available on iOS & Android
Sprachnormen und Mentalitäten
Sprachbewusstseinsgeschichte in Deutschland im Zeitraum von 1766 bis 1785
About this book
Die Debatte um die Norm des Hochdeutschen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde nicht nur mit linguistischen Argumenten geführt, sondern auch mit kulturkritischen und moralischen. Gegen die Dominanz der Sächsischen Sprachkundler formierte sich mit Friedrich Karl Fulda, Johann Gottlieb Hartmann und Johannes Nast in Schwaben eine Opposition, die durch eine alternative Sprachnorm eine sittliche Erneuerung Deutschlands erreichen wollte. Die Studie fragt, wie es zu so unterschiedlichen Ausprägungen im Sprachdenken einer Zeit kommen kann. Durch die Verschränkung verschiedener sozial-konstruktivistischer Theorien (Wissenssoziologie, Kulturelles Gedächtnis und linguistische Diskursanalyse) wird ein Modell der Genese von Sprachbewußtsein entwickelt, das es erlaubt, Denkweisen über Sprache aus mentalitären Dispositionen zu erklären. Die tiefensemantische Analyse von sprachreflexiven, aber auch feuilletonistischen, literarischen und kulturhistorischen Texten und Druckgraphiken des 18. Jahrhunderts zeigt, wie allgemeine Denk- und Bewertungsschemata die Debatte über die Frage »Was ist Hochdeutsch?« präformierten und organisierten. Das Denken über Sprache entfaltete sich demnach in den argumentativen und semantischen Rahmen des kulturkritischen Diskurses. Die Sprachnormendebatte wird so als Streit über die sittliche Verfassung und die nationale Identität Deutschlands lesbar gemacht.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
Table of contents
- 1. Sprachbewusstseinsgeschichte und Mentalitätsgeschichte
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Sprachbewusstsein
- 1.3 Wirklichkeit und Geschichte als soziale Konstruktionen
- 1.4 Linguistische Diskursgeschichte als historische Semantik
- 1.5 Korpus, Methode und Quellenkritik
- 1.6 Sprachbewusstseinsgeschichte und historische Soziolinguistik
- 2. Sprache und Kultur
- 2.1 Sprache, Denken und kulturelle Entwicklung
- 2.2 Sprachnormierung im Dienst des kulturellen Fortschritts
- 2.3 Fazit
- 3. Was ist Hochdeutsch?
- 3.1 „Teutsch“ oder „deutsch“? – Zu den Konfliktlinien des Sprachnormendiskurses
- 3.2 Dominanter Diskurs
- 3.3 Gegendiskurse
- 4. Die Debatte um den Vorrang des Obersächsischen im mentalitätsgeschichtlichen Kontext
- 4.1 Vom Zustand der Kultur in den unterschiedlichen Provinzen Deutschlands
- 4.2 Die Abwertung der Sächsischen Kultur und die Ablehnung des Obersächsischen als Leitvarietät in den Gegendiskursen
- 4.3 Fazit: Sittlich motivierte Sprachnormenkritik
- 5. Sprachnormierung im Dienst der Wiederherstellung alter deutscher Sitten
- 5.1 „Der großen Väter Art“ – Die argumentative Grundfigur der kontrapräsentischen Erinnerung
- 5.2 Die Stufen der Kultur und die Lebensalter einer Sprache
- 5.3 Das Bild des Germanentums im Diskurs der Bardendichtung
- 5.4 Die Rezeption des Mittelalters
- 5.5 Das Sprachnormenkonzept der Gegendiskurse im Kontext der Kulturkritik
- 5.6 Fazit: Die sittliche Dimension des Sprachnormenkonzepts der Gegendiskurse
- 5.7 Die Kritik des dominanten Diskurses am Sprachnormenkonzept der Gegendiskurse
- 6. Zusammenfassung, Ergbnisse und Ausblick
- 6.1 Theoretische und methodische Ergebnisse
- 6.2 Sprachbewusstseinsgeschichte zwischen 1766 und 1785
- 6.3 Sprachnormen und Mentalitäten
- 6.4 Ausblick
- 7. Verzeichnis der Abbildungen
- 8. Literatur