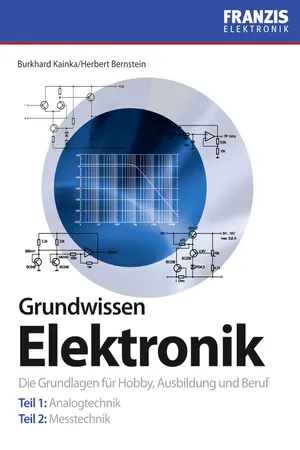![]()
Teil 1
Analogtechnik
![]()
Vorwort
Die Elektronik ist ein breit gefächertes und in den letzten Jahrzehnten stark angewachsenes Fachgebiet, in dem man als Neuling leicht den Überblick verlieren kann. Besonders schwierig ist es daher, einen geeigneten Einstieg zu finden. Obwohl heute die digitale Elektronik zum Beispiel in der Computertechnik weiter verbreitet ist, finden sich in der analogen Elektronik, die bereits seit den Anfängen der Radiotechnik entwickelt wurde, die entscheidenden Grundlagen, an denen man nicht vorbeigehen sollte. Es werden zunächst keine Grundkenntnisse vorausgesetzt. Vielmehr soll der Analogteil des Buches ein solides Fachwissen von Grund auf vermitteln.
Teil 1 behandelt die erforderlichen Theorien, beschränkt sich aber nicht auf theoretische Grundlagen, sondern bietet immer auch praktisch erprobte Schaltungen für konkrete Projekte. Zahlreiche Schaltungen können zum Ausgangspunkt für eigene Entwicklungen werden.
Es wurde versucht, einen umfassenden Überblick der wichtigsten Bereiche zu geben. Viele in der praktischen Arbeit auftretende Probleme führen dazu, dass man häufig auf der Suche nach konkreten Fachinformationen ist. Die Zusammenstellung der Inhalte wurde daher auch von dem Ziel geleitet, die Suche nach praktisch relevanten Informationen zu vereinfachen.
Ich wünsche allen Lesern viel Erfolg bei der praktischen Arbeit mit dem Analogteil des Buches!
Burkhard Kainka
![]()
Inhalt
1 Einleitung
2 Der Gleichstromkreis
2.1 Ladung und Strom
2.2 Leistung und Spannung
2.3 Der elektrische Widerstand, Ohmsches Gesetz
2.4 Drahtwiderstand
2.5 Reihenschaltung
2.6 Parallelschaltung
2.7 Vorwiderstände
2.8 Innenwiderstand
3 Der Wechselstromkreis
3.1 Effektivspannung und Leistung
3.2 Das Dezibel
3.3 Transformatoren
3.4 Kondensatoren
3.5 RC-Glieder
3.6 Kondensator-Bauformen
3.7 Induktivitäten
3.8 Spulen-Bauformen
3.9 Schwingkreise
4 Dioden-Sperrschichten
4.1 Leitfähigkeit und Dotierung
4.2 Die Diode
4.3 Anwendung der Diode als Gleichrichter
4.4 Dioden-Kennlinien
4.5 Dioden-Bauformen
5 Der bipolare Transistor
5.1 Aufbau und Grundfunktion
5.2 Der Stromverstärkungsfaktor
5.3 Transistor-Kennlinien
5.4 Transistor-Bauformen
6 Feldeffekttransistoren
6.1 Der J-FET
6.2 Doppelgate-MOS-FET
6.3 VMOS-Leistungstransistoren
7 Verstärker-Grundschaltungen
7.1 Der Verstärker in Emitterschaltung
7.2 Gegenkopplung
7.3 Steilheit und Innenwiderstand
7.4 Breitbandverstärker
7.5 Gleichstromgekoppelte Stufen
7.6 Die Kollektorschaltung (Der Emitterfolger)
7.7 Die Basisschaltung
7.8 Die Darlington-Schaltung
7.9 Der Differenzverstärker
7.10 Der Gegentaktverstärker
7.11 Die Konstantstromquelle
8 Transistor-Kippstufen
8.1 Statische Flip-Flops
8.2 Monoflops
8.3 Schmitt-Trigger
9 Transistor-Oszillatoren
9.1 Der Multivibrator
9.2 RC-Oszillatoren
9.3 LC-Oszillatoren
10 Operationsverstärker
10.1 Prinzipschaltung
10.2 Der OPV als Komparator
10.3 OPV-Grundschaltungen
10.4 Invertierende Verstärker
10.5 OPVs mit einfacher Spannungsversorgung
10.6 NF-Vorverstärker
10.7 Leistungsverstärker
10.8 Feldeffekt-OPV
10.9 Der OTA
11 Hochfrequenz-Anwendungen
11.1 Modulation und Demodulation
11.2 Das Diodenradio
11.3 Das Audion
11.4 UKW-Pendelaudion
11.5 HF-Oszillatoren
12 Stromversorgungen
12.1 Batterieversorgung
12.2 Netzteil-Grundschaltungen
12.3 Spannungs-Vervielfachung
12.4 Spannungsstabilisierung mit Z-Dioden
12.5 Längsregler
12.6 Integrierte Spannungsregler
12.7 Bandgap-Referenzen
12.8 Entkopplung der Spannungsversorgung
13 Spannungswandler und Schaltnetzteile
13.1 Spannungswandler
13.2 Schaltregler
13.3 Spannungswandler mit geschalteten Kondensatoren
14 Messtechnik
14.1 Messbereichserweiterungen beim Voltmeter
14.2 Messbereichserweiterung beim Amperemeter
14.3 Das Ohmmeter
14.4 Messfehler
14.5 Messgleichrichter
14.6 Logarithmierer
14.7 Messbrücken
15 Signalgeneratoren
15.1 Rechteck-Generatoren mit OPV
15.2 Rechteckgenerator mit dem 555
15.3 CMOS-Oszillatoren
15.4 Wien-Brücken-Oszillator
15.5 Integrierte Funktionsgeneratoren
15.6 Spannungsgesteuerte Oszillatoren
15.7 Steuerbarer Sinusgenerator mit OTA
16 Sensoren
16.1 NTC-Sensoren
16.2 PT100-Messwiderstände
16.3 KTY-Sensoren
16.4 Dioden und Transistoren als Temperatursensoren
16.5 Integrierte Temperatursensoren
16.6 Thermoelemente
16.7 Lichtsensoren: LDR
16.8 Fotodioden und Fototransistoren
16.9 Kraftsensoren und Drucksensoren
16.10 Piezo-Sensoren
16.11 Magnetfeld-Sensoren
17 Leistungselektronik
17.1 Lineare Leistungsregler
17.2 Leistungsschalter
17.3 Leistungs-MOS-FETs
17.4 PWM-Regler
17.5 Integrierte Leistungsschalter
17.6 Brückentreiber
17.7 Power-OPV
18 Filter
18.1 Entstörmaßnahmen
18.2 Passive RC-Filter
18.3 LC-Filter
18.4 Quarzfilter
18.5 Aktive Filter
18.6 Universalfilter
18.7 Spannungsgesteuerte Filter
19 Mischer und Modulatoren
19.1 Empfängerkonzepte
19.2 Multiplikative Mischer
19.3 Additive Mischer
19.4 Ringmischer
19.5 Integrierte Balance-Mischer
Literatur
Sachverzeichnis
![]()
1 Einleitung
Wer sich ernsthaft mit der Elektronik auseinandersetzen möchte, muss sich die Frage stellen: Welche Voraussetzungen sind erforderlich, um erfolgreich und selbständig arbeiten zu können?
Wichtig sind zunächst solide Kenntnisse der Grundlagen des elektrischen Stromkreises. Nützlich sind lebendige und bildhafte Vorstellungen der Grundphänomene Ladung, Strom, Spannung. Wer in komplexen Schaltungen den Überblick behalten will, der muss sehen lernen, was eigentlich unsichtbar ist. Damit verbunden ist der sichere Gebrauch von Messgeräten. Hinzu kommt das Verständnis der grundlegenden passiven Bauteile, wie Widerstände und Kondensatoren, und ihrer Eigenschaften. Ebenso sollte man sich klare Vorstellungen von Halbleitern und Sperrschichten erarbeiten, um ihr Verhalten in konkreten Schaltungen zu verstehen. Die ersten Kapitel geben einen Überblick und helfen bei der Orientierung. Wer hier schon allzu Bekanntes findet, kann sich gleich in die konkrete Schaltungstechnik der darauffolgenden Kapitel vertiefen.
Obwohl es eine unübersehbar große Zahl unterschiedlicher Schaltungen gibt, lassen sich einige wenige Grundschaltungen angeben, die in jeweils anderen Zusammenhängen immer wieder vorkommen. Die wichtigsten sollte man praktisch erproben und möglichst genau untersuchen. Es lohnt sich, eigene Projekte zu entwerfen und aus einfachen Grundschaltungen zusammenzusetzen. In einer komplexen Schaltung sollte man typische Grundschaltungen wiedererkennen, um die Funktion der Gesamtschaltung zu überblicken. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis weiterführender Literatur.
Nicht alles funktioniert auf Anhieb so reibungslos wie man es sich wünschen würde. Wichtig ist daher das Verständnis möglicher Probleme und Grenzfälle. Bei der Planung einer Schaltung müssen mögliche Bauteiletoleranzen und ihre Auswirkungen bedacht werden. Die Zuverlässigkeit eines Geräts hängt oft davon ab, ob Grenzwerte richtig eingeschätzt wurden. Oft gibt es unerwünschte Nebeneffekte, die zu Überraschungen führen können. Das sichere Erkennen möglicher Fehlerquellen setzt einige Erfahrungen voraus. Teil 1 des Buches versucht einen Grundschatz an Erfahrungen für die praktische Arbeit zu vermitteln, damit auftretende Probleme gelöst werden können. Allerdings ist der Lernprozess niemals wirklich abgeschlossen, denn in der praktischen Arbeit müssen laufend neue Probleme gelöst werden.
Wer sich auf fertig entwickelte Schaltungen au...