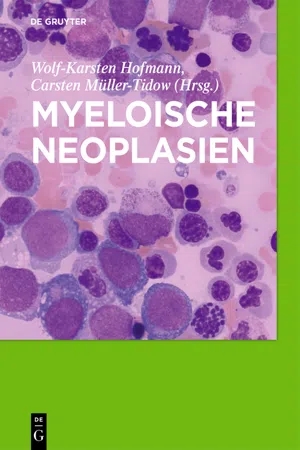
eBook - ePub
Myeloische Neoplasien
Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow, Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow
This is a test
Share book
- 268 pages
- German
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Myeloische Neoplasien
Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow, Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Eine Übersicht der rasanten Entwicklungen im Bereich der myeloischen Erkrankungen - Dieses Buch stellt kompakt und praxisorientiert aktuelle diagnostische und therapeutische Verfahren dar und bietet so eine gute Unterstützung sowohl bei der Akutversorgung im Krankenhaus als auch bei der langfristigen Betreuung der Patienten im ambulanten Bereich.
Neben pathophysiologischen und molekularen Grundlagen und der aktuellen Klassifikation werden auch zukünftige Aspekte der Diagnostik und Therapie myeloischer Neoplasien aufgezeigt.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Myeloische Neoplasien an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Myeloische Neoplasien by Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow, Wolf-Karsten Hofmann, Carsten Müller-Tidow in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Medicina & Oncología. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Pathophysiologische und molekulare Grundlagen myeloischer Neoplasien
1.1 Molekulare Pathogenese myeloischer Neoplasien
Daniel Nowak
1.1.1 Einleitung und historische Besonderheiten
Der Begriff der myeloischen Neoplasien beinhaltet alle malignen Neubildungen der myeloischen Zellreihen der Hämatopoese. Medizingeschichtlich erfolgte die Entdeckung und Beschreibung hämatologischer Erkrankungen und damit auch myeloischer Neoplasien im Vergleich zu soliden Malignomen vergleichsweise spät. Die Ableitung des Begriffs „Leukämie“ aus abnormal gesteigerten Leukosen erfolgte erstmals nahezu zeitgleich durch die Pathologen John Hughes Bennett und Rudolf Virchow 1845 [1]. Eine erstmalige Unterscheidung der differenzierenden Hämatopoese in eine lymphatische und eine myeloische Differenzierungslinie gab es 1877 durch Paul Ehrlich. Aufgrund neuer und verbesserter, von ihm entwickelter Färbemethoden war es möglich geworden, die morphologischen Eigenschaften von Leukozyten darzustellen und somit eine systematische Beschreibung unterschiedlicher Progenitorzellpopulationen durchzuführen. Eine weitere Prägung und Einteilung der myeloischen Hämatopoese und Beschreibung von Monozytosen erfolgte im weiteren Verlauf unter anderem durch den Schweizer Internisten Otto Naegeli (1900).
Als frühe antileukämische therapeutische Versuche können z. B. die Behandlungen mit Arsentrioxid (Fowler-Solution) genannt werden, erstmalig 1865 beschrieben durch den Neurologen Heinrich Lissauer. Weitere z. T. wirksame Therapieversuche erfolgten ab 1895 mittels Röntgenstrahlen. Dennoch blieb das Verständnis über hämatologische Neoplasien und deren Behandlungsmöglichkeiten Anfang des 20. Jahrhunderts noch weitgehend unbefriedigend. Eine erste systematische epidemiologische Arbeit erschien 1917, beinhaltete 1.457 Patienten und formulierte die Hypothese einer infektiösen Genese. Erst im Verlauf der 1930er und 1940er Jahre kam es durch die Möglichkeit verbesserter Labortechniken zur Blutbildmessung, Entwicklung der Knochenmarkpunktion und verbesserter mikroskopischer Untersuchungstechniken zur häufigeren und besseren Abgrenzungen neoplastischer Erkrankungen von nicht malignen Erkrankungen der Hämatopoese.
Das Konzept der Chemotherapie gegen hämatologische Neoplasien entwickelte sich interessanterweise aus militärischen Forschungsprojekten des zweiten Weltkriegs. Man stellte fest, dass die in chemischen Kampfstoffen enthaltenen Lostverbindungen auf besondere Weise toxisch auf die Hämatopoese wirkten und leukämische Erkrankungen in Remission bringen konnten [2]. Dies war der Ausgangspunkt zur Entwicklung der ersten Alkylanzien wie z. B. Busulfan (Myleran), Melphalan und Chlorambucil.
Entscheidende Durchbrüche zum besseren Verständnis und zur Therapie hämatologischer Neoplasien wurden aber erst ab den 1950er Jahren ermöglicht, einerseits durch die Beschreibung der Desoxyribonukleinsäure (DNA) als Träger der Erbsubstanz durch Watson und Crick [3] und andererseits durch die Entwicklung neuer Substanzen, die in den DNA-Stoffwechsel eingriffen, wie z. B. Purinanaloga wie 6-Mercaptupurin.
Der Beginn dieser „molekularen Ära“ markierte auch den Beginn des Verständnisses molekularer Pathomechanismen myeloischer Neoplasien. Durch den einfachen Zugang zu malignen Zellen hämatologischer Malignome aus dem Blut und dem Knochenmark entwickelten sich einige myeloische Neoplasien zu „Modellerkrankungen“ und Paradebeispielen translationaler onkologischer Forschung. Die diesbezüglich vielleicht bemerkenswerteste Erkrankung ist die chronische myeloische Leukämie (CML), deren Erforschungshistorie als grundsätzliche, erstrebenswerte Blaupause für die systematische Erforschung anderer hämatologischer wie auch solider Neoplasien dient und daher kurz dargestellt wird.
Nachdem es im Rahmen der Erforschung der Struktur der Erbsubstanz in den 1950er Jahren möglich geworden war, den menschlichen Chromosomensatz darzustellen [4], ermöglichte dies wenige Jahre später die erste Identifikation einer spezifisch in Leukämiezellen erworbenen chromosomalen Veränderung, des „Philadelphia-Chromosoms“ in der chronischen myeloischen Leukämie (CML). Die Entdeckung des Philadelphiachromosoms in CML-Zellen war der historische Startschuss für die bisher erfolgreichste Umsetzung translationaler molekularer Hämatologie zum Wohle von Leukämiepatienten. Nach Weiterentwicklungen der zytogenetischen Analysemethoden für Chromosomen wurde das Philadelphia-Chromosom 1972 als balancierte Translokation zwischen Chromosom 9 und 22 beschrieben [5]. Molekularbiologisch erfolgte 1977 und 1978 durch Maxam, Gilbert und Sanger erstmals die Entwicklung von Methoden zur Sequenzierung der Basenabfolge in der DNA [6]. 1985 gelang daraufhin durch Heisterkamp und Groffen die molekulare Charakterisierung des aus dem Philadelphia-Chromosom entstehenden genetischen Fusionsproduktes „BCR-ABL1“ aus Teilen des BCR-Gens auf Chromosom 22 und des ABL-Gens auf Chromosom 9 [7]. Ein erneuter Meilenstein der Molekularbiologie war 1986 die Entwicklung der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die es fortan ermöglichte, sequenzspezifisch DNA-Abschnitte beliebig exponentiell zu amplifizieren. Im Zuge dessen wurde das BCR-ABL1-Gen ausführlich charakterisiert, und es konnte gezeigt werden, dass das BCR-ABL1-Onkogen alleine ursächlich für die Entstehung einer CML ist. Diese Erkenntnis führte schließlich im Jahre 1996 zur Entwicklung des Tyrosinkinaseinhibitors Imatinib [8], welcher es ermöglichte, spezifisch das onkogene Wachstumssignal des BCR-ABL1-Fusionsgens zu hemmen. Damit stand zum ersten Mal ein Medikament in Tablettenform zur Verfügung, das gezielt gegen eine leukämiespezifische molekulare Läsion gerichtet war und daher eine extrem erfolgreiche und zugleich nebenwirkungsarme Therapie einer Krebserkrankung erlaubte. Durch die Therapie von CML-Patienten mit Imatinib oder dessen Nachfolgersubstanzen ist die CML heutzutage wie eine chronische Erkrankung zu behandeln, und die mediane Überlebenszeit von CML-Patienten wird auf > 20 Jahre geschätzt [9].
Dieses Paradebeispiel erfolgreicher molekularer Leukämieforschung dient seitdem als Vorlage zur Übertragung und Nachahmung für andere Leukämiearten. Diese Geschichte zeigt auch, dass die hämatologische Forschung traditionell eng mit molekularbiologischer Forschung verbunden ist, da methodologische Fortschritte in der Molekularbiologie konsekutiv auch immer zu Erfolgsschüben in der Leukämieforschung geführt haben. Leider konnte dieses Prinzip in den allermeisten hämatologischen Neoplasien bisher nicht auf ähnlich erfolgreiche Weise reproduziert werden, da die molekulare Pathogenese anderer Entitäten oftmals vielschichtiger zu sein scheint als in der CML. Dies könnte sich allerdings in den nächsten Jahren durch Anwendung erneuter technischer Revolutionen im Bereich der Molekularbiologie, wie z. B. im Next Generation Sequencing (NGS), durch Einzelzellanalysen und Hilfestellung durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) möglicherweise ändern. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die aktuellen Hypothesen und molekularen Erkenntnisse zu den myeloischen Neoplasien dargestellt.
1.1.2 Stammzellkonzept myeloischer Neoplasien
Das Verständnis, die systematische Einteilung und Nosologie myeloischer Neoplasien leitet sich aus der Entwicklungshierarchie der normalen Hämatopoese ab. Im klassischen Modell gleicht die Hämatopoese einer Art Pyramide, an deren Apex die multipotenten hämatopoetischen Stammzellen (HSC) stehen. Diese HSC bilden ein Reservoir an Zellen, die in der Lage sind, die Blutbildung lebenslang aufrechtzuerhalten. Neben der Produktion reifer und funktioneller Blutbestandteile ist die Besonderheit der HSC per Definition ihre Fähigkeit, sich auch selbst zu erneuern (Selbsterneuerungskapazität). In der normalen Blutbildung wird diese Selbsterneuerung streng kontrolliert. Durch die reguläre Zellteilung der Stammzellen entstehen multipotente Progenitorzellen (MPP) – anstatt neuer undifferenzierter HSC. Durch weitere schrittweise Restriktion des Differenzierungspotenzials entwickeln sich aus den MPP entlang einer verzweigten Hierarchie immer spezialisiertere Linien der Hämatopoese. Bereits auf Ebene der MPPs erfolgt als nächster Schritt in der Hierarchie eine relative Festlegung über die Entwicklung entweder in die lymphatische Reihe zu (common) lymphatischen Progenitorzellen oder Progenitorzellen der myeloischen Reihe, wie z. B. erythropoetische, granulopoetische, monozytäre, megakaryozytäre und ggf. dendritische Progentiorzellen, die dann über Expansionsteilungen in weiteren Differenzierungsschritten massenhaft ihre reifen Zielzellen produzieren. Die Hypothesen über die Definitionen, Schwellenwerte, Trennschärfe und Struktur des Verzweigungsbaums der hämatopoetischen Entwicklungshierarchien wurden im Verlauf der letzten Jahre immer wieder verfeinert und teilweise kontrovers diskutiert [10], was bisher jedoch nichts Grundlegendes am Stammzellkonzept der Hämatopoese geändert hat.
Die Nosologie der bekannten myeloischen Neoplasien leitet sich grob vereinfacht aus dem Differenzierungsbaum der oben beschriebenen myeloischen Differenzierungslinien ab. Je nachdem, welchem Differenzierungsstadium die zu klassifizierenden malignen Zellen phänotypisch und molekular am ähnlichsten sind, erfolgt ihre komplexe Klassifizierung (s. Kap. 2). Dennoch gilt auch für die myeloischen Neoplasien die Hypothese eines Stammzellkonzeptes, wonach die jeweiligen Erkrankungen nur durch sogenannte „leukämische Stammzellen“ mit Selbsterneuerungskapazität aufrechterhalten werden können. Selbsterneuerungskapazität wird klassischerweise durch die Fähigkeit der Repopulation und Ausdifferenzierung in Xenograftversuchen nachgewiesen. Für myeloische Neoplasien wurden diese Versuche erstmals in den 1990er Jahren mit Zelle...