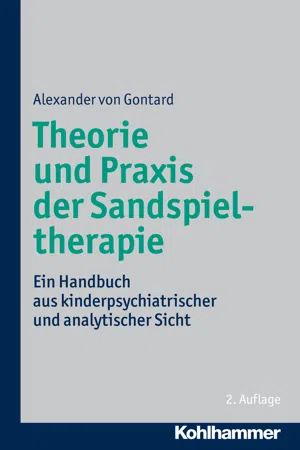
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Theorie und Praxis der Sandspieltherapie
Ein Handbuch aus kinderpsychiatrischer und analytischer Sicht
- 268 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Theorie und Praxis der Sandspieltherapie
Ein Handbuch aus kinderpsychiatrischer und analytischer Sicht
About this book
Die Sandspieltherapie basiert auf der analytischen Psychologie C.G. Jungs und eignet sich besonders für emotionale, introversive Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Dabei werden Miniaturfiguren als Medium verwendet, die in Sandkästen aufgestellt werden. Das Buch gibt einen Überblick über die Sandspieltherapie und ihren Stellenwert in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Viele Beispiele zeigen, dass sich psychodynamische und klinische, symptomorientierte Zugänge positiv ergänzen."... ein sehr fundiertes, gut lesbares Buch." (Kinderanalyse 17/2009)
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Theorie und Praxis der Sandspieltherapie by Alexander von Gontard in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Psychology & Psychotherapy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Einleitung
Miniaturwelten haben schon immer für Kinder und Erwachsene eine Faszination ausgeübt: Gerade Spielsachen sind in ihrer verkleinerten Abbildung der „realen Welt“ so ansprechend – seien es die detaillierten Puppenstuben, die Gebirgslandschaften der Eisenbahnen, Autos oder Flugzeugmodelle, Indianerfiguren oder Puppen. Auch die Faszination von Freizeitparks wie „Legoland“, beruht auf der Miniaturisierung, die einen Gesamtüberblick wie aus einer Vogelperspektive ermöglicht. In japanischen Gärten werden mit geschicktem Einsatz von perspektivischen Mitteln eine Landschaft oder sogar der Kosmos in einem kleinen umschriebenen Areal gebildet. Kultfiguren verschiedenster Religionen werden in Miniaturform – seien es Marien-, Jesus- oder Buddhafiguren – an Wallfahrtsorten verkauft und zu Hause aufgestellt.
Auch gehört der Kontakt mit dem Medium Sand in unserer Gesellschaft zu den ubiquitären Kindheitserfahrungen. Wer kann sich nicht an das Spiel mit Wasser und Sand erinnern, an die Türme, Berge, Burgen und Strassen aus feuchtem Sand und an das weiche Gefühl des trockenen Sandes? An das Herumtoben und Springen von Dünen?

Abb. 1.1: Victoria und Christiane, White Sands, 1972

Abb. 1.2: Sandgestaltung links Kinder, rechts Erwachsene: Der Sand lädt ein zu spontanen Gestaltungen – bei Kindern und Erwachsenen
Neben dem begrenzten Raum des Sandkastens bietet das Spielen am Meer ganz andere Assoziationen. Unendliche Weiten, das Rauschen der Wellen und blaue Farben. Mit großen Sandmengen werden Bauwerke geschaffen, in denen man selber stehen kann, die gegenüber der einströmenden Flut verteidigt, doch irgendwann von den Wellen angenagt werden und untergehen. Der Sand dient als Symbol des Entstehens und der Vergänglichkeit und wird als solches von allen verstanden – vielleicht gerade wegen den besonderen taktilen Eigenschaften dieses Mediums.
Diese Elemente kommen in der Sandspieltherapie zusammen – und dennoch sind es nicht die Figuren oder der Sand alleine, die eine Veränderung bewirken. Spiel an sich ist heilsam – aber nicht im therapeutischen Sinne. Therapie wird erst durch eine besondere Form der Beziehung ermöglicht. Dora Kalff sprach von einem „freien und geschützten Raum“, der in der Sandspieltherapie entsteht. Frei bedeutet, dass der unmittelbare Ausdruck des bewussten, wie auch unbewussten Erlebens ohne Einschränkungen möglich ist. Die leeren Kästen dienen als Projektionsfläche, in denen die „Innenwelt“ nach außen projiziert und mit Hilfe der Miniaturfiguren aufgebaut wird. Der Begriff „Seelenbilder“ ist deshalb sehr zutreffend. Im Gegensatz zur Trauminterpretation oder zu Tagtraumtechniken sind die Symbole des intrapsychischen Geschehens offen sichtbar und können nicht bewusst abgestellt oder ausgewichen werden. Die Konfrontation mit dem Unbewussten ist konkreter, unmittelbarer und heftiger als bei anderen Therapieformen – und muss vom Patienten ausgehalten und verstanden werden. Hierzu ist der „geschützte“ Raum notwendig. Der Therapeut setzt die Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Ablauf) und schützt den Patienten, so dass Gefühle, Impulse und Symbole integriert werden können. Die Sandspieltherapie ist in ihrer Wirkung eine sehr intensive analytische Methode, die über den „Umweg“ des Sandbildes eine unmittelbare Äußerung von Übertragung und Gegenübertragung ermöglicht. Im Sandbild zeigt sich das Unbewusste von Patient und Therapeut, so dass in diesem Fall treffenderweise von einer „Co-Übertragung“ gesprochen wird.
In diesem Buch soll versucht werden, diese faszinierende und wirksame Therapiemethode in einem klinischen Kontext darzustellen. Es geht dabei um die Sandspieltherapie als therapeutische Methode bei Patienten mit klinisch ausgeprägten psychischen Störungen, wie sehr eindrücklich von Zoja (2004) dargestellt – und nicht als Selbst- oder „Transformations“erfahrungen bei relativ gesunden Menschen. Auch wird sich auf die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen beschränkt, obwohl viele Aussagen und Beobachtungen auch für Erwachsenentherapien zutreffen.
Neben dem theoretischen Hintergrund wird ein Schwerpunkt auf die praktische Durchführung gesetzt, und zwar im Kontext anderer therapeutischer Methoden. Es geht nicht um eine Idealisierung der Sandspieltherapie, sondern um ihre Einbettung in die vielen wichtigen Erkenntnisse, die die Kinder- und Jugendpsychiatrie in den letzten Jahrzehnten gewonnen hat. So ist die Sandspieltherapie nicht bei allen Störungen gleichermaßen geeignet. Nach einer ausführlichen Diagnostik sollte immer eine differentielle Therapieindikation gestellt werden. Ist die Sandspieltherapie am besten für diese spezielle Störung geeignet, dann kann sie alleine durchgeführt werden. Ist eine Kombination mit anderen Therapieformen sinnvoller, dann sollte eine solche Verbindung gewählt werden. Sind aber andere Methoden, wie zum Beispiel verhaltenstherapeutische Zugänge wirksamer, dann sollten jene alleine bevorzugt werden.
Das Buch folgt folgendem Aufbau:
Im 2. Kapitel wird die Sandspieltherapie nach Dora Kalff im Kontext anderer Formen der Spieltherapie dargestellt. Nach einer allgemeinen Definition von Psychotherapien mit dem Medium des Spiels werden die verschiedenen spieltherapeutischen Zugänge zusammengefasst.
Wie im 3. Kapitel dargestellt, ist die Kenntnis der wissenschaftstheoretischen Hintergründe für die Sandspieltherapie als analytische, hermeneutisch-verstehende Therapieform von besonderer Bedeutung. Ebenso sind die Ergebnisse der empirischen Psychotherapieforschung bei Kindern und Jugendlichen nicht zu vernachlässigen.
Im 4. Kapitel werden die theoretischen Hintergründe der Sandspieltherapie vermittelt, ihre Geschichte, Methodik und ein Überblick über die bisher veröffentlichen Monographien leitet das Kapitel ein. Die Kenntnis der Symbolsprache und der analytischen Psychologie C.G. Jungs ist dabei unerlässlich. Auf einen vollständigen Überblick wurde in diesem Kontext verzichtet, stattdessen sollen die für Kinder und Jugendliche wichtigen Aspekte akzentuiert mit praktischen Hinweisen dargestellt werden. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Kapitels ist die enge Verbindung von meditativen, spirituellen Traditionen und Therapie. Dieses mag für Jungianer vertraut sein, wird aber möglicherweise für Therapeuten anderer Richtungen ungewohnt wirken. Deshalb werden die Berührungspunkte von Psychotherapie und Spiritualität ausführlich behandelt.
Das 5. Kapitel widmet sich der Praxis der Sandspieltherapie. Vor jeder Behandlung sollte eine ausführliche Diagnostik erfolgen, sowohl aus kinderpsychiatrischer, als auch aus analytischer Sicht. Das therapeutische Vorgehen wird ausführlich und praxisnah im Verlauf dargestellt.
Im 6. Kapitel werden Sandspielprozesse bei speziellen Störungsbildern beispielhaft dargestellt und mit Bildern aus Therapiestunden illustriert. Gerade durch diesen optischen Eindruck kommt die Intensität des Prozesses zum Ausdruck. Wiederum gilt es in allen Kasuistiken, die Sandspieltherapie im relativen Kontext zu anderen Therapieformen zu zeigen.
Den Lesern wird eine anregende Lektüre, kritische Auseinandersetzung und eigene Weiterentwicklung der geäußerten Ideen gewünscht – für die eigene Individuation, wie auch die ihrer Patienten.
2 Sandspieltherapie im Kontext anderer Formen der Spieltherapie
2.1 Definition von Psychotherapien mit dem Medium des Spiels
Spieltherapien können als Psychotherapien mit dem Medium des Spiels definiert werden, die sich bezüglich der theoretischen Voraussetzung, wie auch der konkreten Praxis unterscheiden. Es gibt somit nicht „die Spieltherapie“, sondern verschiedene Zugänge, die je nach Therapieschule eine unterschiedliche Gewichtung und Ausdifferenzierung erfahren haben.
Eine der allgemeinen Definitionen von Spieltherapie, wie sie von der „Association of play therapists“ formuliert wurde, lautet: „Spieltherapie ist der dynamische Prozess zwischen Kind und Spieltherapeut, in dem das Kind jeweils in seinem eigenen Tempo und Art und Weise die gegenwärtigen und vergangenen, bewussten wie auch unbewussten Themen untersucht, die sein Leben beeinflussen. Die inneren Ressourcen des Kindes ermöglichen, dass die therapeutische Beziehung zu Wachstum und Veränderung beiträgt. Spieltherapie ist kindzentriert, Spiel ist das primäre und Sprache das sekundäre Medium“ (West, 1996, S. xi).
In dieser komprimierten Definition klingen viele allgemeingültige Aspekte der Spieltherapien an. Im Zentrum steht die direkte Behandlung des Kindes, die als Einzel- oder Gruppentherapie durchgeführt werden kann. Elterngespräche begleiten in regelmäßigen Abständen (z. B. jede 4. oder 5. Stunde) die Therapie des Kindes – sie sind jedoch nicht das Hauptagens der therapeutischen Intervention, wie z. B. beim reinen Elterntraining.
Je nach Grad der Strukturierung bestimmt das Kind weitgehend den Inhalt, Ablauf und das Tempo der Therapie. In diesem Prozess ist tatsächlich das Spiel das primäre Medium, über das Phantasien und Konflikte symbolisch dargestellt werden. Gespräche können begleitend zum Spiel oder auch intermittierend auf Wunsch des Kindes geführt werden, stellen jedoch nicht das entscheidende therapeutische Agens dar. Es ist erstaunlich, wie wenig in manchen Therapien gesprochen wird und wie erleichtert manche Kinder darüber sind.
Das am besten geeignete Alter für eine Spieltherapie reicht vom Alter von 4–11 Jahren, mit einer maximalen Spanne von 2½–12½ Jahren. Bei jüngeren Kindern ist eine Einzeltherapie nicht sinnvoll, da Trennungsängste des Kindes den therapeutischen Prozess eher negativ beeinflussen können. Je jünger das Kind ist, desto eher zeigt sich die Problematik in der direkten Beziehung zu den Eltern, die in den therapeutischen Prozess einbezogen werden müssen (Zero to Three, 1995). Bei Kleinkindern ist es durchaus möglich, dass die Einzeltherapie in Anwesenheit der Eltern durchgeführt wird. Für noch jüngere Kleinkinder und Säuglinge wurden spezielle Eltern-Kind-Interaktionstherapien entwickelt. Dagegen ist eine Spieltherapie bei älteren Kindern und sogar Jugendlichen oft möglich. Obwohl Jugendliche das Spiel zunächst als kindlich ablehnen, finden manche rasch einen Zugang, sobald sie sich sicher und geborgen fühlen und sich auf die Schweigepflicht des Therapeuten verlassen können. Manche Formen der Spieltherapie, z. B. die Sandspieltherapie, lassen sich während des gesamten Erwachsenenalters – sogar bis ins hohe Greisenalter – sinnvoll einsetzen.
Da die Interaktion zwischen Therapeut und Kind entscheidend ist und eine Veränderung des kindlichen Erlebens und Verhaltens über die therapeutische Beziehung erreicht werden soll, setzen alle Therapieformen eine intensive Ausbildung voraus. Diese schließt neben Theorie und Supervision immer auch eine eigene Selbsterfahrung mit ein. Ohne die letztere ist es nicht möglich, das Erleben des Kindes und die eigene psychische Problematik genügend zu differenzieren, um eine für das Kind produktive Veränderung zu ermöglichen. Wie es West (1996) treffend formulierte: „Jeder trägt Relikte seiner eigenen Kindheit und Familie mit sich, die den kindzentrierten Zugang des Therapeuten behindern, wenn sie nicht gelöst, bearbeitet oder neu formuliert werden“ („everyone has relicts from their own childhood and family life that, if not released, resolved or refrained, might impair the inspiring play therapist’s ability to be child centered“).
Bei der Wahl der Spieltherapieform sind zwei Faktoren entscheidend: die Therapie muss für das Störungsbild des Kindes indiziert und wirksam sein; und sie muss der Persönlichkeit des Therapeuten entsprechen. Wie O’Connor und Braverman (1997, S. 1) es treffend ausdrückten: „Es ist unser Glaube, dass man als kompetenter Spieltherapeut ein Modell finden muss, das die eigene Persönlichkeit und die spezifischen Bedürfnisse der Klienten entspricht“ („it is our belief that to become a competent play therapist, one must find a model that measures well with both one’s personality and the needs of one particular client base“).
Da keine Therapieform für alle Indikationen wirksam sein kann, ist es heutzutage wünschenswert, wenn ein Therapeut neben der eigenen Therapierichtung über Kenntnisse anderer Therapieschulen verfügt. In anderen Worten, sollte z. B. ein Therapeut mit einer Ausbildung in tiefenpsychologisch-fundierter Psychotherapie durchaus über Kenntnisse der Verhaltens- und Familientherapie verfügen – und vice versa. Dadurch erhöht sich die Flexibilität des therapeutischen Handelns erheblich, verschiedene Zugänge können kombiniert werden, und die Bedeutung der eigenen Therapieform wird relativiert.
Differenzen zwischen Spieltherapieansätzen
Neben diesen vielen Gemeinsamkeiten finden sich auch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Spieltherapieschulen. Die Spieltherapien unterscheiden sich zunächst allgemein bezüglich ihres theoretischen Schwerpunktes, wie in den folgenden Kapiteln dargestellt. Folgende spezielle Unterschiede zeigen sich im direkten Vergleich verschiedener Zugänge: So ist bei manchen Spieltherapien das direkte, beobachtbare Verhalten des Kindes entscheidend – andere legen den Schwerpunkt auf das intrapsychische Erleben und weniger auf das manifeste Verhalten. Manche Therapieschulen fokussieren ausschließlich auf bewusste Inhalte, wie die personenzentrierten Zugänge, für andere dagegen sind unbewusste Determinanten entscheidend (tiefenpsychologische Schulen). Auch unterscheidet sich der Grad der Verbalisierung deutlich: bei verhaltenstherapeutischen Schulen wird eher viel und direkt mit dem Kind gesprochen, andere, wie beispielsweise die Sandspieltherapie, versuchen dem nicht...
Table of contents
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Sandspieltherapie im Kontext anderer Formen der Spieltherapie
- 3 Unterschiedliche Zugänge zur Sandspieltherapie
- 4 Sandspieltherapie – theoretischer Hintergrund
- 5 Praxis der Sandspieltherapie
- 6 Sandspiel bei speziellen Störungsbildern
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
- Literatur
- Anhang
- Stichwortverzeichnis