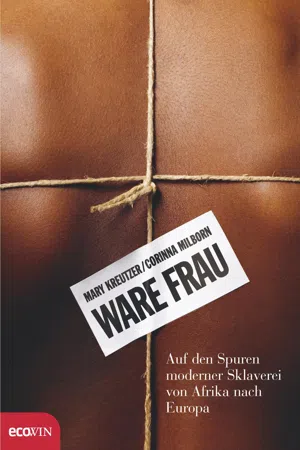Frauen, die nach Europa verkauft werden, müssen erst die Grenzen überwinden. Je höher die Mauern der Festung Europa, umso schwerer ihre Wege: Wurde die Ware Frau in den 1990er Jahren noch per Direktflug geliefert, werden die Frauen und Mädchen heute oft auf unvorstellbare Odysseen durch die Sahara geschickt.
Florence: Durch die Wüste
Wir treffen Florence in einem Kaffeehaus in einem Außenbezirk von Málaga im Süden Spaniens. Der geflieste Boden ist mit zerknüllten Papierservietten übersät, an der Bar trinken Männer Anisschnaps. Es ist später Vormittag, und der Raum hält die Luft an, als Florence vor der Türe erscheint. Sie ist groß, schlank, trägt dunklen Lippenstift und enge Jeans. Ihre roten Haar-Extensions sind lang und glatt. Durch die Glasscheibe betrachtet, sieht Florence aus wie von einer anderen Welt – zu schön für dieses arme Viertel mit den bierbäuchigen Männern in Unterhemden und Maurerhosen.
Als sie uns gegenübersitzt, den Blick auf den Tisch gerichtet, zerfällt der erste Eindruck einer entrückten Schönheit in den Details. Dicke Schminke überdeckt die Narben, die die Bleichcremes im Gesicht hinterlassen haben. Unter dem linken Schlüsselbein hat sie eine tiefe Narbe – wahrscheinlich von einem Schnitt bei einem Juju-Ritual. Am schlimmsten sind aber die Augen, so schön geschminkt hinter den roten Stirnfransen. Es ist nicht einfach, diesen dauerhaft erschrockenen, leeren Blick von traumatisierten Frauen zu beschreiben. Aber man erkennt ihn, wir haben ihn bei dieser Recherche oft gesehen.
Florence stammt aus Nigeria. Vor fünf Jahren hat sie ihre Heimat verlassen. Seit drei Jahren lebt sie in Europa. An diesem Vormittag und dem Abend darauf erzählt sie von den zwei Jahren dazwischen: der Reise durch die Wüste.
Ich war 17, als ich in Benin City in der Schule von einem Freund angesprochen wurde, ob ich als Kindermädchen in Europa arbeiten wolle. Mein Vater hatte unsere Familie verlassen, unsere Mutter hat nur ein kleines Geschäft auf dem Markt. Ich hätte sowieso mit der Schule aufhören müssen. Aussichten auf Arbeit in Nigeria gab es für mich keine. Der Freund organisierte die Papiere – einen Pass, nicht auf meinen Namen, aber mit meinem Foto. Es ging dann alles sehr schnell. Nach einer Woche war ich weg. Der Trolley fuhr mit mir.
In Kano, einer Stadt im Norden Nigerias, wartete ich drei Tage in einem Haus, bis wir fünf Mädchen waren, alle aus Edo State. Wir waren sehr aufgeregt. Mit dem Bus fuhren wir nach Niamey in Niger. Man brachte uns in ein Haus mit einem großen Hof. Wir schliefen in einer Art Stall auf dem Boden. Dort begann der Albtraum.
In Niamey wurden wir zum ersten Mal verkauft. Wir befanden uns schon zwei Wochen in dem Haus, es schien ein Problem zu geben. Der Trolley holte ein Mädchen nach dem anderen aus dem Verschlag im Hof. Ich war das vierte. Er übergab mich einem Mann, der war groß, trug eine runde Mütze und ein langes, dunkelblaues Gewand. Er hatte besonders viel für mich gezahlt, weil ich Jungfrau war.
In dieser Nacht versuchte ich wegzulaufen. Ich wollte zurück zu meiner Mutter. Der Trolley erwischte mich jedoch und schlug mich halb tot. Zwei anderen Mädchen erging es gleich. Nur eines war einfach geblieben, es saß stumm in der Ecke, als ich wieder in den Stall kam. Eines war verschwunden, es hatte es wohl geschafft, zu fliehen. Ich hörte nie wieder von ihm.
Irgendwie zerbrach ich in dieser Nacht psychisch. Davor war ich in die Schule gegangen, hatte Hoffnungen gehabt und gedacht, ich könnte alles tun. Ich hatte das Leben vor mir gehabt. Danach war ich nur mehr beschädigte Ware. Damaged goods. Alles, was danach kam, nahm ich nur mehr hin.
In einem weißen Pick-up fuhren wir von Niamey nach Mali. Das Auto schmuggelte Zigaretten und zwölf Menschen. Wir saßen einer über dem anderen, Männer und Frauen durcheinander. Zum Glück konnte ich ganz oben sitzen. Die Frauen ganz unten waren so zerquetscht, dass ihre Beine beim Aussteigen einknickten, und sie konnten nicht mehr aufstehen. Die Grenze überquerten wir ohne Licht in der Nacht auf einer Piste.
Die letzte Stadt vor der Wüste heißt Gao. Sie ist groß und staubig, und die Leute sehen anders aus als in meiner Heimat. In Gao mussten wir uns zum ersten Mal alle richtig verstecken. Ab dort beginnt die Jagd auf Flüchtlinge – denn man sieht, dass sie von woanders herkommen. Es war das erste Mal, dass wir in einem Ghetto landeten.
Ein Ghetto kann ein Hinterhof sein, ein Zeltlager oder einfach nur ein Bretterverschlag ohne Dach. Die Ghettos liegen in Nebenstraßen oder in der Wüste draußen, vor den kleinen Dörfern, zwischen Felsen versteckt. Die Ghettos sind Sammelstellen für jene, die durch die Wüste wollen. Es gibt eigene Ghettos für jedes Land, so ist man immer mit Nigerianern zusammen. So wird man ständig kontrolliert.
Jedes Ghetto hat einen Chef, den man bezahlen muss. Der Ghetto-Chef organisiert das Essen und vermittelt Guides – Führer – für die Weiterfahrt. Alle wollen möglichst schnell weg. Aber viele bleiben Monate.
Im Ghetto leben alle durcheinander, Männer und Frauen, in manchen 30 oder 40, in manchen auch mehr als 100. Es war so eng, dass wir fast übereinander schliefen. Wir hatten nichts anzuziehen und keine Tücher, wenn wir die Regel hatten – wir mussten einfach schmutzig bleiben. Man muss sich verstecken. Draußen wird man von der Polizei gejagt.
Man isst alles Mögliche im Ghetto – Ziegenfüße, Hühnerhälse, Schafsaugen. Es gibt nur einen großen Topf für alle. Es wird eine Suppe gekocht, in die alles reinkommt, was der Ghetto-Chef auftreiben kann. Manchmal bekommen die Männer etwas geschenkt, wenn sie am Busbahnhof Lastwagen ausladen helfen. Meist gibt es aber nur einen Mehlbrei aus Hirse, eine Handvoll für jeden. Man isst einmal am Tag, und manchmal isst man gar nicht. Man hat immer Hunger. Einmal stahl ein Junge Brot des Ghetto-Chefs. Er wurde dafür beinahe totgeschlagen.
Wir blieben fast drei Monate in Gao. Unser Trolley besaß nicht genug Geld für die Weiterreise – die Führer, die den Weg durch die Wüste kennen, sind teuer. Dann holte er uns in der Nacht aus dem Ghetto und brachte uns in weit entfernte Seitengassen. Er stand an der Ecke und hielt Wache. Ich sah seine Zigaretten glühen und zählte die Zeit nach den Zügen, die er nahm. Zwei Zigaretten lang braucht ein Mann in Gao, manche drei.
Ich wollte nur mehr sterben. Aber ich konnte nicht weglaufen – sie hätten mich erschlagen. Irgendwie lebt man also trotzdem weiter. Mir war inzwischen egal, ob es vorwärts ging, zurück gab es jedenfalls keinen Weg mehr. Ich will nie wieder zurück.
Florence zuckt zusammen und sieht nach draußen. Es wird laut auf Arabisch diskutiert, auf dem Gehsteig steht eine Traube Marokkaner, Streit ist ausgebrochen. Palma Palmilla, in dessen Zentrum wir hier sitzen, ist das ärmste Viertel Málagas. Ursprünglich wurden die rotbraunen Wohnblöcke für „Gitanos“, die spanischen Roma, gebaut. Heute leben hier vor allem Einwanderer aus dem Maghreb und Afrika. Viele Häuser sind baufällig, haben kein Fließwasser, es fehlen Fensterscheiben. Florence wohnt hier in einer Wohnung mit fünf anderen Nigerianerinnen und der Madame. Sie zahlt 400 Euro Miete im Monat – für einen Schlafplatz in einem Vierbettzimmer. Aber woanders darf sie nicht wohnen, sagt sie. Für viele wie Florence ist es ein Ort des Grauens. Wenn Florence das Erzählte zu viel wird, atmet sie schneller, schnappt nach Luft, aber sie hört nicht auf. Sie erzählt immer schneller weiter, bis eine atemlose Flut monotoner Silben aus ihr herausströmt, wild gemischt aus nigerianischem Pidginenglisch und andalusischem Spanisch. Als müsste sie es hinter sich bringen, möglichst schnell, als würde es jemand von ihr verlangen, kein Detail auszulassen.
Eines Tages ging die Reise weiter. Ein Stück noch mit einem Bus – aber dann fängt die Wüste an. Ab da muss man seine Füße verwenden, um weiterzukommen. Der erste Abschnitt dauerte sieben Tage lang. Wir waren eine Gruppe von über 60 Leuten, die meisten kamen aus Nigeria, ein paar aus Ghana. Jeder erhielt einen Kanister Wasser und eine bestimmte Art Brot. Sonst durfte man nur ein Tuch mithaben, alles andere wäre zu schwer.
Die Wüste ist die Hölle. Tagsüber ist es so heiß, dass man fast nicht laufen kann. Der Sand brennt wie Feuer unter den Füßen. Ich trug nur Gummisandalen, die wurden so weich, dass sie an meinen Füße klebten. Schließlich wickelte ich zwei abgerissene Teile meines Tuches um die Füße, um weitergehen zu können. Später gab mir der arabische Führer Ledersandalen. Er hatte sie einem Toten weggenommen, der am Rand des Weges lag. Ich nahm sie, es blieb mir nichts anderes übrig.
Es liegen viele Tote dort am Weg. Manche sind nur mehr Skelette, andere erst vor Kurzem gestorben. Die meisten sind schwarz. Man nimmt sich ihre Kleider und Tücher, lässt die eigenen kaputten zurück. Ich versuchte immer wegzusehen. Ich wollte niemanden aus meiner Stadt in der Wüste liegen sehen.
Florence trinkt Kamillentee. Sie schüttet beide Säckchen Zucker in den Tee und faltet dann die Papierhüllen zu schmalen Ziehharmonikas, während sie leise spricht. Ihre langen Nägel mit dem rosa Lack klackern dabei aneinander. Dann reißt sie das Papier in Streifen, die Streifen in kleine Quadrate, und macht Häufchen, zehn Quadrate pro Häufchen. Sie schiebt sie hin und her. Als gäbe es gerade nichts Wichtigeres auf der Welt, als Ordnung in Papierhäufchen auf einem fleckigen Alu-Tisch zu bringen.
Wenn man durch die Wüste geht, braucht man ein großes Tuch. In der Nacht wickelt man sich darin ein, auch den Kopf. Man steckt seine Sandalen aufrecht in den Sand, dem Wind zugewandt, und legt den Kopf dahinter. So wird man nicht so leicht verweht. Trotzdem muss man sich jeden Morgen freischaufeln. Wenn wir in der Früh aufwachten, lagen wir in einem Grab aus Sand. Wir schliefen in Gräbern. – Oft wacht jemand einfach nicht mehr auf. Man sagt dann, er sei erfroren.
Am vierten Tag blieb eines von uns Mädchen zurück. Favour war ein Jahr jünger als ich, 16 Jahre alt. Sie war die beste in der Tanzgruppe unserer Schule in Benin City. Sie war schon schwach, als wir losgingen. Sie litt an einer Unterleibsentzündung, hervorgerufen durch die Arbeit in Gao. Beim Gehen bekam sie Fieber und blieb immer weiter zurück. Einer der Männer trug sie noch eine Zeit lang. Am Abend kam er ohne sie, weit nach den anderen, zu den Felsen, bei denen wir schliefen. Er sagte, eine andere Gruppe hätte sie aufgenommen. Ich wusste, dass er sie allein zurückgelassen hatte. Aber ich konnte nichts tun: Wer liegen bleibt, stirbt. Wer die Toten sucht, ist bald selber tot. Es gibt kein Zurück in der Wüste.
Der nächste Abschnitt durch die Wüste war der längste – ein Fußmarsch von zwei Wochen. Unsere Gruppe war nun sehr groß, sie umfasste über 100 Leute. Jede Woche gehen solche Gruppen los, manchmal auch jeden Tag. Es ist eine Massenwanderung durch die Wüste. Von unserer Gruppe kam nur knapp mehr als die Hälfte in Tamanrasset an.
Florence trinkt noch einen Tee, schüttet Zucker hinein, rührt um, zerreißt die Papierhüllen in kleine Quadrate, ordnet sie zu Häufchen. Dann wischt sie plötzlich alle vom Tisch, sie segeln wie Schneeflocken auf den verklebten Boden. „Zuckerwasser. Wir haben so lange nur von Zuckerwasser gelebt“, sagt sie. Wir geben ihr eine Zigarette. „Mach eine Pause“, sagen wir. „Nein, ich will reden“, antwortet sie. Das Ziehen an der Zigarette beruhigt ihren Atem. Sie bestellt noch einen Tee. Der andere steht unberührt da.
Die Guides sind hier bewaffnet, sie schützen die Gruppe mit Gewehren. Auch die Nigerianer tragen Waffen. Die Gruppen von Afrikanern werden oft überfallen, weil die Algerier glauben, dass sie viel Geld für die Überfahrt bei sich tragen – von der Polizei, von Räubern und Rebellen. Man weiß hier nicht so genau, wer wer ist.
Auf diesem Marsch ging uns das Wasser aus. Auf halber Wegstrecke sollte ein Pick-up warten, mit Wasser für alle. Er war nicht da. Vielleicht war er überfallen worden, vielleicht hatten wir den Weg nicht gefunden – wer weiß das schon, es sieht dort alles gleich aus: Sand, Steine, große Felsen. Es gibt nichts Grünes. Die Luft sieht oft aus wie ein See, knapp über dem Sand. Irgendwann geht man einfach auf dieses Wasser zu, auch wenn man weiß, dass da keines ist: „Nur bis zum Wasser kommen, dann hat man es geschafft. Bis zum Wasser ...“
Als das Wasser verbraucht war, mussten wir unseren Urin trinken. Frauen speichern mehr Wasser im Körper als Männer. Sie bettelten uns um unseren Urin und unser Regelblut an. Manche Frauen und Mädchen verkauften beides an sie. Wer keine Frau hat, die ihren Urin spendet, der verdurstet in der Wüste.
In Algerien muss man sich noch mehr verstecken als in Mali. Die algerische Polizei erhält nämlich Geld für jeden Afrikaner, den sie nach Mali zurückschickt. Immer wieder erwischt es ganze Gruppen, die zunächst in Wüstenlager und von dort mit Lastwagen an die Grenze gebracht werden. Man setzt sie mitten in der Wüste aus.
Man braucht gute Guides, um durch Algerien zu kommen. Man muss die Polizisten bestechen. Das letzte Stück der Reise muss man fahren, denn es gibt dort keine Möglichkeit mehr, versteckt zu Fuß zu gehen. Irgendwann wurde unsere Gruppe aufgehalten. Es gab eine lange Diskussion. Wir saßen am Boden, während die Guides verhandelten. Dann gingen Polizisten durch die Gruppen. Sie teilten uns nach Männern und Frauen auf. Wir Frauen mussten uns in einer Reihe aufstellen. Die Polizisten holten drei Frauen heraus. Ich war eine davon.
Ich war lange bei der Polizei, vielleicht zwei Wochen, vielleicht zwei Monate, ich weiß es nicht mehr. Wir waren in einer Zelle eingesperrt, und alle Polizisten benutzten uns. Einer nach dem anderen, jeden Tag, einfach nebeneinander. Es gab nicht einmal einen Vorhang zwischen uns. Damals lernte ich, mit meinem Geist wegzufliegen. Die ganze Zeit über im Gefängnis hatte ich geistig im Hof meiner Großmutter in Benin City verbracht, dort mit den Hühnern gespielt und gebetet. Sonst wäre ich gestorben.
Irgendwann holte uns der Trolley wieder von der Polizei ab. Der Rest unserer Gruppe war schon weit weg, wir fuhren daher mit einer anderen weiter. So kamen wir nach Maghnia, der letzten Stadt vor der Grenze zu Marokko. Da dachte ich zuerst schon, wir hätten es geschafft, das sei schon Europa – die Menschen sahen so anders aus, so weiß. Ich war bis dahin neun Monate unterwegs. Ich sollte noch weitere 15 Monate brauchen, bis ich nach Europa gelangte.
Florence zieht die Jacke aus und zerrt an den langen Ärmeln ihres T-Shirts. Man sieht trotzdem die Schnitte, eine Narbe neben der anderen, den ganzen linken Unterarm entlang, dunkle Striche in der Haut: jeder einzelne ein Zeugnis von inneren Qualen – Selbstverletzung.
Wir bestellen Wasser, große Flaschen, und trinken. Jeder Schluck scheint plötzlich kostbar. Florence hat draußen eine Freundin gesehen, sie springt auf, fällt ihr in die Arme, die beiden hüpfen umarmt auf der Stelle, die Freundin bewundert Florences Haare. Wir staunen, wie sie so schnell umschalten kann. Aber auch nach so viel Tod gibt es wohl einen Alltag, in dem man leben muss. Auch nach so viel Tod kann man wohl lachen, manchmal.
In Maghnia gibt es Dutzende Ghettos, versteckt in den Außenbezirken und Hinterhöfen der Stadt. Aus Maghnia kommt man schwer weg: Man muss über die Grenze nach Marokko, und das ist gefährlich. Am besten hat man auch schon das Geld in der Tasche und Kontakte für die Überfahrt, denn die Marokkaner kontrollieren streng. Deshalb gibt es in Maghnia viele, die monatelang auf eine Gelegenheit warten, das letzte Stück hinter sich zu bringen.
In Maghnia wurde ich wieder einem neuen Trolley übergeben. Vielleicht hatten sie uns auch einfach immer weiter verkauft – ich weiß es nicht. Ich glaube aber, die Madame wusste immer, wo ihre bestellte Ware gerade war. Der Trolley vermietete uns an Algerier, damit wir das Geld für die Überfahrt und unser Leben dort verdienen konnten. Jede von uns musste 2000 Euro aufbringen und noch mal so viel für die Trolleys. Wir arbeiteten wie im Akkord für die Algerier. Auch die Männer aus dem Ghetto, unsere eigenen Brüder aus Nigeria, bedienten sich an uns. Es gibt dort keine Moral mehr, es geht nur mehr ums Überleben. Die Menschen werden dort zu Tieren.
Wir blieben fünf Monate in Maghnia.
Eine von uns wurde schwanger und musste zu einem Arzt gehen. Sie wäre fast verblutet, sie lag wochenlang im Fieber – am Boden, im Ghetto. Wir anderen hatten Glück, Gott half uns. Kondome gibt es in Algerien nicht, sie sind sogar verboten. Den Männern ist es egal, sie werden nicht schwanger. Und wir sind den Männern egal.
Eines Nachts gelangten wir dann über die Grenze nach Marokko. Man muss dazu im Finstern durch ein trockenes Flusstal laufen. Es gibt viel Geflüster, manchmal sieht man Taschenlampen, die Stimmung ist sehr aggressiv. Es sind viele Flüchtlinge dort, viele Polizisten und auch viele Räuber, die den Flüchtlingen ihr Geld abnehmen.
Irgendwo wurde geschossen, ziemlich nah. Wir liefen geduckt und versteckten uns hinter Bü...