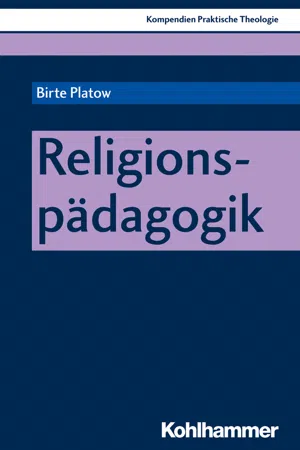Zunächst ist zu differenzieren zwischen Religionspädagogik in historischer Perspektive und einer ideengeschichtlichen Betrachtungsweise. Während erstgenannte die Genese und Fortentwicklung der Religionspädagogik (Kapitel 3) rekonstruiert, nimmt die Ideengeschichte epochentypische Mentalitäten und deren Umgang mit spezifischen Fragen – etwa nach der religiös begründeten Bildung des Menschen – in den Blick. Dabei geht es nicht um die lineare Rekonstruktion eines Werdegangs, sondern vielmehr um das Nachzeichnen markanter Motive, deren Vertiefung, Widerlegung, Abdankung und Neuinterpretation, um elementare Grundanliegen besser zu verstehen. Ein solches Leitmotiv stellt beispielsweise die Vision einer Möglichkeit dar, die in der christlichen Anthropologie begründet ist, konträr dazu die – ebenfalls theologisch argumentierende – Abrede eines solchen Potenzials. Bildung wäre dann eine von außen angewiesene Veränderung und ein Einfügen in Externes, etwa in die Anliegen einer fremden Instanz (der Gesellschaft oder eines ihrer Subsysteme). In einem solchen Falle wäre ›Bildung‹ somit wohl eher mit Sozialisation zu identifizieren.
Das skizzierte Spannungsfeld zeigt exemplarisch zwei Pole auf und verweist darauf, dass eine ideengeschichtliche Rekonstruktion der Religionspädagogik hilft, auch die Gegenwart und aktuelle Herausforderungen religiöser Bildung zu durchdenken.
Insofern trägt ein Gang durch die Ideengeschichte auch zur Orientierung und Argumentationsfähigkeit bei, zumal sich gegenwärtige Theoriebildung und Didaktik religiöser Bildung noch immer in Anlehnung oder Abgrenzung zu Grundideen ereignet und in nachfolgend skizzierten Paradigmen bewegt.
1.1 Altes Testament
Bereits in den Texten des Alten Testaments verdichten sich elementare Ansichten über Grundfragen von Bildung und rufen zu einer vielschichtigen Auseinandersetzung auf, etwa wenn sie die Beziehung von Mensch und Gott sowie die zwischen Menschen thematisieren und fragen: Was ist der Mensch? Wer kann er sein? Wer soll er sein? Etwas ernüchternd ist allerdings festzustellen: Direkt und argumentativ zusammenhängend findet sich wenig zu biblischen Erziehungs- bzw. Bildungsvorstellungen, weil das Thema explizit nur selten aufgegriffen wird.
1.1.1 Bildung als Erziehung in der Weisheitsliteratur
Grundfragen zur Bildung des Menschen sind unter anderem Gegenstand der Weisheitsliteratur, deren Ursprung nachexilisch zu datieren ist und eine Zeitspanne von ca. drei Jahrhunderten abdeckt (6.–3. Jahrhundert vor Christus). In diesem Zeitraum vollzieht sich eine Entwicklung in der Weisheitslehre: Die Sichtweise auf den Menschen und sein Bildungspotenzial wird zunehmend pessimistisch, das Ideal der Weisheit selbst brüchig, bis das Grundmotiv eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs schließlich gar nicht mehr trägt (vgl. Sprüche Salomons, Prediger/Kohelet, Hiob, Ester, Weisheitspsalmen 112, 127, 128, 133). »Weisheit meint [dabei] zunächst weniger die Fähigkeit, theoretisch-grundsätzliche Fragen zu beantworten, als sich im Lebensalltag zurechtzufinden, mit den Dingen und Menschen zurechtzukommen« (Schmidt 1989, 320). Weisheitslehre ist also eine Alltagsphilosophie oder eine Alltagsethik, und vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen zur Bildung zu interpretieren. Bildung (respektive ›Weisheit‹) bezeichnet eine spezifische Erkenntnis im Sinne einer persönlich nachvollzogenen Einsicht: Die Person, die zur wahren Erkenntnis Gottes, der Natur oder des Menschen findet und diese Einsicht in einen umfassenden Zusammenhang stellen kann, ist weise – und ist dies nur und erst von Gott her.
Die alttestamentliche Forschung ist sich über den sogenannten ›Sitz im Leben‹ der weisheitlichen Literatur allerdings nicht ganz einig. Möglicherweise gab es am Königshof eine Schule für Beamte oder sogar eine Schule für Weise. Es ist daher durchaus möglich, dass es im alten Israel zumindest zeitweilig neben den Ständen der Priester und Propheten auch den Berufsstand eines Weisen gegeben hat. Eine andere Theorie sieht den ursprünglichen Sitz im Leben in der Familie, in der der Vater die ihm selbst tradierten Sinnsprüche an die Söhne weitergibt. Weisheitliche Sinnsprüche sind nämlich Erfahrungswissen; sie zielen auf den Sachverstand von Handwerkern und Künstlern, Herrschern, Richtern oder auf eine allgemeine Lebensklugheit (Saur, Spieckermann, Finsterbusch u. a.) ab. Als solche könnten sie natürlich auch ohne institutionelle Anbindung tradiert und durch königliche Schreiber gesammelt und fixiert worden sein.
Auch wenn explizit schriftliche Befunde rar sind, gilt es in der Forschung als wahrscheinlich, dass es in Israel bereits Vorformen institutionalisierten Lernens gab. In sogenannten ›Weisheitsschulen‹ wurden Kindern grundlegende Lebensweisheiten vermittelt. Allerdings war die Funktion des Lehrers weniger in einem eigenen Berufsstand organisiert als vielmehr einem erweiterten Verständnis von Familie vergleichbar. So wurden Schüler als ›Söhne‹ bezeichnet, was auf eine eher private als professionsbezogene Beziehung hindeutet. Dies korrespondiert auch weitgehend dem biblischen Charakter von ›Weisheit‹, die ihrerseits stark an der jeweiligen Persönlichkeit orientiert ist. So ist Weisheit nicht ein Konglomerat spezifischer Wissensbestände oder Fertigkeiten, sondern der Weise selbst ist weise und zeichnet sich in seiner gesamten Persönlichkeit dadurch aus. Eine solche Sicht darf jedoch nicht zur Annahme verleiten, dass die weisheitliche Theologie ein positives Menschenbild hätte oder gar dem pädagogischen Grundsatz einer subjektorientierten Bildung verpflichtet wäre. Der ungebildete Zustand einer Person gilt nämlich als defizitäres Stadium des Menschseins – und daraus ergibt sich überhaupt erst eine pädagogische Aufgabe. Infolge ihrer defizitären Veranlagung sind Menschen erst einmal zu erziehen, um Grundvoraussetzungen für jedes bildende Handeln zu schaffen. Daher kommt der Zucht (hebr. »musar«) in weisheitlichen Bildungsvorstellungen auch zentrale Bedeutung zu – man denke hier bspw. an den Weisheitsspruch, der zum Motto der späteren pietistischen Erziehungslehre geworden ist: »Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn, wer ihn liebt, züchtigt ihn beizeiten« (Spr 13,24). Das Akzeptieren von Zucht wird selbst zum ersten fundamentalen Ausdruck beginnender Weisheit erklärt, denn »Torheit steckt dem Knaben im Herzen; aber die Rute der Zucht wird sie fern von ihm treiben« (Spr 22,15). In dieses Bild fügt sich schließlich auch die Zielvorstellung weisheitlicher Erziehung: Der Weise ist im Grunde der perfekt sublimierte Mensch – »züchtig« und kontrolliert, mit »gelassenem Herzen« und einem »kühlen Geist«.
Deshalb bedeutet Bildung in der Weisheitsliteratur auch keine Entfaltung und Förderung der individuellen Anlagen und Möglichkeiten des Menschen oder gar ästhetische Bildung. Vom Subjekt kann überhaupt nicht ausgegangen werden, denn der Mensch ist von Natur aus voller Begierde und Sinnlichkeit, während Erziehung auf die Eingliederung des Individuums in vorgegebene objektive Strukturen und vor allen Dingen in vorgegebene Sinnzusammenhänge zielt.
Das grundlegend negative Bild vom Menschen und seinen Möglichkeiten hat schließlich eine generell negative Sicht auf Bildung zur Folge, denn sie ist im Grunde ein Blendwerk, das die wahre Natur des Menschen verkennt, so das Fazit weisheitlicher Anthropologie. Nachfolgend (Kapitel 1.1.2) wird deutlich, dass das Alte Testament diametral entgegengesetzte Bildungsvorstellungen kennt, die später in ein produktives dynamisches Gleichgewicht kommen (Kapitel 2.3): einerseits die christliche Anthropologie mit ihrer Orientierung am Potenzial des Individuums (Kapitel 1.1.2), andererseits weisheitlich geprägte Defizitbilder vom Menschen und Bildung. Rund um das dritte Jahrhundert vor Christus finden wir bei Kohelet das Urteil: »Alles ist eitel« und doch nur das (ewig) Gleiche (Koh 1,2f). Folglich ist alles Bemühen im Grunde sinnlos, denn »nichts Neues geschieht unter der Sonne« (Koh 1,9). Entsprechend lautet sein Urteil über Bildung, sie sei nur ein »Haschen nach dem Wind«. Mit Hiob gerät die weisheitliche Theologie und in deren Zentrum ein stringenter Tun-Ergehens-Zusammenhang in eine grundsätzliche Krise, von der auch das Vertrauen in die Bildbarkeit des Menschen betroffen ist: »Die Weisheit aber, wo kommt sie her und wo ist der Ort der Einsicht? Verhüllt ist sie vor allen lebenden Augen, verborgen vor den Vögeln des Himmels« (Hiob 28,20). Kohelet wie Hiob fordern, Weisheit durch Gottesfurcht zu substituieren. Die Forderung jedenfalls nach Selbstbildung des Menschen lässt sich auf dieser Traditionslinie nicht begründen. Einschränkend ist anzumerken, dass mit dem Gottesbezug – mithin der Gottesfurcht – die (wenn auch für das Individuum unverfügbare) Hoffnung auf Leben in Fülle verbunden ist (vgl. Weisheitspsalmen 112, 128 oder 133). Dem skizzierten Bildungspessimismus zum Trotz treffen wir später auf eine für sich stehende Form jüdisch geprägter Gelehrsamkeit und eines von Juden getragenen Geistes, der die europäische Kultur maßgeblich beeinflusst hat; exemplarisch sei an M. Mendelsohn, A. Einstein, H. Arendt, M. Buber, K. Tucholsky, F. Kafka, S. Freud u. v. m gedacht.
1.1.2 Bildung als Potenzialentfaltung in den Schöpfungserzählungen
Bereits im Binnenfeld alttestamentlicher Schriften findet sich die Polarität einer sich ausbildenden christlichen Anthropologie, vor deren Hintergrund sich später das pädagogische Spannungsfeld ergibt, das spezifisch christliche Vorstellungen von Bildung ausmacht. So beantworten die Schöpfungserzählungen und die ihnen eigene Anthropologie die Frage nach dem Menschen als zu bildendem Subjekt ganz anders als die weisheitliche Literatur. Die Vorstellung, dass die Bildungsfähigkeit eines jeden Menschen mit seiner Gottebenbildlichkeit (Gen 1,27) zu begründen sei, wird in späteren Bildungstheologien in unterschiedlicher Art und Weise aufgegriffen. Neben einer grundsätzlich optimistischen Einschätzung der Bildungsmöglichkeit des Individuums sind mit der Gottebenbildlichkeit vier weitere kategoriale Grundbestimmungen von Bildung verbunden.
Erstens: Bildung muss gleichheitlich sein. Die priesterschriftliche Aussage, dass der Mensch Ebenbild Gottes sei, hat traditionsgeschichtliche Parallelen. So wird in der zeitgenössischen ägyptischen wie mesopotamischen Königsideologie der jeweilige König als Gottes Ebenbild verehrt, und es ist anzunehmen, dass dies im Hintergrund der alttestamentlichen Erzählung steht. Gerade in einem solchen Kontext erhält die Gottebenbildlichkeit auch ihre spezifische Zuspitzung, indem sie die altorientalischen Königsideologien demokratisiert. Denn ihr zufolge ist nicht ein einzelner Mensch, sondern sind alle Menschen Gottes Ebenbild; allen gleichermaßen fällt ein unverbrüchliches Recht und eine besondere Würde von Gott zu. Damit ist auch ein biblisch-theologisches Kriterium für Bildung formuliert: Bildung beruht auf der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Intelligenz, sozialer, ethnischer oder geografischer Herkunft. Das wäre die Voraussetzung für ein theologisch bestimmtes Bildungsverständnis; Ziel wäre dann die Erhaltung bzw. Ermöglichung von Teilhabegerechtigkeit durch Bildung.
Zweitens: Bildung ist emanzipatorisch und zielt auf eine aktive und eigenverantwortliche Lebensgestaltung ab. Das lässt sich etwa aus Gen 1,28 ablesen: »Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier.« Die lange vorherrschende Interpretation, der Mensch werde hier zum Herrscher über die ganze Natur eingesetzt, ist nicht erst im Angesicht gegenwärtiger ökologischer Krisen zweifelhaft geworden. Sie ist zudem falsch, denn der Mensch wird in der Priesterschrift als Mitschöpfer Gottes verstanden: So wie der Schöpfer Verantwortung für seine Schöpfung trägt und sie erhält, so hat auch der Mensch als Mitschöpfer diese zu tragen und zu erhalten. Damit ist ein weiterer Impuls verbunden: Recht verstandene Bildung zielt auf Bewahrung und nicht Vernichtung der Schöpfung; sie dient dazu, Zusammenhänge zu erkennen, Folgen abzuschätzen und verantwortlich zu planen. Ebenso wichtig wie dieser Gedanke ist ein weiterer: Der der Mensch ist zur aktiv wahrgenommenen Verantwortung berufen, nicht zum passiven Verharren und Gehorsam. Damit ist der Mensch konstitutiv zur Freiheit und zur Subjekthaftigkeit berufen, welche ihn befähigt, seine eigene Existenz sowie seine Lebenswirklichkeit reflektiert im Modus der ihm verliehenen Würde wahrzunehmen und entsprechend zu gestalten. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist dann verwirklicht, wenn der gebildete Mensch in der Lage ist, gegebene Bedingungen nach seinen Bedürfnissen und nach den Prinzipien einer humanen Weltgestaltung zu strukturieren. Dieser Gedanke wird im Übrigen später im Neuen Testament aufgegriffen und radikalisiert, nämlich im Zusammenhang der sog. Rechtfertigungslehre (s. u.).
Drittens: Bildung ist sozial. In den Schöpfungserzählungen ist von der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen zu lesen. Programmatisch verwendet die Priesterschrift dabei nicht den Singular, sondern den Dual: »Und er erschuf sie als Mann und Frau« (Gen. 1,27). Dies verweist darauf, dass der Mensch nicht als ein vereinzeltes Wesen leben kann, sondern auf Sozialität angewiesen ist. Der Mensch ist – schöpfungstheologisch gesehen – ein soziales Wesen; er braucht Kommunikation, Interaktion, Geselligkeit und Zuwendung und lebt in Beziehungen. Er muss über die eigene Grenze – qua Bildung – dazu qualifiziert werden, über sich hinauszureichen.
Eine solche Grenzüberschreitung findet sich auch in anderer Hinsicht. So lesen wir im Buch Genesis von der grundsätzlichen Bezogenheit des Individuums auf seine Mitmenschen. Dies zeigt sich unter anderem in der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen und weiter in seiner Beziehung zu Gott. Gott tritt mit dem Menschen in Kontakt, indem er ihn überhaupt erst durch sein Wort erschafft. In der Folge ist der Mensch als Geschöpf von seinem Schöpfer abhängig; und weiterhin ist auch der einzelne Mensch als soziales Wesen auf seine Mitmenschen und ihren Zuspruch angewiesen. Folgerichtig ist Beziehungsfähigkeit daher auch als theologische Begründung und Zielbestimmung von Bildung zu sehen. Nicht zuletzt sind damit auch didaktische Prinzipien implementiert, wie dialogisch strukturierter Unterricht und weiter das Lernen in Beziehungen.
Viertens: Bildung ist subjektiv und offen. Die Schöpfungserzählung ist ohne den Sündenfall nicht vollständig. Es handelt sich bei der Erzählung vom Sündenfall um eine Ätiologie des bäuerlichen Lebens und der damit verbundenen Mühsal. In theologischer Perspektive ist Sünde der Abfall des Menschen von seiner schöpfungsgemäßen Bestimmung als Gottes Ebenbild. Sünde ist damit zum einen der Verlust der Beziehung zu Gott als dem Schöpfer, zum anderen der selbst verschuldete Verlust der Gottebenbildlichkeit. Insofern können Bildungsprozesse nicht von einem zu erwartenden Produkt her gedacht und strukturiert werden, sondern sind stets (ergebnis-)offen zu denken, wie dies symbolisch im Wesen des Menschen als Ebenbild Gottes aber eben auch als Sünder angelegt ist.
In religionspädagogischer Perspektive ist Sünde jener Zustand, in dem der Mensch nicht das geworden ist, was er eigentlich werden sollte. Oder bildungstheoretisch gesprochen: die konkrete, situative Konstellation, der Status quo des Menschen entspricht nicht dem, wozu Gott ihn bestimmt hat. Er ist nicht, was er (oder sie) sein könnte und sollte. Für die Aufhebung dieser in der Sünde angelegten Selbstverlorenheit sieht das Alte Testament die Möglichkeit der Umkehr durch Selbstbesinnung vor. Der sich und seiner Bestimmung fremd gewordene Mensch soll qua Bildung zu dem zurückfinden, was Gott in ihm (und ihr) angelegt hat. So gesehen stehen (Religions-)Pädagoginnen und Pädagogen vor der Herausforderung, Individuen qua Bildung dazu zu befähigen, sich im Angesicht diverser und vielfältiger Eindrücke und Verführungen selbst zu finden. In theologischer Perspektive ist Bildung daher im Kern die Ermöglichung von Subjektivität und immer auch Selbstbildung. Ferner markiert der Sündenfall die für den Menschen konstitutive Option des Scheiterns sowie einen permanenten Auftrag zur kontinuierlichen Bildung im Sinne eines lebenslangen Lernens, das den Bildungsprozess in Abgrenzung von reiner Produktorientierung wertschätzt.
1.2 Neues Testament
Obwohl im Neuen Testament ebenfalls wenig explizite Aussagen zu Bildung und Erziehung zu finden sind, ist der zeithistorische Kontext ein völlig anderer als im Alten Testament. Nach dem Tod Christi ist den Jüngern die Aufgabe gestellt, sein geistiges und tätiges Erbe zu erhalten, zu systematisieren, zu verbreiten und nachhaltig seine Wirksamkeit zu garantieren. Dies ist eine genuin (religions-)pädagogische Aufgabe, die von entsprechenden Grundsatzfragen zu Erziehung und Bildung flankiert war. Daher ist für das Neue Testament anzunehmen, dass hier pädagogische Fragen zweckorientiert gestellt und systematisch beantwortet werden. In diesem Sinne sind wohl auch Hinweise auf eine explizite und zielorientierte Wahrnehmung von Bildungsfragen in Lk 2,41ff (der zwölfjährige Jesus im Tempel), Apg 22,3 (»Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien und erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, gelehrt mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz, und war ein Eiferer um Gott, gleichwie ihr heute alle seid.«) sowie Eph. 6,4 (»Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Vermahnung zum Herrn.«) zu lesen. Eine besondere Zuspitzung erfahren sie schließlich im Missionsbefehl in Mt 28,20 (»Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.«).
Das skizzierte Bildungsinteresse einer sich im Kontext neutestamentlicher Schriften allmählich formierenden Alten Kirche führt schließlich zur Genese eines ersten »(Bildungs-)Kanons« mit ausgewählten zu memorierenden und im Glauben wie Leben zu antizipierenden Traditionsgütern. Hierunter fallen etwa die Kenntnis der Generationenfolge (Toledot-Erzählungen und Familiengeschichten, Haustafeln bzw. Oikos-Formeln). Allerdings wollen die zitierten Kenntnisse nicht als selbstreferentieller Wissensbestand rezipiert sein, sondern als für die Lebenspraxis konstitutives Moment. Es soll damit ein identitäts- und glaubensstiftendes Zugehörigkeitsgefühl einhergehen sowie eine den inhaltlichen Maßgaben entsprechende Lebensführung. Auch allgemeine ethische Implikation finden sich, nicht zuletzt solche, die das Verhältnis der Anhängerinnen und Anhänger der Glaubensgemeinschaft untereinander betreffen. So ist Bildung nach neutestamentlichem Verständnis egalitär, Bildung steht unabhängig von Alter, Geschlecht und materiellem Status jedem und jeder zu und...