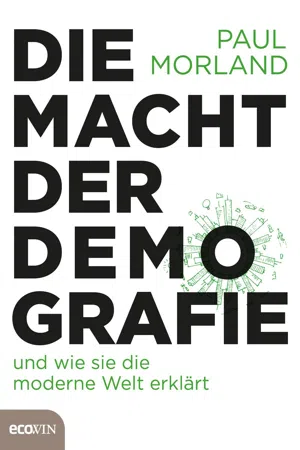![]()
TEIL ZWEI
DER DEMOGRAFISCHE WANDEL NIMMT FAHRT AUF – DIE EUROPÄER UNTER SICH
![]()
3. Der Triumph der Angelsachsen
Im Jahr 1846 wurde Frank McCoppin in der Grafschaft Longford im Herzen Irlands geboren. Im gleichen Jahr meldeten, quasi am anderen Ende der Welt, die Vereinigten Staaten Anspruch auf die mexikanische Provinz Alta California an. Die Stadt, aus der das heutige San Francisco werden sollte, hatte damals kaum 500 Einwohner. Als McCoppin 1897 starb, lebten in San Francisco bereits rund 300 000 Menschen. Zur Zeit der Geburt McCoppins hatte noch niemand ahnen können, dass er einmal Bürgermeister einer Stadt werden sollte, die 1846 kaum so zu bezeichnen war, und dass er einen US-Bundesstaat im Senat vertreten sollte, der überhaupt erst 1848 unter die Kontrolle der USA kam. Am Ende des 19. Jahrhunderts dagegen galt der Aufbau einer kleinen, aber höchst lebendigen Metropole am äußersten westlichen Ende Nordamerikas, bewohnt von Menschen mit überwiegend britischen und irischen Wurzeln, schon als ziemlich normal, ebenso wie heute. Es gibt unzählige Geschichten wie die von McCoppin, Geschichten von Menschen aus Kleinstädten und Dörfern auf den Britischen Inseln, die in ferne Länder aufbrechen und dort zu reichen und mächtigen Vertretern der neuen Gesellschaften werden. Überall finden wir solche Geschichten, von Adelaide bis Oregon, von Kapstadt bis Chicago, und sie alle sind das Produkt einer Bevölkerungsexplosion, aus der unsere heutige Welt hervorging.
England gibt den Takt vor
Die Experten sind uneins darüber, was zuerst da war – das rapide Wachstum der industriellen Produktion oder der massive Anstieg der Bevölkerungszahlen – und welches Phänomen die Ursache des anderen war. Aber ob nun der Bevölkerungszuwachs die Industrialisierung stimulierte oder die Industrialisierung den Bevölkerungszuwachs erst möglich machte, eines ist gewiss: Beides verlief nahezu zeitgleich. Und was auch immer zuerst da war: Ohne das andere wäre es nicht sehr weit gekommen. Nur eine sehr große Zahl Fabrikarbeiter konnte den Einstieg in die Industriegesellschaft und die Fertigung im Weltmaßstab stemmen, aber auch nur mit massenhafter Industrieproduktion und Exporten dieser Produkte konnte sich die wachsende Bevölkerung selbst tragen. Was in Großbritannien begann, eroberte bald die ganze Welt im Sturm und schüttelte diese gehörig durch, Land für Land, Kontinent für Kontinent. Die Bevölkerungsexplosion ermöglichte zunächst den Briten und dann den Völkern Europas, die Herrschaft über die Welt zu erlangen, später trug sie entscheidend dazu bei, die Europäer wieder zurückzudrängen. Genau das ist die Geschichte dieses Buchs, das ist die Macht der Demografie. Im vorliegenden Kapitel geht es um die ersten Anzeichen dessen, was einmal zu einem globalen Phänomen werden sollte, Anzeichen, die sich bei den Bewohnern der Britischen Inseln und ihren Nachbarn zeigten, die man zu jener Zeit häufig als »Angelsachsen« bezeichnete.
Die demografische Revolution nahm auf den Britischen Inseln ihren Anfang, und die verlässlichsten der vorliegenden Daten stammen aus England (mitunter auch aus England plus Wales).1 Wir müssen uns darüber klar werden, wie und warum dies ein Vorgang revolutionären Ausmaßes war, anders als alles bisher Dagewesene. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch früher schon rasches Bevölkerungswachstum gegeben hätte. Aber die Zunahme, die Ende des 18. Jahrhunderts in England begann und sich im 19. Jahrhundert immer weiter fortsetzte, war die erste, die parallel zu Industrialisierung und Urbanisierung verlief. Was da früh im 19. Jahrhundert begann, war kein einzelner Ausschlag in einer langen Abfolge steigender und sinkender Bevölkerungszahlen. Es war Teil eines nachhaltigen Musters rapiden Wandels, der schon bald globale Ausmaße annehmen sollte. Dieser Wandel war in zeitlicher wie räumlicher Hinsicht revolutionär: zeitlich, weil die Zunahme nicht nur schnell verlief, sondern nachhaltig und andauernd war; räumlich, weil es quasi die Blaupause für die Entwicklung im Rest der Welt abgab.
Um Englands Bevölkerungszuwachs richtig einordnen zu können, müssen wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, ans Ende des 16. Jahrhunderts, die letzten Jahre der Herrschaft von Königin Elizabeth I., das Zeitalter Shakespeares. Als Spaniens Armada über die Weltmeere segelte – und unterging – und Englands großer Dichter auf dem Höhepunkt seines Schaffens stand, lebten rund vier Millionen Menschen in England, deutlich mehr als die ungefähr drei Millionen gar nicht so lange davor, am Ende der Regentschaft von Heinrich VIII. Diese Zunahme um ein Drittel in gerade einmal einem halben Jahrhundert (das entspricht gut 0,5 Prozent pro Jahr) hatte sich nach geschichtlichen Maßstäben sehr schnell eingefunden. England unter den Tudors war größtenteils friedlich und wohlhabend, die politische Lage relativ stabil – bei allen religiösen Fehden, die es zu jener Zeit eben gab –, und der Handel blühte, sowohl im Land selbst als auch im Austausch mit Kontinentaleuropa. Überdies war England immer noch dabei, die Verluste durch den Schwarzen Tod und die dunklen Jahre der Rosenkriege und anderer Katastrophen des Spätmittelalters auszugleichen. Diese hatten die Bevölkerung dezimiert, nun kehrte wieder eine gewisse Stabilität ein, es gab genug Land, um mehr Menschen zu ernähren. »Merry Old England« war also durchaus nicht nur ein Mythos viktorianischer Berufsnostalgiker. Wachsende Bevölkerungszahlen sind normalerweise ein Indiz für verbesserte Lebensbedingungen, deshalb war die Epoche der Tudors und Elizabeths I. im 16. Jahrhundert tatsächlich eine glückliche Zeit für England, jedenfalls im Vergleich zur Epoche unmittelbar davor und, in gewissem Maße, zur folgenden.
Im 17. Jahrhundert schwächte sich das Bevölkerungswachstum ab und kehrte sich sogar um, als Bürgerkrieg und Pest sich zurückmeldeten. Anfang des 18. Jahrhunderts setzte jedoch wieder Wachstum ein.2 Das durchschnittliche jährliche Wachstum lag etwa bei 0,3 Prozent in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und stieg in der zweiten Hälfte auf nahezu ein halbes Prozent. So weit, so gut, historisch betrachtet aber nicht weiter ungewöhnlich. Dennoch war nun der Punkt erreicht, von dem aus sich die Dinge für immer veränderten und die Macht der Demografie sich ungeahnt entfalten konnte. Das Bevölkerungswachstum in England beschleunigte sich im 19. Jahrhundert und erreichte trotz einer großen Zahl von Auswanderern über 1,3 Prozent. Das natürliche Wachstum ohne Berücksichtigung der Emigration lag in den Jahren von 1811 bis 1825 bei einem Spitzenwert von über 1,7 Prozent.3 Eine solche Zunahme hatte es in keiner anderen Periode gegeben, weder im Hochmittelalter vor der Pest noch im »Merry Old England« der Tudor-Dynastie. Eine Bevölkerungszahl, wie sie England nie zuvor erlebt hatte, war die Folge. Wenn eine Bevölkerung – oder was auch immer – mit 1,3 Prozent pro Jahr wächst, verdoppelt sie sich innerhalb von circa fünfzig Jahren, ein weiteres Mal in den fünfzig Jahren danach, und genau das war in England im Verlauf des 19. Jahrhunderts der Fall.
Ironischerweise wurde just zu dem Zeitpunkt, als diese Revolution einsetzte, die »alte Ordnung«, die sie hinter sich zu lassen im Begriff war, erstmals beschrieben, und zwar von Thomas Malthus. Malthus war ein Landpfarrer aus Surrey, einer blühenden Grafschaft im Süden Englands, und er erkannte etwas, das er für ein ehernes Gesetz der Geschichte hielt. In seinem berühmten Essay on the Principle of Population (»Das Bevölkerungsgesetz«), der zwischen 1798 und 1830 mehrmals gründlich überarbeitet und neu veröffentlicht wurde, stellte er die These auf, eine wachsende Bevölkerung würde zwingend das Land überlasten, das sie ernähren sollte, was unausweichlich Elend und Tod nach sich ziehen müsste. Unter solchen Bedingungen, so Malthus, würden Kriege, Hungersnöte und Seuchen die Bevölkerung auf ein Maß reduzieren, das das Land würde ernähren können. An diesem Punkt angelangt, bei geschrumpfter Einwohnerzahl, die sich die verfügbaren Ressourcen teilte, würden die Überlebenden, weil geringer an Zahl, einen größeren Anteil an den verfügbaren Mitteln erhalten und damit ein etwas besseres Leben führen, länger leben und mehr überlebende Nachkommen haben können. Dann aber würde die Bevölkerungszahl schon bald wieder an ihre natürliche Grenze stoßen: Ohne die Einschränkungen durch »Laster« (Empfängnisverhütung) oder »sittliche Beschränkung« (späte Heirat oder sexuelle Enthaltsamkeit) würde die allgemeine Not wieder zurückkehren. In Malthus’ eigenen Worten: »Die Kraft zur Bevölkerungsvermehrung ist um so vieles stärker als die der Erde innewohnende Kraft, Unterhaltsmittel für den Menschen zu erzeugen, dass ein frühzeitiger Tod in der einen oder anderen Gestalt das Menschengeschlecht heimsuchen muss.«4
Zwar hatte Malthus in der Tat einen bahnbrechenden Überblick über die Entwicklung der Menschheit bis in seine Gegenwart vorgelegt, zu seinem Unglück jedoch wandelte sich die Welt grundlegend, als er sein Werk verfasste. Mit dem Eintreffen der landwirtschaftlichen, gefolgt von der industriellen Revolution in seiner britischen Heimat veränderte sich die Nahrungsmittelproduktion ebenso wie der Handel, und das gab der Bevölkerung die Möglichkeit, weit über das bis dahin geltende Maß hinaus zu wachsen.5 Die Bevölkerungszahl war nun nicht mehr an die Menge der vor Ort produzierbaren Unterhaltsmittel gekoppelt. Ein industrialisiertes Land konnte seine Produkte schnell auf dem Weltmarkt verkaufen und seine Nahrungsmittel überall auf dem Globus einkaufen. Neue Techniken in der Landwirtschaft ermöglichten eine Steigerung der Produktion; so hatten etwa im 18. Jahrhundert neue Verfahren bei Aussaat und Fruchtwechsel die Erträge gesteigert, im 19. Jahrhundert hielten Maschinen verstärkt Einzug in die Landwirtschaft. Der Ertrag pro Fläche stieg im frühen 19. Jahrhundert um fünfzig Prozent, und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erfassten die europäischen Anbaumethoden riesige neue Flächen in Kanada, den USA und Australien. Auch auf die Produkte aus diesen Gebieten konnten die Menschen in Europa nun zurückgreifen.
Mit der Besiedlung dieser Territorien, der Vertreibung, teilweise sogar Ausrottung ihrer Ureinwohner und der Einbindung der Flächen in die moderne Agrartechnik sowie der Schaffung von Transportinfrastruktur für den Verkauf der Produkte in Großbritannien und anderswo in Europa konnten immer mehr Menschen ernährt werden. Im Grunde befeuerten die Briten ihr Bevölkerungswachstum durch das Erschließen neuer, riesiger Ländereien und das Bestellen dieser Flächen mit den neuesten Verfahren. Erst zu Malthus’ Zeiten wurde diese neue, effizientere und produktivere Welt überhaupt vorstellbar. Hätte Malthus im Herzen dieser Revolution, in Manchester etwa, gelebt und gelehrt oder wäre er ausgewandert, um seinen Dienst in einer Gemeinde in der Neuen Welt zu verrichten, hätte er vielleicht einen Blick auf die Zukunft der Menschheit erhaschen können. In seiner ländlichen Heimat in Surrey ist ihm das entgangen.
Das Bevölkerungswachstum löste nicht bei allen im Lande Begeisterung aus. Vor allem unter Intellektuellen – und längst nicht nur bei Konservativen oder Reaktionären – gab es einen eindeutigen Trend, der Ausbreitung der Bevölkerung, der Massenzivilisation und dem sich dahinter abzeichnenden Szenario geradezu mit Entsetzen entgegenzusehen. 1904 lamentierte The Times, die Vororte im Londoner Süden würden zu einem »Distrikt abstoßender Monotonie, Hässlichkeit und Langeweile« verkommen. H.G. Wells verzweifelte daran, dass »England nun zur Hälfte nichts weiter als ein verstreuter Vorort« sei, und sprach vom »geschwulstartigen Wachstum« endloser Straßen und immer den gleichen Häusern. Bei D.H. Lawrence schienen die neuen Volksmassen gar Völkermordgedanken zu wecken: »Wenn es nach mir ginge, sollte man eine Todeskammer, so groß wie der Kristallpalast errichten, dann würde ich all die Kranken, Lahmen und Krüppel aus den Haupt- und Nebenstraßen holen, hineinschicken und sie schmerzlos von ihrem Leiden erlösen.«
Die herablassende Verachtung für die minderen Stände war mindestens so alt wie das antike Griechenland, aber die ausgesprochen widerwärtigen Ressentiments, die hier zum Ausdruck kommen, lassen sich wohl nur als spezifische Reaktion auf ein in diesem Ausmaß nie zuvor gekanntes Bevölkerungswachstum deuten. Am unverblümtesten oder alarmierendsten meldete sich der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche zu Wort: »Die allermeisten Menschen sind ohne Recht zum Dasein, sondern ein Unglück für die höheren.«6 Eine solche Einlassung dürfte man kaum vernommen haben, als die Bevölkerung noch überschaubar und stabil war und die meisten Armen am Rande des Hungertods ihr Dasein fristeten.
Wie erklärt sich der demografische Aufbruch?
Es bedarf einer Erklärung, warum der demografische Wandel einsetzte und warum das ausgerechnet in England geschah. Bis zu einem gewissen Grad war es schlicht und einfach ein glücklicher Zufall. Jenes »gekrönte Eiland«, wie es bei Shakespeare heißt, dem der Bürgerkrieg erst noch bevorstand, wurde im 18. Jahrhundert erneut zu einem relativ sicheren Ort. In scharfem Gegensatz zum Rest des Kontinents hatte es nicht unter marodierenden Armeen zu leiden. Ausbrüche der Pest und anderer ansteckender Krankheiten pandemischen Ausmaßes ließen nach, wohl auch dank gestiegener Standards bei Hygiene und Ernährung. Manch einer nannte gar den gestiegenen Teekonsum als Faktor für die verbesserte allgemeine Gesundheit.7
Eine wachsende Bevölkerungszahl hat grundsätzlich eine von zwei unmittelbaren Ursachen – es können natürlich auch beide zugleich zutreffen. Erste Möglichkeit: Es gibt mehr Geburten als Sterbefälle. Zweite Möglichkeit: Es gibt mehr Einwanderer als Auswanderer. Im Fall Englands im 19. Jahrhundert können wir die zweite Erklärung vernachlässigen. So oft wir auch zu hören bekommen, dass »England seit jeher ein Einwanderungsland gewesen ist« – es trifft schlicht nicht zu. Der Anstieg der Bevölkerung Englands zwischen 1800 und 1900 hatte mit absoluter Gewissheit nichts mit Einwanderung zu tun. Ganz im Gegenteil: Gerade in dieser Zeit kehrten die Menschen in großer Zahl Großbritannien und Irland den Rücken, um die riesigen Territorien von Kanada, Australien und Neuseeland zu besiedeln. Außerdem stellten Engländer und Iren während dieser Epoche die größte Gruppe der Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Zwar gab es durchaus auch Migration in Richtung England, nämlich aus Schottland und vor allem Irland (beides spielte sich also innerhalb des Königreichs jener Zeit ab), und ganz am Ende des 19. Jahrhunderts kam die Zuwanderung von Juden aus Osteuropa hinzu, aber das machte nur einen Bruchteil der Abwanderungsbewegung in Richtung der Kolonien und der USA aus. Die Schätzungen variieren – die offiziellen Aufzeichnungen sind nicht sehr verlässlich –, und gewiss kehrten auch viele von Übersee wieder zurück auf die Insel, was das Bild nochmals verkompliziert, aber eine Schätzung spricht davon, dass allein in den 1850ern über eine Million Menschen das Land verließen.8 Dagegen kamen im Spitzenjahr der Einwanderung im Jahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg gerade einmal 12 000 Menschen ins Königreich, um sich dort dauerhaft anzusiedeln.9
Ausgehend davon, dass eine massenhafte Abwanderung aus England stattgefunden hat und die Bevölkerung des Landes sich im Verlauf des Jahrhunderts dennoch fast vervierfacht hat, muss die Ursache für das Bevölkerungswachstum in dem enorm veränderten Verhältnis zwischen Geburten und Todesfällen zu suchen sein, was nicht nur das Bevölkerungswachstum im Land begründete, sondern auch die verstärkte Emigration bewirkte. Die schmalen Gassen im verarmten Londoner East End, in die man am Ende des Jahrhunderts die eingewanderten Juden steckte (die den Großteil der Immigranten ausmachten), waren nichts im Vergleich zu den riesigen Territorien in Kanada, den USA, Australien, Neuseeland und anderswo, die von britischen Emigranten bevölkert wurden. Großbritannien – oder doch zumindest die Britischen Inseln – war definitiv kein Einwanderungsland. Ganz im Gegenteil mussten die Geburtenüberschüsse die gewaltige Nettoemigration erst einmal ausgleichen, bevor sie irgendetwas zum Bevölkerungswachstum im Land selbst beitragen konnten. Und genau dies geschah.
Mit das Erste, was sich zu Beginn dieser Bevölkerungsrevolution veränderte, war das Heiratsalter – die Leute heirateten immer jünger. Zwischen dem frühen 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts sank das Heiratsalter der Frauen von 26 auf 23 Jahre.10 Das bedeutete drei zusätzliche Jahre höchster Fertilität, in der Frauen Kinder zur Welt bringen konnten, anstatt (zumeist keusch) auf den richtigen Partner zu warten.11 Zugleich nahm die Zahl der unehelichen Geburten ab – eine Begleiterscheinung der strengen viktorianischen Moralvorstellungen. Insgesamt wurde dies jedoch durch die Zunahme bei den ehelichen Geburten mehr als ausgeglichen. Die Gesamtfertilität – ehelich und außerehelich – stieg vom relativ niedrigen Niveau des frühen 18. Jahrhunderts von vier bis fünf Kindern auf etwa sechs Kinder pro Frau im frühen 19. Jahrhundert. In diesem Punkt unterscheidet sich der Bevölkerungszuwachs in England von jenen späteren Zuwächsen in anderen Ländern; während in den meisten Fällen eine hohe Geburtenrate hoch bleibt und die Sterberate abnimmt, nahm in England die Geburtenrate noch weiter zu.12
Während die Leute früher heirateten und mehr Kinder bekamen, begannen sie auch noch, länger zu leben, sprich...