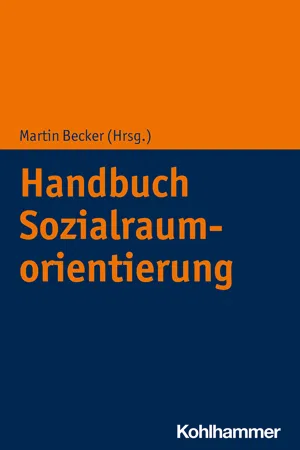![]()
1 Sozialraumorientierung – Ein Handlungskonzept Sozialer Arbeit
Martin Becker
In diesem einführenden Beitrag werden, beginnend mit der Klärung wesentlicher Begriffe, die Grundzüge des diesem Handbuch zugrunde liegenden Handlungskonzeptes Sozialraumorientierung (SRO) zunächst zusammenfassend dargestellt. Es wird das Grundgerüst der Dimensionen des Handlungskonzeptes SRO vorgestellt, an dem sich die Beschreibungen dessen Bedeutung und Anwendung in verschiedenen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit unter Berücksichtigung der jeweiligen handlungsfeldspezifischen Unterschiede ausrichten. Zunächst wird das diesem Handbuch zugrunde liegende Begriffsverständnis von Konzept, Methode und Techniken erläutert werden. Darauf folgend gilt es die Begriffsbestandteile des hier zu beschreibenden Konzeptes der SRO zu klären.
1.1 Handlungskonzept – Begriffsklärung und -verständnis
Die Fokussierung auf Handlungsfelder Sozialer Arbeit beruht auf dem »Freiburger Modell der Handlungsfeldorientierung« (Becker/Kricheldorff/Schwab 2020) und bedeutet, die aktuellen Bedingungen und Entwicklungen in bestimmten Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit in den Blick zu nehmen und die daraus abzuleitenden Aktionen und Interventionen professioneller Sozialer Arbeit, in Bezug zu den jeweils passenden Handlungskonzepten und Methoden zu entwickeln. Das diesem Handbuch zugrunde liegende und weiter unten noch zu explizierende Handlungskonzept SRO wird also auf die handlungsfeldspezifischen Charakteristika von Aufgabenstellungen, Rechtsgrundlagen, Governance, Trägerlandschaften und Situationen von Handlungsfeldern Sozialer Arbeit bezogen.
Auf der Grundlage des dreidimensionalen Kompetenzbegriffs, wie er im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)1 definiert wird, spielen sowohl theoriebegründete Handlungskonzepte als auch die Methoden der Sozialen Arbeit eine wichtige Rolle beim Kompetenzerwerb durch Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen. Die Kombination von Wissensbeständen aus Bezugswissenschaften und Erkenntnissen der Wissenschaft Soziale Arbeit (Erklärungswissen) mit Kenntnissen und Fähigkeiten der Entwicklung und Anwendung von Methoden (Handlungswissen und Analyse-/Synthese-/Kritikfähigkeit) bildet auf der Grundlage von Wertorientierungen und Haltungen die Basis der Ausbildung spezifischer Handlungskompetenzen Sozialer Arbeit. Nach Geißler und Hege (2007: 20) bezeichnet Konzept ein
»Handlungsmodell in welchem die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die Verfahren in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht sind. Dieser Sinn stellt sich im Ausweis der Begründungen und Rechtfertigungen dar«.
Zielen Handlungskonzepte vorwiegend auf Erklärungswissen ab, so sollten sie hierzu theoretisch begründete, plausible, erforschbare und überprüfbare Erklärungen für soziale Prozesse beinhalten. Auf der Basis dieses Erkenntnisgewinns lassen sich Entscheidungen über Handlungsbedarfe treffen, entsprechende konzeptionelle Ziele bestimmen und geeignete Methoden zur Zielerreichung auswählen. Konzepte erhalten durch den Einbezug geeigneter Methoden und Techniken und der damit verbundenen systematischen Vorgehensweisen zur Zielerreichung einen Handlungsbezug und werden somit zu Handlungskonzepten. Charakteristischerweise betonen Handlungskonzepte einen programmatischen Aspekt (wie z. B. Lebenswelt, Ressourcen, Sozialraum, Management etc.), aus dem sich Handlungsprinzipien und Arbeitsweisen ableiten lassen.
Handlungskonzepte fassen also grundlegende Ansatzpunkte einer Disziplin (hier Soziale Arbeit) theoriegeleitet zusammen und beinhalten, mit der Betonung eines bestimmten programmatischen Aspektes, eine spezifische Sichtweise der Erklärung sozialer Prozesse.
Nach engerem Verständnis bezeichnen Methoden zunächst ein planmäßiges Vorgehen zur Zielerreichung. Im Rahmen eines Handlungskonzeptes sind Methoden, auf dem oben dargelegten Konzeptbegriff basierend, jedoch nicht ›zielneutral‹, sondern abhängig von und passend zu den, im Rahmen eines jeweiligen Handlungskonzeptes gewonnenen Erkenntnissen über theoretisch und empirisch begründete Zusammenhänge auszuwählen, zu adaptieren und zu kombinieren.
Methoden sind nach dem für dieses Handbuch geltenden Begriffsverständnis im Vergleich zu Konzepten weniger komplex, sie legen den Schwerpunkt eher auf den Aspekt der Vorgehensweise, also auf Handlungen, und bedienen sich dabei eines Sets an geeigneten Verfahren und/oder Techniken.
Dementsprechend können Methoden keine starren Handlungsanleitungen sein oder bieten, die sich zur Bearbeitung jedweder Aufgaben und Probleme eignen, sondern Methoden sind situationsbezogen, offen und reflexiv auf die Eigenarten und Besonderheiten sozialer Prozesse und Menschen anzupassen.
Techniken wiederum sind als erprobte, standardisierte Verhaltensmuster zu verstehen, deren Wirksamkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagbar sind, und dienen der konkreten Bearbeitung und Realisierung von Methoden (Galuske 2007: 24ff.).
Manche Methoden und Techniken können für unterschiedliche Handlungskonzepte geeignet sein und angewandt werden. Andererseits können für jeweilige Handlungskonzepte hingegen nur bestimmte Sets an Methoden und Techniken geeignet sein und Anwendung finden.
1.2 »Sozialraum-Orientierung« – raumtheoretische und gesellschaftspolitische Betrachtungen
»Sozialraum« steht, nach obiger Definition von Handlungskonzepten, für den programmatischen Aspekt des Handlungskonzepts SRO und soll deshalb an dieser Stelle zunächst begrifflich definiert und inhaltlich expliziert werden. Mit der Aufgabe, Raum begrifflich zu fassen und dessen Bedeutung für Menschen zu erklären, beschäftigten sich Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Blickwinkeln. So wies bereits Durkheim (1903) auf den Zusammenhang zwischen sozialer Struktur menschlichen Zusammenlebens und deren räumlicher Konstitution hin. Er ging jedoch von direkten kausalen Zusammenhängen zwischen Sozialstruktur und Raumstruktur aus, wodurch wiederum die Sozialstruktur reproduziert würde (Konau 1977). Georg Simmels (1908) Nachdenken über die Zusammenhänge zwischen Raum, Zeit und Substanz führten ihn zu einem neueren Raumbegriff, als synthetische Leistung des Menschen bzw. von Gesellschaften und damit auf den sozialen Ursprung des Raumbegriffs. Zwar geprägt von den newtonschen Vorstellungen eines absoluten Raums, ging auch Simmel von der Existenz des geografisch bestimmten Raumes aus, setzte diesen jedoch in Relation zu den sozialen Prozessen, durch die der geografische oder materielle Raum erst seine Bedeutung erhalte. Die Chicagoer Schule der Soziologie (z. B. Park/Burgess/McKenzie 1925) interessierte sich speziell für die empirisch nachweisbaren Einflussfaktoren der räumlichen Organisation von Gesellschaft. Hierfür wurden Städte und Stadtteile als Territorien der Lokalisierung sozialer Ordnungen untersucht. Mit ihrem »sozialökologischen Ansatz« war eine Fokussierung auf quasi naturgesetzlich determinierte Anordnungen von Menschen in geografischen Räumen verbunden, die der von Simmel bereits aufgezeigten Komplexität von Wechselwirkungen zwischen sozialen Strukturen und Prozessen in raum-zeitlicher Perspektive nicht gerecht wurden.
Aus der mikrosoziologischen Perspektive der Phänomenologie (Schütz 1932) wird der subjektive Sinn sozialen Handelns in seiner Bezogenheit auf Situationen, Orte und Anlässe des Handelns als »lebensweltliche« Phänomene begrifflich festgehalten und ethnomethodologisch untersucht. Auch die von Goffman (1969) beschriebene und praktizierte Interaktionsforschung macht den räumlichen Charakter sozialer Phänomene und damit deren vielfältige Beziehungen deutlich. Henri Lefèbvre sorgte in den 1970er Jahren für eine Wiederbelebung der theoretischen Debatte um Raum. In seiner kapitalismuskritischen Schrift »Die Produktion des städtischen Raums« entwickelt Lefèbvre (1977) einen relationalen Raumbegriff, der zwischen sozialem und physischem Raum unterscheidet. Raum wird nach Lefèbvre von jeder Gesellschaft in spezifischer Weise produziert. Dies geschehe z. B. durch die »räumliche Praxis«, also der (Re-)Produktion von Raum durch die Aktivität der Wahrnehmung des Raums bzw. raumbezogene Verhaltensweisen. Mit der »Repräsentation von Raum« verbindet Lefèbvre die Konzeptualisierung von Raum durch Ideen, z. B. von Architekt*innen, Planer*innen oder Künstler*innen, die dem Raum eine kognitive Bedeutung und Lesart verleihen. Praxis und (Re-)Präsentation des Raumes durchdrängen einander und würden beeinflusst durch die gesellschaftliche Ordnung, die im Kapitalismus bspw. mit der Entfremdung des Handelns einhergehe. Den dritten Aspekt der Produktion von Raum sieht Lefèbvre im »Raum der Repräsentationen«, womit die Bedeutung von Symbolen für die Raumbestimmung gemeint ist. Damit verwirft Lefèbvre das Verständnis von Raum als Behälter oder absolutem Raum und will die Vielgestaltigkeit und Relationalität von Raum deutlich machen, ohne selbst einen klaren Raumbegriff anbieten zu können.
Dieter Läpple (1991) griff die Diskussion um Raum in Deutschland wieder auf, indem er, im Gegensatz zu der bis dahin für die stadtsoziologische Forschung dominierenden sozialökologisch orientierten »Kölner Schule« um Jürgen Friedrichs (1977), die Verwendung von »Behälterkonzepten« kritisierte und stattdessen folgende vier Komponenten einer Raummatrix formulierte:
• gesellschaftliche Verhältnisse als materielle Erscheinungsform,
• gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsstrukturen,
• institutionalisiertes und normatives Regulationssystem,
• räumliches Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem.
Mit dieser Differenzierung machte Läpple deutlich, dass Raum theoretisch rekonstruierbar und gesellschaftlich konstituiert wird, womit zwangsläufig eine Verständigungsnotwendigkeit über die jeweilige Bedeutung von Raum entstehe.
Martina Löw (2001) hat den raumsoziologischen Diskurs ein Jahrzehnt später weitergeführt und präzisiert, indem sie auf die Unterschiede der mit den Begriffen »Behälterraum« und »Beziehungsraum« verbundenen Konzepte hinwies. Demnach wird unter einem »Behälterraum« ein Gefäß (z. B. Saal oder Stadtteil) verstanden, das aus dem Blickwinkel von außen nach innen betrachtet mit Gegenständen, Menschen oder Eigenschaften (bspw. Möbel, Menschen, Gerüche etc. in einem Saal bzw. Gebäude, Straßen, Plätzen, Menschen und Lärm in einem Stadtteil) gefüllt sein kann. Beim »Beziehungsraum« wird, von innen nach außen betrachtet, ausgehend von den »Gegenständen« (z. B. Menschen, Aktionen, physische Körper, Organisationen, Regeln, Weltbilder) das Ergebnis der Beziehungen zwischen diesen »Gegenständen« beschrieben.
Zur Darstellung der Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit der Dynamik von Räumen verwendet Löw den Begriff der (An-)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten. Diese Schreibweise in Klammern soll verdeutlichen, dass Räume gleichermaßen auf der Anordnungspraxis und auf gesellschaftlichen Ordnungen beruhen. Räumliche Strukturen würden demnach durch in Räume eingeschriebene Regeln konstituiert und durch Ressourcen gesichert. Löw schlägt vor, von einer durch die Relation zwischen Strukturen und Prozessen geprägten doppelten Konstituiertheit von Raum auszugehen. Zur Analyse von Raumkonstitutionen brauche es demzufolge Kenntnisse der »Bausteine« (soziale Güter und Menschen) und deren Beziehungen untereinander. Hilfreich hierzu sei nach Löw ein Rahmenkonzept unter Verwendung eines »Raum-Zeit-Relativs«, womit im Forschungsprozess der Ausgangspunkt wahlweise auf den »Bausteinen« oder den Beziehungen liegen könne, solange beide Perspektiven einbezogen würden. Im ersten Fall, der vorrangigen Betrachtung der Strukturen, seien für Operationalisierungen die materielle Gestalt, das soziale Handeln, die normative Regulation und die kulturellen Ausdrücke zu beachten.
Aus dem Blickwinkel des Herstellungsprozesses von Raum sind nach Löw die beiden Prozesse »Syntheseleistung« und »Spacing« zu unterscheiden. »Syntheseleistung« meint das Schaffen von Räumen durch die Verknüpfung der Raumelemente (soziale Güter und Lebewesen) durch Menschen über Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Imaginationsprozesse. Unter »Spacing« wird der zweite Vorgang der Konstitution von Raum, das Platzieren von sozialen Gütern und Menschen und deren symbolischer Markierung, durch welche deren Zusammenspiel kenntlich gemacht würde, verstanden. »Syntheseleistung« und »Spacing« geschehen im Alltag der Konstitution von Raum gleichzeitig. Löw geht »(analytisch) von einem sozialen Raum aus, der gekennzeichnet ist durch materielle und symbolische Komponenten« (2001: 15).
Räume sind für Löw aufgrund der in hierarchisch organisierten Gesellschaften meist ungleichen und unterschiedlichen Bevölkerungsteile begünstigenden bzw. benachteiligenden Verteilung oft Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen.
»Verfügungsmöglichkeiten über Geld [Ökonomisches Kapital, wie Einkommen], Zeugnis [Kulturelles Kapital, wie Bildung], Rang [Status] und Assoziationen [Inklusion/Exklusion; Soziales Kapital] sind ausschlaggebend, um (An)Ordnungen durchsetzen zu können, so wie umgekehrt die Verfügungsmöglichkeit über Räume zur Ressource werden kann« (Löw 2001: 272).2
Schroer (2006) verweist auf die etymologische Herkunft des Raumbegriffs von »räumen/abräumen/Platz schaffen« und erklärt damit die Bedeutung des »Raum [S]chaffens« als sozialen Prozess. Mit Blick auf die historische Entwicklung der Rezeption des Begriffes konstatiert Schroer eine Veränderung von absoluten (Aristoteles, Newton, Kant) über relativistische (Leibniz, Einstein) zu relationalen Raum-Verständnissen (Elias, Lefèbvre, Löw). Schroer sieht » die besondere Bedeutung Simmels für eine Soziologie des Raums darin, dass er sowohl die strukturelle Seite des Raums betont als auch die Hervorbringung des Raums durch menschliche Aktivitäten« (2006: 78). Das Verdienst der Literaturwissenschaftler um Dünne und Günzel (2006) ist es, eine interdisziplinäre Übersicht der Theorien zu Raum erstellt und dabei eine wertvolle Sammlung von Originaltexten vom...