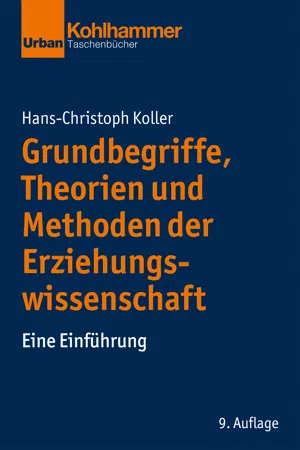
eBook - ePub
Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
Eine Einführung
Hans-Christoph Koller
This is a test
- 244 pages
- German
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
Eine Einführung
Hans-Christoph Koller
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
This volume imparts the most important basic concepts, theoretical approaches and methodology of educational science. The first part introduces the basic concepts of upbringing, education and socialization and clarifies their importance for situations in educational work using example cases. The second part is concerned with the question of what it is that makes statements about upbringing, education and socialization into scientific statements. For this purpose, various views of science are presented and their relevance to educational work is examined using examples.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft by Hans-Christoph Koller in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Education & Education Teaching Methods. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Teil I Grundbegriffe und Theorien
1 Der Erziehungsbegriff der Aufklärung: Kant
Die Darstellung von Grundbegriffen und Theorien der Erziehungswissenschaft beginnt mit dem Begriff der Erziehung. Das ist naheliegend (schließlich heißt die Disziplin ja auch Erziehungswissenschaft), versteht sich aber keineswegs von selbst. Denn da die beiden anderen Begriffe, die im Folgenden erörtert werden sollen, nämlich Bildung und Sozialisation, in ihrem Gegenstandsbereich jeweils umfassender sind als der Erziehungsbegriff, gäbe es gute Gründe, die Darstellung mit einem von ihnen zu beginnen. Für einen Anfang mit dem Grundbegriff Erziehung sprechen jedoch vor allem zwei Argumente. Zum einen ist Erziehung im Unterschied zu Sozialisation und Bildung ein Wort, das auch in der Alltagssprache in relativ klar umrissener Bedeutung vorkommt und deshalb für einen Einstieg besser geeignet ist als der Fachterminus Sozialisation oder der vieldeutige Bildungsbegriff. Und zum andern entspricht von den drei genannten Grundbegriffen der Erziehungsbegriff am ehesten der Perspektive, die pädagogisch Handelnde auf die Erziehungswirklichkeit haben, und eignet sich deshalb besser dazu, einen ersten Zugang zur wissenschaftlichen Analyse pädagogischer Handlungssituationen zu eröffnen.
Dabei nimmt die Erörterung des Erziehungsbegriffs ihren Ausgang von einer Fassung, die dieser Begriff in der Zeit um 1800 gefunden hat. Der Zeitraum von etwa 1770 bis 1830 kann in historischer Perspektive als eine Phase entscheidender Veränderungen in der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verfasstheit der mittel- und westeuropäischen Gesellschaften angesehen werden – Veränderungen, die in vielerlei Hinsicht bis heute fortwirken. Sozialgeschichtlich betrachtet handelt es sich bei dieser Zeit um die Phase, in der die feudale Ständegesellschaft von einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung abgelöst wird, und ideengeschichtlich gesehen entstehen im selben Zeitraum spezifisch moderne Auffassungen vom Menschen und seinem Verhältnis zur Gesellschaft und zur Welt. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem kulturellen Phänomen der Aufklärung zu, einer europäischen Bewegung, die im 17. Jahrhundert begann und in Deutschland ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte.
1.1 »Was ist Aufklärung?«
Eine prägnante Beschreibung der Grundgedanken dieser Bewegung findet sich in der berühmten Schrift »Was ist Aufklärung?« von Immanuel Kant (1724–1804), der als einer der wichtigsten Vertreter aufklärerischen Denkens gilt. Dort heißt es:
»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.« (Kant 1784/1983, S. 53)
Entscheidender Bezugspunkt für die Begründung individuellen wie kollektiven Handelns ist Kant zufolge also weder die Berufung auf Tradition und Sitte noch die Autorität politischer oder religiöser Obrigkeiten, sondern der menschliche Verstand, von dem jeder Einzelne selbstständig Gebrauch machen kann und soll. Den Gegensatz zu diesem selbstständigen Gebrauch markiert die »Leitung« durch andere, für die Kant im weiteren Verlauf seiner Schrift anschauliche Beispiele anführt. Da gibt es das Buch, dessen Lektüre an die Stelle der Benutzung des eigenen Verstandes tritt, den Seelsorger, der eigene Gewissensentscheidungen überflüssig macht, den Arzt, der Diätvorschriften erlässt, sowie ganz allgemein »Satzungen und Formeln«, die Kant als »Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit« bezeichnet, weil sie den selbstständigen Gebrauch des Verstandes ver- oder behindern (Kant 1784/1983, S. 54).
Dafür, dass die Menschen solchen Vorschriften folgen, statt sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, führt Kant vor allem zwei Gründe an: einerseits die »Faulheit und Feigheit« (Kant 1784/1983, S. 54) derer, die sich von anderen leiten lassen, und andererseits Drohungen und Bevormundungen von Seiten der Obrigkeiten, die Leitung ausüben, indem sie die Freiheit ihrer Untertanen einschränken und Mündigkeit als etwas Gefährliches darstellen. Die entscheidende Bedingung von Aufklärung besteht für Kant daher in nichts anderem als in der Freiheit, »von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen« (Kant 1784/1983, S. 55). Hier kommt eine wichtige politische Dimension aufklärerischen Denkens zum Ausdruck, die in der Forderung nach Freiheitsrechten für alle Bürger besteht – und d. h. hier in erster Linie in der Forderung nach dem Recht jedes Menschen, seine eigene Meinung in Wort und Schrift öffentlich kundzutun.1
Die Grundgedanken der Aufklärung haben auch für den Bereich der Erziehung Konsequenzen. Das lässt sich besonders gut am Beispiel von Kants Vorlesung »Über Pädagogik« verdeutlichen, die 1776/77 erstmals gehalten, aber erst 1803 veröffentlicht wurde. Zuvor freilich gilt es, den erziehungshistorischen Kontext von Kants pädagogischen Überlegungen zu skizzieren.
1.2 Das »pädagogische Jahrhundert«
Das 18. Jahrhundert ist bereits von Zeitgenossen als das »pädagogische Jahrhundert« bezeichnet worden (vgl. Tenorth 2010, S. 79). Aus heutiger Sicht ist dies insofern einleuchtend, als sich in diesem Jahrhundert nicht nur neue (und in ihren Grundzügen bis heute wirksame) Auffassungen von Erziehung durchgesetzt haben, sondern auch wesentliche Momente der praktischen Organisation von Erziehung, ohne die unser heutiges Erziehungssystem nicht denkbar wäre.
Eine entscheidende Voraussetzung moderner Erziehungsvorstellungen ist das, was man die »Entdeckung der Kindheit« genannt hat. Wie der französische Historiker Philippe Ariès in seiner bahnbrechenden »Geschichte der Kindheit« gezeigt hat, gab es Kindheit als eine besondere, vom Erwachsenenalter abgegrenzte Lebensphase keineswegs schon immer. Die Auffassung, dass Kinder eine von den Erwachsenen deutlich geschiedene Altersgruppe bilden, ist Ariès zufolge vielmehr eine Errungenschaft der Neuzeit, die in Europa seit etwa 1500 allmählich aufkam und sich erst im 19. Jahrhundert in allen Bevölkerungsschichten endgültig durchgesetzt hat. Ein besonders eindrücklicher Beleg, den Ariès für diese These anführt, ist die Darstellung des kindlichen Körpers in der Bildenden Kunst. Während Kinder auf Bildern aus dem Mittelalter noch durchweg als verkleinerte Erwachsene dargestellt werden, entsteht erst ab etwa 1500 allmählich ein Blick für die Besonderheit kindlicher Körperproportionen (vgl. Ariès 1975/2007, S. 92ff.).
Im Zuge dieser Entdeckung der Kindheit als einer eigenen Lebensphase setzen sich Ariès zufolge nun auch besondere, pädagogische Formen des Umgangs mit Kindern durch. Während Kinder bisher vor allem durch die selbstverständliche Teilnahme am Leben der Erwachsenen in deren Welt hineinwuchsen, werden sie nun, wie Ariès an einer Fülle von Beispielen demonstriert, immer mehr aus dieser Welt ausgegrenzt, in eine Art Schonraum versetzt und einer Sonderbehandlung unterzogen, die man als »Erziehung« im modernen Sinne bezeichnen kann. Ein deutliches Indiz dieser Entwicklung ist etwa die auch von anderen Historikern beschriebene Entstehung der modernen (Klein-)Familie, die sich durch eine private, von der Außenwelt bzw. vom Arbeitsleben abgeschirmte und emotional aufgeladene Binnensphäre auszeichnet, in deren Mittelpunkt das Kind bzw. die Kinder stehen.
Parallel dazu etabliert sich in einem langen Prozess seit dem Mittelalter auch eine besondere Institution zur Vorbereitung der Kinder auf das Leben in der Gesellschaft: die Schule. Die paradoxe Struktur dieser Institution, die auf das Alltagsleben vorbereitet, indem sie die Kinder daraus ausgrenzt, beruht u. a. darauf, dass das Erwachsenenleben zu komplex, zu störungsanfällig oder zu gefährlich geworden ist, um Kinder das, was zur aktiven Teilnahme daran notwendig ist, wie früher einfach durch Partizipation und Nachahmung lernen zu lassen. Aus diesem Grund entsteht im Laufe der Zeit eine besondere, aus dem Alltagsleben ausgegliederte Institution, in der Kindern die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten systematisch vermittelt werden. Wie lange der Prozess der Durchsetzung dieser Institution gedauert hat, kann man daran ablesen, dass die allgemeine Schulpflicht in Preußen zwar schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts verkündet wurde, aber erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf breiter Ebene (d. h. vor allem auch für die Kinder der Unterschichten, die zuvor als Arbeitskräfte benötigt wurden) wirklich durchgesetzt werden konnte (vgl. Herrlitz, Hopf, Titze & Cloer 2005, S. 50f.).
Alle diese, hier nur grob skizzierten Tendenzen stehen im Zusammenhang mit einer weiteren, für die Geschichte der Pädagogik folgenreichen Entwicklung: der Etablierung eines pädagogischen Diskurses über Erziehungsfragen, die sich in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzieht. Diese Entwicklung kommt nicht nur im sprunghaften Anstieg pädagogischer Veröffentlichungen und der Gründung eigener Zeitschriften zum Ausdruck, sondern auch darin, dass in diesem Zeitraum pädagogische Probleme, wie z. B. die Frage der Erziehung von Waisenkindern, zum Gegenstand öffentlich geführter Debatten werden. Ein weiteres Indiz der Etablierung des neuen Diskurses ist darin zu sehen, dass 1779 in Halle die erste Professur für Pädagogik an einer deutschen Universität eingerichtet wurde, während das Fach bis dahin als Teildisziplin der Philosophie gegolten hatte (vgl. Tenorth 2010, S. 108).
Als Teilbereich der Philosophie begegnet uns das Nachdenken über Fragen der Erziehung auch noch im Werk Kants, zu dessen Pflichten es als Philosophieprofessor an der Universität Königsberg gehörte, in regelmäßigen Abständen eine Vorlesung über Pädagogik zu halten. Doch das neue Interesse an Erziehungsfragen spiegelt sich darin, dass Kants Vorlesung in vielerlei Hinsicht über die frühere Behandlung des Themas hinausgeht und der Erziehung eine zentrale Stellung im aufklärerischen Denkgebäude zuweist. Worin nun besteht der spezifische Beitrag Kants zur theoretischen Fassung des Erziehungsbegriffs?
1.3 Kants Begriff von Erziehung
Ausgangspunkt von Kants Argumentation2 ist eine anthropologische Bestimmung von weit reichender Bedeutung: »Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muß.« (Kant 1803/1983, S. 697) Die Begründung dafür liegt Kant zufolge in der besonderen Ausstattung des Menschen im Unterschied zum Tier:
»Ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; eine fremde Vernunft hat bereits alles für dasselbe besorgt. Der Mensch aber braucht eigene Vernunft. Er hat keinen Instinkt, und muß sich selbst den Plan seines Verhaltens machen. Weil er aber nicht sogleich im Stande ist, dieses zu tun, sondern roh auf die Welt kommt: so müssen es andere für ihn tun.« (Kant 1803/1983, S. 697)
Während das Verhalten der Tiere weitgehend durch Instinkte festgelegt ist, zeichnet sich der Mensch für Kant also durch eine größere Offenheit aus, die aber zugleich mit einer Art Hilflosigkeit verbunden ist und deshalb eine besondere Angewiesenheit auf andere mit sich bringt. Und eben dies, worauf der Mensch angesichts seiner Instinktarmut angewiesen ist, bezeichnet Kant nun als Erziehung. In diesem Sinne gehört für ihn Erzogenwerden zum Menschsein dazu:
»Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht.« (Kant 1803/1983, S. 699)
Betrachtet man diese Aussage näher, so handelt es sich um ein Paradox. Denn einerseits ist der Mensch für Kant offenbar zunächst noch gar nicht Mensch, sondern ein »nichts«, aus dem erst durch Erziehung ein Mensch wird. Auf der anderen Seite beginnt die Aussage mit »Der Mensch …«, und daraus folgt zwingend, dass der Mensch doch auch schon vor aller Erziehung auf irgendeine Art Mensch sein muss, denn sonst könnte er gar nicht als solcher identifiziert (und erzogen) werden. Zum Wesen des Menschen scheint für Kant also eine Art Noch-nicht zu gehören: Gerade insofern der Mensch Mensch ist, ist er es noch nicht, sondern muss durch Erziehung erst noch dazu werden.
Das Paradox lässt sich nur auflösen, wenn man das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, als eine erst noch zu entfaltende Anlage begreift, als entwicklungsoffenes Potenzial, als Möglichkeit, zu deren Realisierung es eben einer besonderen Praxis namens Erziehung bedarf. Genau das tut Kant, wenn er schreibt: »Die Menschengattung soll die ganze Naturanlage der Menschheit, durch ihre eigne Bemühung, nach und nach von selbst herausbringen« (Kant 1803/1983, S. 697). Die »Menschheit« als Inbegriff dessen, was den Menschen als solchen ausmacht3, kommt ihm also zwar von Natur aus zu, aber doch nur als Anlage, die erst noch »heraus(zu)bringen«, zu entwickeln oder zu entfalten ist.
Daraus erwächst jedoch ein Problem: Wenn das, was den Menschen als Menschen ausmacht, noch nicht von Anfang an in ihm anzutreffen ist, sondern erst noch durch Erziehung hervorgebracht werden muss, woher kann man dann wissen, worin dieses Menschsein und damit das Ziel von Erziehung besteht? Die nahe liegende Antwort, man müsse nur ein bereits erzogenes Exemplar der Gattung Mensch betrachten, um zu sehen, wozu die noch nicht erzogenen Menschen gebracht werden sollen, scheidet für Kant deshalb aus, weil Erziehung selbst ein Werk von Menschen und deshalb notwendigerweise unvollkommen sei (vgl. Kant 1803/1983, S. 699).
Die von Kant zwar nicht ausdrücklich formulierte, in seinen Überlegungen aber implizit enthaltene Konsequenz dieses Gedankengangs besteht darin, dass das Ziel von Erziehung letztlich unbestimmt bleiben muss. Dem steht auch die Idee einer »Vervollkommnung der Menschheit« nicht entgegen, die Kant im nächsten Absatz ausführt:
»Vielleicht, dass die Erziehung immer besser werden, und daß jede folgende Generation einen Schritt näher tun wird zur Vervollkommnung der Menschheit; denn hinter der Edukation steckt das große Geheimnis der Vollkommenheit der menschlichen Natur. […] Es ist entzückend, sich vorzustellen, daß die menschliche Natur immer besser durch Erziehung werde entwickelt werden, und daß man diese in eine Form bringen kann, die der Menschheit angemessen ist. Dies eröffnet uns den Prospekt zu einem künftigen glücklichern Menschengeschlechte.« (Kant 1803/1983, S. 700)
Gerade weil das Ziel der Erziehung unbestimmt ist und die »Vollkommenheit der menschlichen Natur« ein »Geheimnis« bleiben muss, ist die »Vervollkommnung der Menschheit« als ein zukunftsoffener Prozess möglich und nötig. Dabei ist – trotz des »Vielleicht«, mit dem die zitierte Passage beginnt – unverkennbar, dass Kants Optimismus im Blick auf einen stetigen Fortschritt dieses Vervollkommnungsprozesses größer ist, als dies nach den Erfahru...
Table of contents
Citation styles for Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
APA 6 Citation
Koller, H.-C. (2020). Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft (9th ed.). Kohlhammer. Retrieved from https://www.perlego.com/book/2076864/grundbegriffe-theorien-und-methoden-der-erziehungswissenschaft-eine-einfhrung-pdf (Original work published 2020)
Chicago Citation
Koller, Hans-Christoph. (2020) 2020. Grundbegriffe, Theorien Und Methoden Der Erziehungswissenschaft. 9th ed. Kohlhammer. https://www.perlego.com/book/2076864/grundbegriffe-theorien-und-methoden-der-erziehungswissenschaft-eine-einfhrung-pdf.
Harvard Citation
Koller, H.-C. (2020) Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. 9th edn. Kohlhammer. Available at: https://www.perlego.com/book/2076864/grundbegriffe-theorien-und-methoden-der-erziehungswissenschaft-eine-einfhrung-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Koller, Hans-Christoph. Grundbegriffe, Theorien Und Methoden Der Erziehungswissenschaft. 9th ed. Kohlhammer, 2020. Web. 15 Oct. 2022.