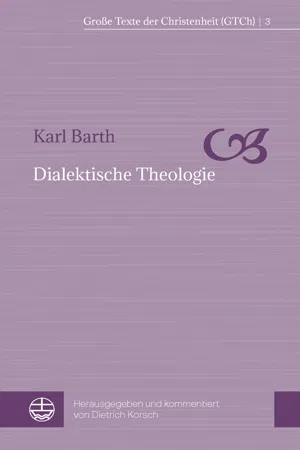![]()
A
Die Texte
![]()
Not und Verheißung der
christlichen Verkündigung
Die freundliche Einladung, die Herr Generalsuperintendent D. Jacobi zur heutigen Tagung1 an mich hat ergehen lassen, enthielt die Aufforderung, Ihnen eine »Einführung in das Verständnis meiner Theologie« zu bieten. Es macht mich immer ein wenig verlegen, so ernsthaft von »meiner Theologie« reden zu hören. Nicht etwa darum, weil ich meinte, was ich treibe, sei etwas Anderes, Besseres als eben schlecht und recht Theologie. Die Kinderkrankheit, mich der Theologie zu schämen, meine ich einigermaßen überstanden zu haben. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht auch und haben sie vielleicht auch schon überstanden. Wohl aber darum, weil ich mich etwas betroffen fragen muß, in was denn eigentlich meine Theologie bestehen möchte, wo denn nun die Kathedrale oder Festung sein könnte, die diesen Namen verdiente und in deren Verständnis ich Sie – an Hand eines Grundrisses etwa – »einführen« könnte. Ich habe genug darunter zu seufzen, daß es so ist, aber ich muß Ihnen offen gestehen, daß das, was ich »meine Theologie« allenfalls nennen kann, wenn ich genau zusehe, schließlich in einem einzigen Punkt besteht, und das ist nicht, wie man es von einer rechten Theologie als Mindestes verlangen dürfte, ein Standpunkt, sondern ein mathematischer Punkt, auf dem man also nicht stehen kann, ein Gesichtspunkt bloß. Alles übrige, was zu einer rechten Theologie gehört, ist bei mir ganz in den Anfängen, und ich weiß nicht, ob ich je darüber hinauskommen werde, ja ob ich es nur wünschen soll, darüber hinauszukommen. Ich maße mir also wirklich nicht an, dem, was die großen ehrwürdigen Schöpfer theologischer Programme und Systeme geleistet haben und noch leisten, etwas Ebenbürtiges oder auch nur Kommensurables zur Seite zu stellen. Fassen Sie meinen Beitrag zur theologischen Diskussion und auch das, was ich heute sagen möchte, nicht als ein Konkurrenzunternehmen zur positiven, liberalen, Ritschl’schen oder religionsgeschichtlichen Theologie auf, sondern als eine Art Randbemerkung und Glosse, die sich mit jenen allen in ihrer Weise verträgt und auch nicht verträgt, die aber nach meiner eigenen Überzeugung ihren Sinn in dem Augenblick verliert, wo sie mehr als das sein, wo sie Raum ausfüllend als neue Theologie neben die andern treten wollte. Sofern Thurneysen, Gogarten und ich wirklich im bekannten Sinn des Worts »Schule machen« sollten, sind wir erledigt. Meine Meinung ist wirklich die, es möchte jedermann in seiner Schule und bei seinen Meistern bleiben, nur vielleicht als Korrektiv, als das »bißchen Zimt« zur Speise, um mit Kierkegaard zu reden2, sich gefallen lassen, was allenfalls in jener Randbemerkung Erhebliches enthalten ist. »Meine Theologie« verhält sich zu den andern richtiggehenden Theologien etwa so wie die Brüdergemeinde zu den andern richtiggehenden Konfessionen und Kirchengemeinschaften; sie will jedenfalls auch keinen neuen eigenen Tropus bilden. Aber nun muß ich schon die zweite Bitte aussprechen, es mir auch nicht als Hochmut und Einbildung auszulegen, wenn ich mich so weigere, in die Reihe gestellt zu werden. Ich weiß ja, daß man nicht in der Luft stehen kann, sondern, ob man will oder nicht und wäre es auch nur mit einem Fuß, immer irgendwo auf der Erde steht. Ich weiß, daß ich nicht der erste und nicht der einzige bin, dem eine theologia viatorum3 quer hindurch durch die vorhandenen theologischen Möglichkeiten zur Linken, zur Rechten und in der Mitte, alle verstehend, alle umfassend und alle überwindend als das Ziel seiner Sehnsucht vorschwebt. Wer möchte heute nicht irgendwie »über den Richtungen« stehen? Ich weiß auch das, daß es noch keinem von diesen wirklichen oder vermeintlichen theologi viatores4 – wenn die Götter ihn nicht so sehr liebten, um ihn früh sterben zu lassen – gelungen ist, seinen Lauf zu vollenden, ohne daß er eben doch, wenn auch nicht eine Kathedrale oder Festung, so doch ein Zigeunerzelt irgendwo errichtet hätte, das dann, ob es ihm recht war oder nicht, statt als Glosse als Text, als eine neue Theologie aufgefaßt worden ist. Kierkegaard selber, diesem verwegensten Springer auf dem Schachbrett, ist es nicht anders ergangen. So werden »wir« es uns wohl gefallen lassen müssen, daß in den Augen Vieler auch jetzt nichts weiter geschieht, als daß eine etwas wunderliche weitere Theologie auf den Plan getreten ist, geistigen Raum ausfüllend, historische Breite gewinnend, fragwürdig genug neben ihren alten und neuen, so viel stattlicheren Nachbarn, wahrscheinlich so etwas wie mystischer oder auch biblizistischer Neu-Supranaturalismus, um nicht zu sagen Neu-Marcionitismus. Wir können nicht verhindern, daß es so aussieht, wir können nur, wenn es sich darum handeln sollte, das, was man da sieht, verstehen zu wollen, versichern, daß wir nicht von der Absicht und Vorbereitung eines solchen Schul- und Systembaus herkommen, sondern – nun eben von der »Not und Verheißung der christlichen Verkündigung«, von der ich heute zu Ihnen sprechen möchte.
Darf ich Ihnen das etwas erklären? Es gehört zur Sache. Ich war 12 Jahre Pfarrer wie Sie alle und hatte meine Theologie, nicht die meinige natürlich, sondern die meines unvergessenen Lehrers Wilhelm Herrmann, aufgepfropft auf die mit meiner Heimat gegebene und mehr unbewußt als bewußt übernommene reformierte Richtung, die ich ja heute auch von Amts wegen zu vertreten habe und gerne vertrete. Unabhängig von diesen meinen theologischen Denkgewohnheiten bin ich dann durch allerlei Umstände immer stärker auf das spezifische Pfarrerproblem der Predigt gestoßen worden, suchte mich, wie Sie das ja sicher alle kennen, zurecht zu finden zwischen der Problematik des Menschenlebens auf der einen und dem Inhalt der Bibel auf der andern Seite. Zu den Menschen, in den unerhörten Widerspruch ihres Lebens hinein sollte ich ja als Pfarrer reden, aber reden von der nicht minder unerhörten Botschaft der Bibel, die diesem Widerspruch des Lebens als ein neues Rätsel gegenübersteht. Oft genug sind mir diese beiden Größen, das Leben und die Bibel, vorgekommen (und kommen mir noch vor!) wie Skylla und Charybdis: Wenn das das Woher? und Wohin? der christlichen Verkündigung ist, wer soll, wer kann da Pfarrer sein und predigen? Ich bin überzeugt, Sie alle kennen diese Lage und diese Plage. Viele von Ihnen kennen sie vielleicht schweigend viel tiefer, stärker und lebendiger als ich, und ihnen habe ich eigentlich heute nichts Wesentliches zu sagen, sie sind in meine Theologie schon eingeführt. Während sie schwiegen, habe ich geredet. Schweigen hat seine Zeit, und Reden hat seine Zeit. Ich überschätze den Wert der Möglichkeit, das Reden zu wählen, nicht, habe mir auch schon gewünscht, geschwiegen zu haben. Aber es war nun einmal so: die bekannte Situation des Pfarrers am Samstag an seinem Schreibtisch, am Sonntag auf der Kanzel verdichtete sich bei mir zu jener Randbemerkung zu aller Theologie, zuletzt in der voluminösen Form eines ganzen Römerbriefkommentars, und ähnlich ist es meinen Freunden ergangen. Nicht als ob ich etwa einen Ausweg gefunden hätte aus jener kritischen Situation, gerade das nicht, wohl aber wurde mir eben diese kritische Situation selbst zur Erläuterung des Wesens aller Theologie. Was kann Theologie anderes sein als der Ausdruck dieser auswegslosen Lage und Frage des Pfarrers, die möglichst wahrhaftige Beschreibung des Gedränges, in das der Mensch kommt, wenn er an diese Aufgabe sich heranwagt, ein Ruf also aus großer Not und großer Hoffnung auf Errettung? Was kann sie anderes tun zur Erfüllung ihrer kulturellen Aufgabe sowohl – und Theologie hat eine solche – wie ihrer pädagogischen, den ahnungslos-ahnungsvollen Jünglingen gegenüber, die beschlossen haben, »Pfarrer zu studieren«, wie man bei uns sagt – was kann sie anderes tun, als sich bei der Bearbeitung ihrer traditionellen historischen, systematischen und praktischen Stoffe dieses ihres innersten wahrhaftigsten Wesens immer wieder bewußt zu werden? Oder welche Situation ist etwa für den Beruf, auf den sie vorbereiten will, bezeichnender als diese? Aber wie kommt es nun, daß man dem theologischen Betrieb so wenig anmerkt davon, daß er auf diesen Beruf, der in diese Situation führt, vorbereitet? Wie kam es nur, mußte ich mich fragen, daß das schon mit der Existenz des Pfarrers gesetzte Frage- und Ausrufezeichen in der Theologie, die ich kannte, sozusagen gar keine Rolle spielte, so daß ich, als ich Pfarrer wurde, von der Wahrheit überfallen werden mußte wie von einem gewappneten Mann? War denn meine Frage wirklich nur meine Frage, und wußten denn etwa andre den Ausweg, den ich nicht fand? Ich sah sie wohl Auswege gehen, aber solche, die ich als Auswege nicht anerkennen konnte. Aber warum suchten dann die mir bekannten Theologien jene Situation, wenn sie sie überhaupt berührten, als erträglich und überwindbar darzustellen, statt sie vor allem einmal zu begreifen, ihr ins Gesicht zu sehen und – dabei vielleicht zu entdecken, daß der Theologie eigenster Gegenstand sich gerade in dieser Situation in ihrer ganzen Unerträglichkeit und Unüberwindbarkeit manifestiert? Sollte es sich nicht lohnen, fragte ich mich weiter, sich zu überzeugen, was für ein Licht alle Theologie gerade von hier aus empfängt? Wäre es der Theologie nicht zu ihrem eigenen Heil besser, sie wollte am Ende nichts anderes sein als das Wissen um die not- und verheißungsvolle Lage und Frage des christlichen Verkündigers? Müßte sich nicht alles Weitere von selbst aus diesem Wissen ergeben? Bedrängt von dieser Frage – und ich frage nochmals: ist das bloß meine zufällige Frage? – habe ich mich seinerzeit an die Arbeit am Römerbrief gemacht, die anfänglich nur ein Versuch sein sollte, mich mit mir selbst zu verständigen. Natürlich steht nun sehr viel scheinbar ganz anderes in dem Buch: neutestamentliche Theologie, Dogmatik, Ethik, Philosophie. Aber am besten verstehen Sie es dann, wenn Sie aus allem immer wieder den Pfarrer heraushören, mit seiner Frage: was heißt predigen?, und – nicht: wie macht man das?, sondern: wie kann man das? Das andre, was darinsteht, ist schon Reflex, nicht selber das Licht, auf das ich mich hingewiesen sah und hinweisen möchte. Und so kam es denn zu dem, was sich jetzt als »meine Theologie«, sagen wir einmal als »Theologie des Korrektivs« schon ein wenig breit machen will.
Ich sage Ihnen das alles nicht, um Sie mit meiner Biographie zu behelligen, sondern um Ihnen zu zeigen, inwiefern meine Absicht, wenigstens primär, nicht eine neue Theologie, sondern eine sozusagen von außen an die Theologie herankommende Beleuchtung ist, und zwar eine Beleuchtung gerade von dorther, wo Sie, vielleicht nicht als Theologen, aber sicher als Pfarrer ohnehin stehen. Es scheint mir, es könne gar nicht anders sein, als daß wir uns heute verstehen, wenn Sie mir zunächst einmal dies Eine abnehmen, daß ich im Grunde, wohlverstanden, wenn Sie den Humor haben, über einiges Zufällige freundlich hinweg zusehen, nicht mit einer neuen erstaunlichen Theologie bewaffnet daherkomme, sondern, welches auch Ihre Theologie sein möge, einfach mit Verständnis und Teilnahme für Ihre Lage als Pfarrer neben Sie treten möchte. Fassen Sie es darum richtig auf, wenn ich heute mehr als Pfarrer zu Kollegen, denn als Professor zu Ihnen rede. Nach der Lage der Sache ist zweifellos das die sinngemäße Ausführung des mir gewordenen Auftrags. Habe ich nicht nur einen Gesichts punkt, sondern etwa auch einen Standpunkt, so ist es einfach der wohlbekannte des Mannes auf der Kanzel, vor sich die geheimnisvolle Bibel und die geheimnisvollen Köpfe seiner mehr oder weniger zahlreichen Zuhörer – ja was ist nun geheimnisvoller? Auf alle Fälle: Was nun? Wenn es mir gelingen sollte, Ihnen dies »Was nun?« in seinem ganzen Gehalt wieder einmal akut in Erinnerung zu rufen, so habe ich Sie nicht nur für meinen Standpunkt, der ja ohnehin der Ihrige ist, sondern auch für meinen Gesichtspunkt gewonnen, was Sie auch von meiner Theologie halten mögen.
Wenn am Sonntag morgen die Glocken ertönen, um Gemeinde und Pfarrer zur Kirche zu rufen, dann besteht da offenbar die Erwartung eines großen, bedeutungsvollen, ja entscheidenden Geschehens. Wie stark diese Erwartung in den etwa beteiligten Menschen lebt, ja ob da überhaupt Menschen sind, die sie bewußterweise hegen, darauf kommt jetzt gar nichts an. Die Erwartung besteht, sie liegt in der ganzen Situation. Da ist eine uralte ehrwürdige Institution, oft und schwer angegriffen von außen und noch öfter und schwerer kompromittiert von innen, aber von unverwüstlicher Lebens- oder sagen wir Daseinskraft, wandlungsfähig und beharrlich zugleich, altertümlich und in der Regel auch modern (was jeweilen gerade modern heißt), obwohl sie beides nicht gerne Wort haben will, den schwersten intellektuellen, politischen, sozialen und sogar religiösen Erschütterungen bis jetzt siegreich gewachsen – und wie sollte sie es nicht auch in Zukunft sein? Ihr Vorhandensein begründet auf einen Anspruch, der in groteskem Widerspruch zu stehen scheint mit den Tatsachen und dessen Berechtigung und Möglichkeit doch eigentlich nur ganz Wenige und wenig Beachtliche etwa laut und unzweideutig und restlos zu leugnen wag...